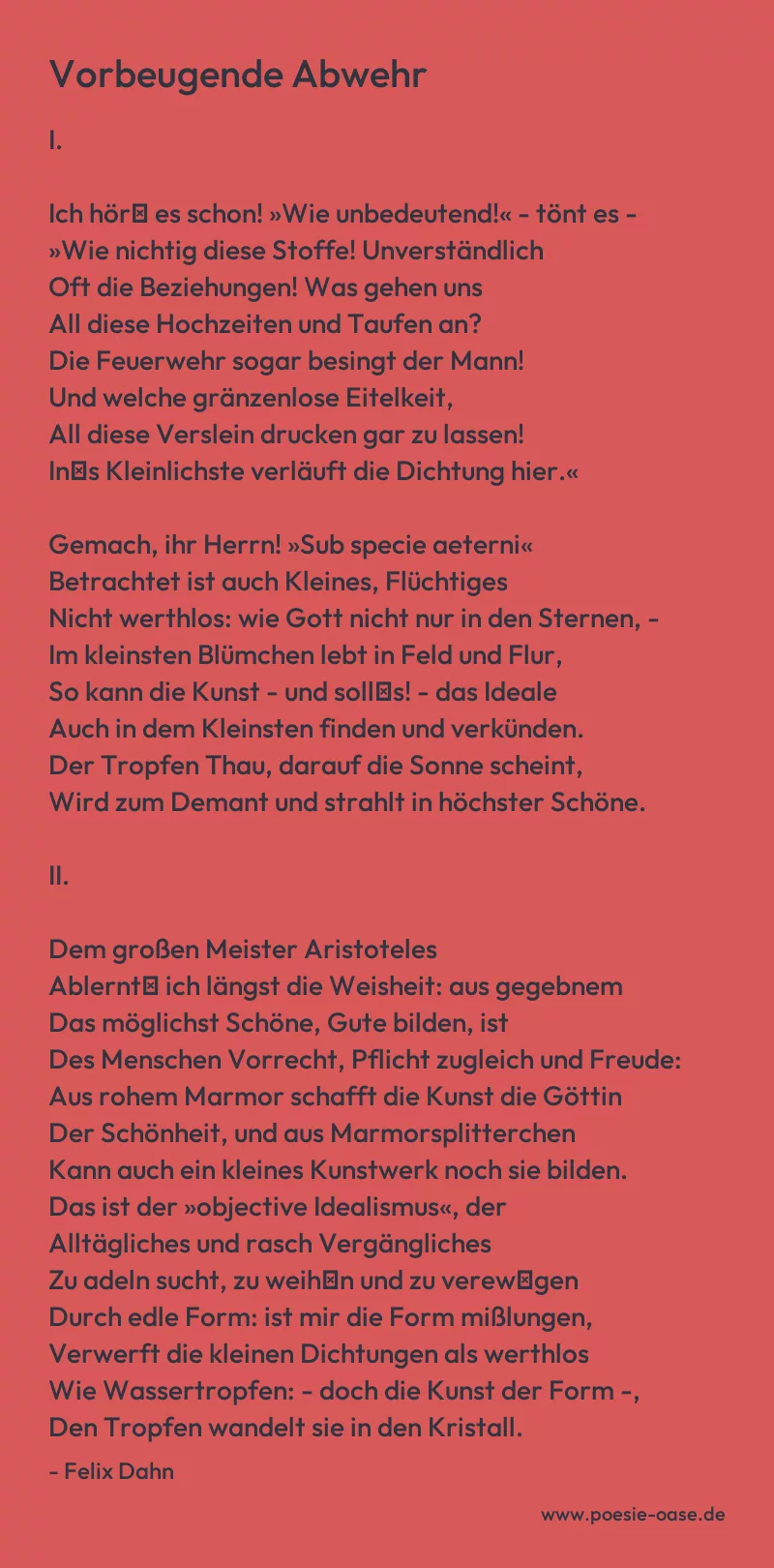Vorbeugende Abwehr
I.
Ich hör′ es schon! »Wie unbedeutend!« – tönt es –
»Wie nichtig diese Stoffe! Unverständlich
Oft die Beziehungen! Was gehen uns
All diese Hochzeiten und Taufen an?
Die Feuerwehr sogar besingt der Mann!
Und welche gränzenlose Eitelkeit,
All diese Verslein drucken gar zu lassen!
In′s Kleinlichste verläuft die Dichtung hier.«
Gemach, ihr Herrn! »Sub specie aeterni«
Betrachtet ist auch Kleines, Flüchtiges
Nicht werthlos: wie Gott nicht nur in den Sternen, –
Im kleinsten Blümchen lebt in Feld und Flur,
So kann die Kunst – und soll′s! – das Ideale
Auch in dem Kleinsten finden und verkünden.
Der Tropfen Thau, darauf die Sonne scheint,
Wird zum Demant und strahlt in höchster Schöne.
II.
Dem großen Meister Aristoteles
Ablernt′ ich längst die Weisheit: aus gegebnem
Das möglichst Schöne, Gute bilden, ist
Des Menschen Vorrecht, Pflicht zugleich und Freude:
Aus rohem Marmor schafft die Kunst die Göttin
Der Schönheit, und aus Marmorsplitterchen
Kann auch ein kleines Kunstwerk noch sie bilden.
Das ist der »objective Idealismus«, der
Alltägliches und rasch Vergängliches
Zu adeln sucht, zu weih′n und zu verew′gen
Durch edle Form: ist mir die Form mißlungen,
Verwerft die kleinen Dichtungen als werthlos
Wie Wassertropfen: – doch die Kunst der Form -,
Den Tropfen wandelt sie in den Kristall.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
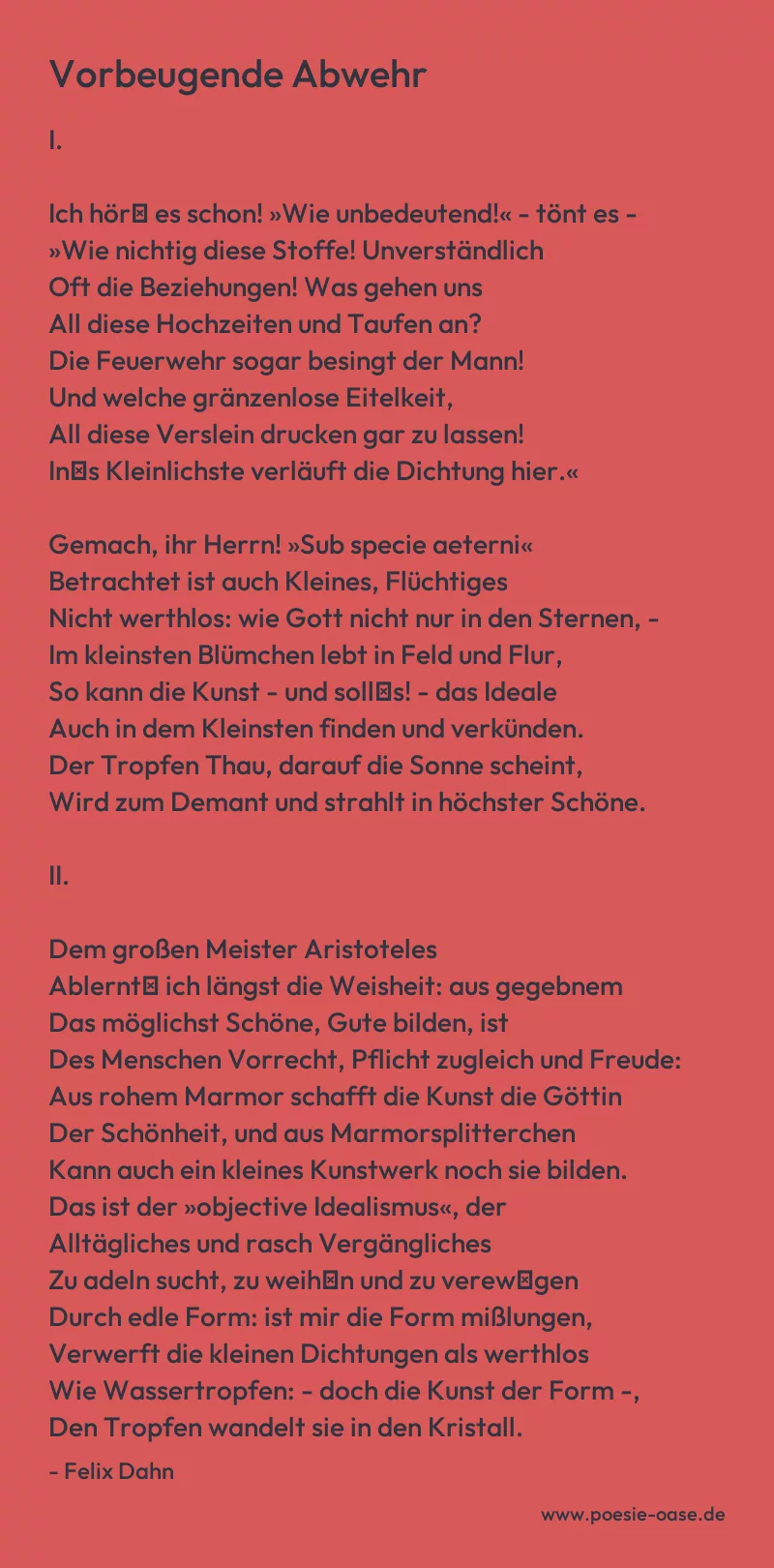
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Vorbeugende Abwehr“ von Felix Dahn ist eine Verteidigung der Kunst und ihrer Fähigkeit, das vermeintlich Kleine und Unbedeutende zu veredeln und ihm eine Bedeutung zu verleihen. Der Autor reagiert auf Kritik, die das Schreiben als belanglos und überflüssig abtut. Er kontert diese Kritik, indem er die transformative Kraft der Kunst hervorhebt und die Fähigkeit, Schönheit und Bedeutung selbst in den kleinsten Details zu entdecken, betont.
Der erste Teil des Gedichts stellt die Kritik dar, die Dahn ausgesetzt ist. Er zitiert Vorwürfe der Nichtigkeit, der fehlenden Relevanz und der Eitelkeit. Die Kritiker scheinen die Kunst als verschwenderisch und überflüssig anzusehen, die sich mit trivialen Themen befasst. Dahn verteidigt sich, indem er die metaphysische Perspektive „sub specie aeterni“ einführt und darauf hinweist, dass selbst das scheinbar Kleine und Flüchtige aus einer ewigen Perspektive betrachtet wertvoll sein kann. Er argumentiert, dass Gott nicht nur in den großen Dingen, sondern auch in den kleinsten Details der Natur präsent ist, was ein Gleichnis für die Kunst darstellt.
Im zweiten Teil des Gedichts entfaltet Dahn seine künstlerische Philosophie. Er bezieht sich auf Aristoteles und dessen Prinzip, aus gegebenen Materialien das Schönste und Beste zu erschaffen. Dahn argumentiert, dass es die Aufgabe des Menschen und der Kunst ist, das Alltägliche zu adeln, zu weihen und zu verewigen. Durch die „edle Form“ kann die Kunst selbst dem Vergänglichen Bestand verleihen, so wie ein Wassertropfen durch die Kunst der Form zu einem Kristall wird. Die zentrale Metapher ist die des Wassertropfens, der durch die Kunst zur Schönheit eines Kristalls geformt wird.
Die Struktur des Gedichts, das in zwei Abschnitte unterteilt ist, spiegelt die Auseinandersetzung mit der Kritik und die Verteidigung der Kunst wider. Der erste Abschnitt präsentiert die Kritik und die anfängliche Verteidigung, während der zweite Abschnitt die philosophische Grundlage der Kunstlehre Dahns darlegt. Der Kontrast zwischen den scheinbar unbedeutenden Themen und der Fähigkeit der Kunst, ihnen Bedeutung zu verleihen, ist das zentrale Thema. Dahns Gedicht ist somit eine Ode an die Kraft der Kunst, das Alltägliche in etwas Besonderes zu verwandeln, und eine Verteidigung der Poesie gegen die Vorwürfe der Irrelevanz.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.