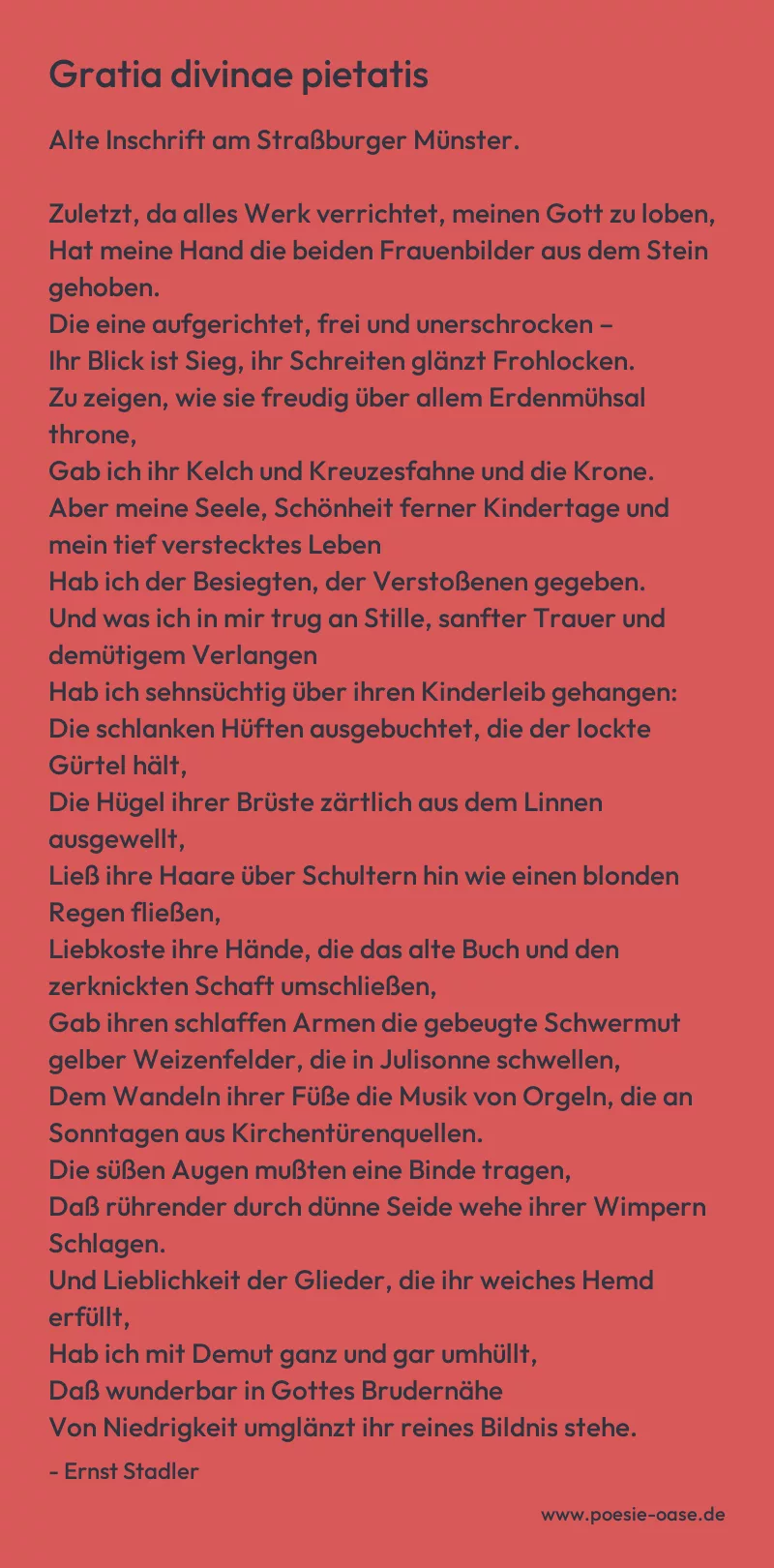Alltag, Berge & Täler, Emotionen & Gefühle, Feiern, Freiheit & Sehnsucht, Frieden, Glaube & Spiritualität, Harmonie, Herbst, Herzschmerz, Kriegsgeschichte, Religion, Weisheiten
Gratia divinae pietatis
Alte Inschrift am Straßburger Münster.
Zuletzt, da alles Werk verrichtet, meinen Gott zu loben,
Hat meine Hand die beiden Frauenbilder aus dem Stein gehoben.
Die eine aufgerichtet, frei und unerschrocken –
Ihr Blick ist Sieg, ihr Schreiten glänzt Frohlocken.
Zu zeigen, wie sie freudig über allem Erdenmühsal throne,
Gab ich ihr Kelch und Kreuzesfahne und die Krone.
Aber meine Seele, Schönheit ferner Kindertage und mein tief verstecktes Leben
Hab ich der Besiegten, der Verstoßenen gegeben.
Und was ich in mir trug an Stille, sanfter Trauer und demütigem Verlangen
Hab ich sehnsüchtig über ihren Kinderleib gehangen:
Die schlanken Hüften ausgebuchtet, die der lockte Gürtel hält,
Die Hügel ihrer Brüste zärtlich aus dem Linnen ausgewellt,
Ließ ihre Haare über Schultern hin wie einen blonden Regen fließen,
Liebkoste ihre Hände, die das alte Buch und den zerknickten Schaft umschließen,
Gab ihren schlaffen Armen die gebeugte Schwermut gelber Weizenfelder, die in Julisonne schwellen,
Dem Wandeln ihrer Füße die Musik von Orgeln, die an Sonntagen aus Kirchentürenquellen.
Die süßen Augen mußten eine Binde tragen,
Daß rührender durch dünne Seide wehe ihrer Wimpern Schlagen.
Und Lieblichkeit der Glieder, die ihr weiches Hemd erfüllt,
Hab ich mit Demut ganz und gar umhüllt,
Daß wunderbar in Gottes Brudernähe
Von Niedrigkeit umglänzt ihr reines Bildnis stehe.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
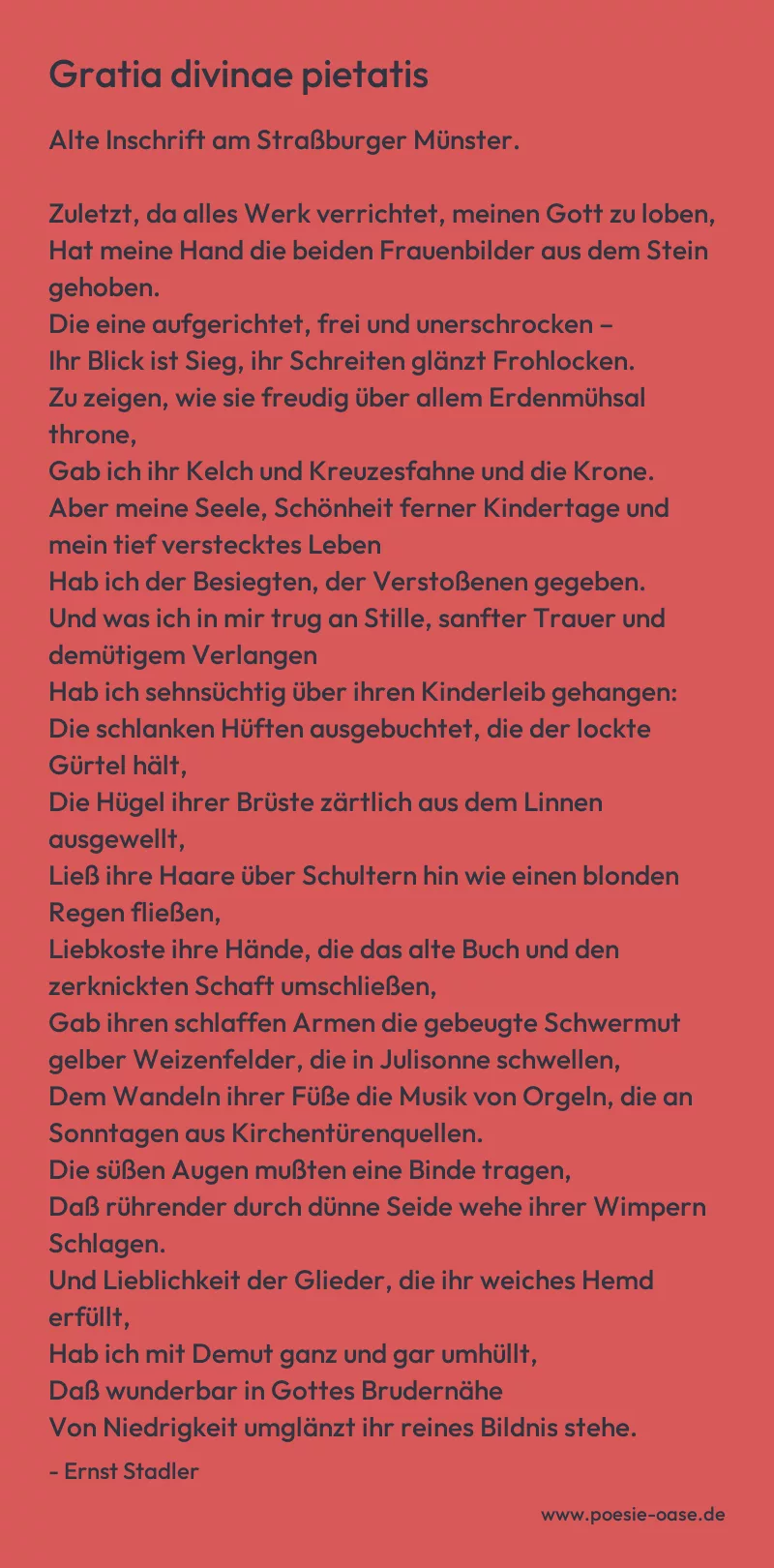
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Gratia divinae pietatis“ von Ernst Stadler ist eine tiefgründige Reflexion über die Dualität von Triumph und Leiden, Schönheit und Demut, die in der christlichen Ikonographie verkörpert werden. Es ist inspiriert von einer Inschrift am Straßburger Münster und beschreibt die Schöpfung zweier Frauengestalten, wobei der Fokus auf der konträren Gestaltung der Figuren liegt. Das Gedicht offenbart Stadlers persönliche Auseinandersetzung mit den Aspekten des Glaubens und der menschlichen Natur, indem er die Gegensätze gegenüberstellt und so eine tiefere Bedeutungsebene erschafft.
In der ersten Hälfte des Gedichts wird die siegreiche, triumphierende Figur beschrieben, die „frei und unerschrocken“ ist. Sie wird mit Attributen des Sieges und der Macht geschmückt, was auf die Darstellung der Kirche oder einer ähnlichen erhabenen Figur hindeutet. Stadler betont die erhebende Natur dieser Figur durch ihre „frohlockende“ Erscheinung und die Symbole von Kelch, Kreuz und Krone, die ihre königliche und überirdische Qualität hervorheben. Dies steht im Kontrast zu der zweiten Figur, die im Zentrum der zweiten Gedichthälfte steht. Stadler hebt hier das Ideal der Erhabenheit und des Triumphes hervor, aber er stellt es nicht in den Mittelpunkt seiner Intention.
Die zweite Figur, die „Besiegte“, die „Verstoßene“, wird mit einer intensiven Sinnlichkeit und einem Gefühl von tiefer Trauer und Demut charakterisiert. Stadler verwendet detaillierte, sinnliche Bilder, um ihre Schönheit und Verletzlichkeit zu beschreiben. Die Beschreibung von „schlanken Hüften,“ „Hügeln ihrer Brüste“ und „blonden Regen“ von Haaren evoziert ein Gefühl von irdischer Schönheit und Anmut. Gleichzeitig vermittelt Stadler durch die Beschreibung von „Stille, sanfter Trauer und demütigem Verlangen“ eine innere, spirituelle Qualität, die mit ihrer äußeren Erscheinung verschmilzt.
Die Gegenüberstellung der beiden Figuren ist von zentraler Bedeutung für die Interpretation des Gedichts. Stadler scheint die traditionellen christlichen Werte der Demut und des Leidens der Welt des Triumphes und der weltlichen Macht vorzuziehen. Er betont die Bedeutung der „Niedrigkeit“ als Weg zur „Gottes Brudernähe“. Die Bindung der Augen und die Betonung der „süßen Augen“ und der „wehen Wimpern“ verstärken die Idee, dass wahre Schönheit und spirituelle Erkenntnis im Verborgenen und Leidvollen zu finden sind. Die ergreifende, sinnliche Beschreibung der zweiten Figur steht im Gegensatz zu der mehr distanzierten Darstellung der ersten Figur und unterstreicht die persönliche, emotionale Verbindung des Dichters zu dieser Figur.
Insgesamt ist „Gratia divinae pietatis“ ein tiefgründiges Gedicht, das die komplexen Facetten des Glaubens und der menschlichen Erfahrung erforscht. Stadler verbindet sinnliche Schönheit mit tiefer Demut, um eine Botschaft von spiritueller Erhebung durch das Leiden und die Bescheidenheit zu vermitteln. Die kontrastierenden Bilder der beiden Frauenfiguren spiegeln eine Auseinandersetzung mit den traditionellen Werten der christlichen Ikonographie wider und zeigen Stadlers eigene, persönliche Interpretation von Glaube und Schönheit. Das Gedicht hinterfragt die vorherrschende Erwartung von Macht und Triumph und findet die wahre Schönheit in den „Niedrigkeiten“ des Lebens.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.