Ich weiß wohl, was dich bannt in mir,
Die Lebensglut in meiner Brust,
Die süße zauberhafte Zier,
Der bangen tiefgeheimen Lust,
Die aus mir strahlet, ruft zu dir,
Schließ mich in einen Felsen ein,
Ruft doch arm Lind durch Mark und Bein:
Komm, lebe, liebe, stirb an mir,
Leg′ dir diesen Fels auf deine Brust,
Du mußt, mußt.
14. Juli 1834
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
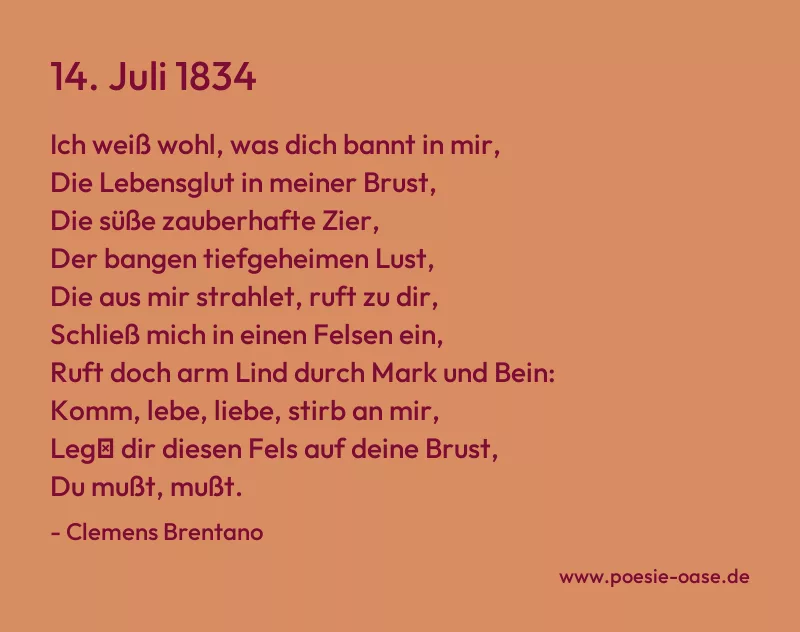
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „14. Juli 1834“ von Clemens Brentano ist eine ergreifende Liebeserklärung, die von einer tiefen Sehnsucht und der Faszination des Todes durchzogen ist. Es zeichnet sich durch eine Mischung aus romantischer Leidenschaft und einer dunklen, fast morbid anmutenden Obsession aus. Die direkte Ansprache an einen geliebten Menschen, oder vielleicht eher an eine geliebte Vorstellung von einem solchen, ist ein zentrales Merkmal des Gedichts. Die Worte fließen in einem Sog der Hingabe und Selbstaufopferung.
Die ersten vier Zeilen beschreiben die Ursache der unwiderstehlichen Anziehungskraft, die vom lyrischen Ich ausgeht. Es ist die „Lebensglut“ in der Brust, die „süße zauberhafte Zier“ und die „bangen tiefgeheimen Lust“, die den anderen Menschen verzaubert und anzieht. Diese Beschreibung deutet auf eine intensive, fast übernatürliche Ausstrahlung hin, die mit ihrer verführerischen Wirkung den/die Angesprochene/n in ihren Bann zieht. Das Wort „bannt“ impliziert dabei bereits eine gewisse Gefangenschaft, ein Festhalten, das sowohl bezaubern als auch beängstigen kann. Die Frage, ob diese Anziehung aus Freude oder Bedrängnis besteht, wird in der Folge durch das tragische Ende beantwortet.
Der Wendepunkt des Gedichts liegt in der Aufforderung, sich in einen „Felsen“ einzuschließen. Dies ist ein Metapher für eine tiefe, vielleicht sogar einsame Isolation, in die das lyrische Ich den geliebten Menschen zwingen möchte. Die Aussage, die durch „Ruft doch arm Lind durch Mark und Bein“ verstärkt wird, dass er/sie „Komm, lebe, liebe, stirb an mir“ soll, offenbart die eigentliche Intention. Hier verschmilzt die Liebe mit dem Tod. Das lyrische Ich sehnt sich danach, im geliebten Menschen zu existieren und ihn/sie gleichzeitig zu zerstören, eine paradoxe Verbindung, die auf eine tiefe Verzweiflung und ein Verlangen nach ewiger Vereinigung hindeutet, selbst wenn dies den Tod bedeutet.
Die abschließenden Zeilen sind ein dramatischer Höhepunkt. Der Wunsch, dem geliebten Menschen einen „Fels auf die Brust“ zu legen, verstärkt die Vorstellung von Last und Erdrückung. Der doppelte Befehl „Du mußt, mußt“ unterstreicht die Unausweichlichkeit des Schicksals, die Zwanghaftigkeit der Liebe und die Überzeugung des lyrischen Ichs, dass der geliebte Mensch seinem Ruf folgen und in der Liebe sterben muss. Das Gedicht zeugt von einer leidenschaftlichen, aber auch zerstörerischen Liebe, die das Gleichgewicht zwischen Leben und Tod, Anziehung und Zerstörung auflöst. Es ist ein romantisches Bekenntnis, das von dunklen Untertönen durchzogen ist.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
