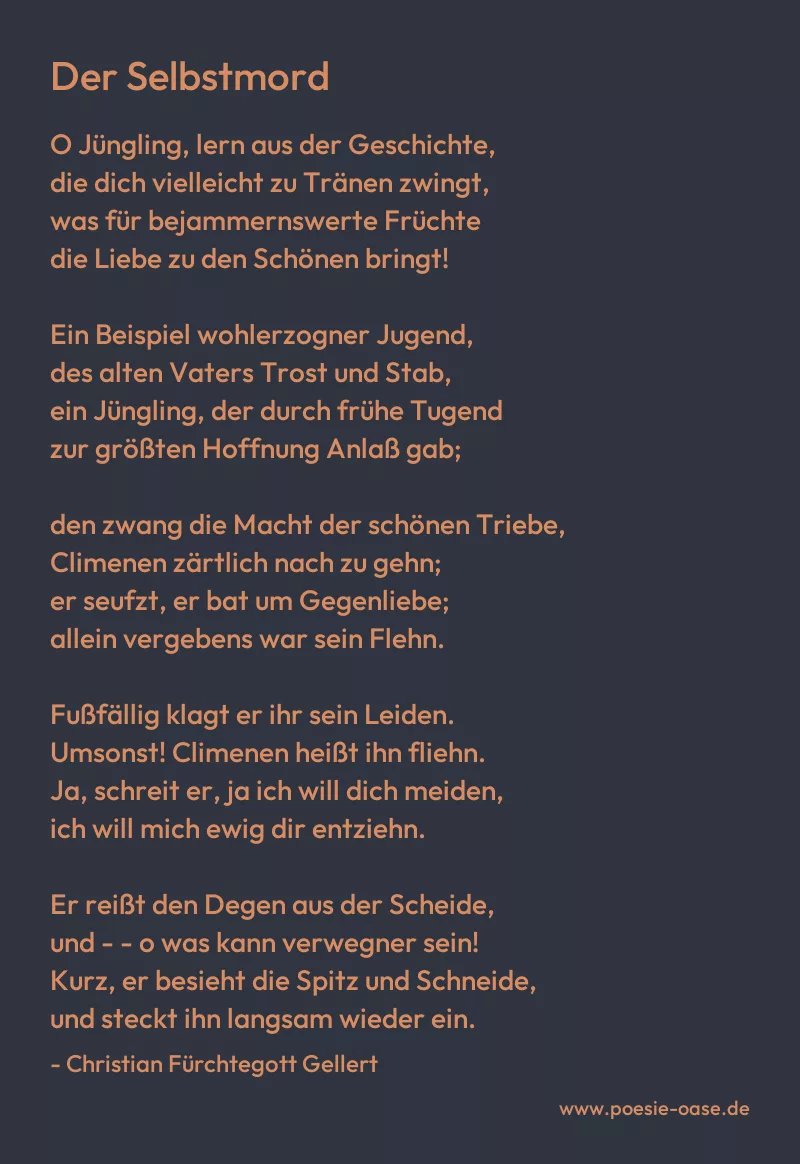Der Selbstmord
O Jüngling, lern aus der Geschichte,
die dich vielleicht zu Tränen zwingt,
was für bejammernswerte Früchte
die Liebe zu den Schönen bringt!
Ein Beispiel wohlerzogner Jugend,
des alten Vaters Trost und Stab,
ein Jüngling, der durch frühe Tugend
zur größten Hoffnung Anlaß gab;
den zwang die Macht der schönen Triebe,
Climenen zärtlich nach zu gehn;
er seufzt, er bat um Gegenliebe;
allein vergebens war sein Flehn.
Fußfällig klagt er ihr sein Leiden.
Umsonst! Climenen heißt ihn fliehn.
Ja, schreit er, ja ich will dich meiden,
ich will mich ewig dir entziehn.
Er reißt den Degen aus der Scheide,
und – – o was kann verwegner sein!
Kurz, er besieht die Spitz und Schneide,
und steckt ihn langsam wieder ein.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
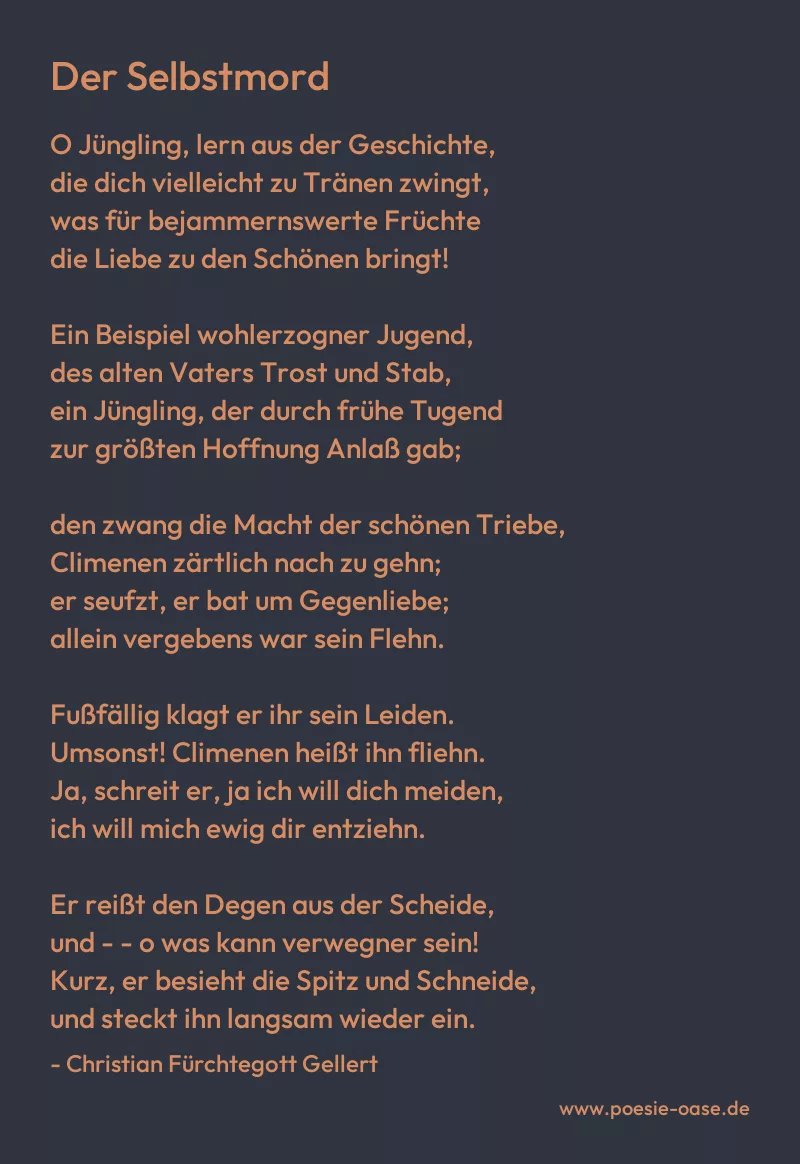
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Selbstmord“ von Christian Fürchtegott Gellert ist eine satirische Betrachtung über unerwiderte Liebe und die dramatischen Reaktionen eines jungen Mannes. Es beginnt mit einer moralisierenden Ansprache an den Leser, in der die negativen Folgen der Liebe zu „Schönen“ als Thema eingeführt werden. Gellert weckt sofort Erwartungen an eine tragische Geschichte, indem er die Tränen des Lesers antizipiert und die „bejammernswerten Früchte“ der Liebe betont.
Der zweite Teil des Gedichts etabliert den Protagonisten als einen vorbildlichen jungen Mann, der durch seine Tugend Hoffnungen weckte. Diese Beschreibung dient dazu, den Kontrast zur folgenden Reaktion zu verstärken und die Absurdität der Situation hervorzuheben. Die Formulierung „zwang die Macht der schönen Triebe“ deutet bereits auf die Unkontrollierbarkeit und die zerstörerische Kraft der Liebe hin, die den jungen Mann dazu bringt, Climenen nachzujagen. Die darauffolgende Beschreibung seiner vergeblichen Bemühungen, Gegenliebe zu erlangen, unterstreicht die Ohnmacht des Liebenden.
In der dritten Strophe erreicht die Verzweiflung des Jünglings ihren Höhepunkt. Er klagt Climenen sein Leiden, doch seine Bemühungen sind vergebens. Climenen weist ihn ab, was ihn zu einer pathetischen Drohung veranlasst, sich von ihr abzuwenden. Die dramatische Wendung im letzten Vers ist von besonderer Bedeutung. Statt des erwarteten Suizids, zieht der Jüngling seinen Degen und betrachtet ihn dann wieder, um ihn schließlich wieder einzustecken.
Die Ironie des Gedichts liegt in diesem unerwarteten Ende. Gellert demontiert die melodramatische Erwartung eines Selbstmords und entlarvt die theatralische Geste des Jünglings. Die Pointe ist, dass der „Selbstmord“ letztendlich nicht vollzogen wird, wodurch die lächerliche Übertreibung der Gefühle und der Wunsch nach Aufmerksamkeit des jungen Mannes entlarvt werden. Gellerts Gedicht ist somit eine subtile Kritik an übertriebenen Gefühlen und der Unreife, die in manchen Liebesbeziehungen zum Ausdruck kommen kann.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.