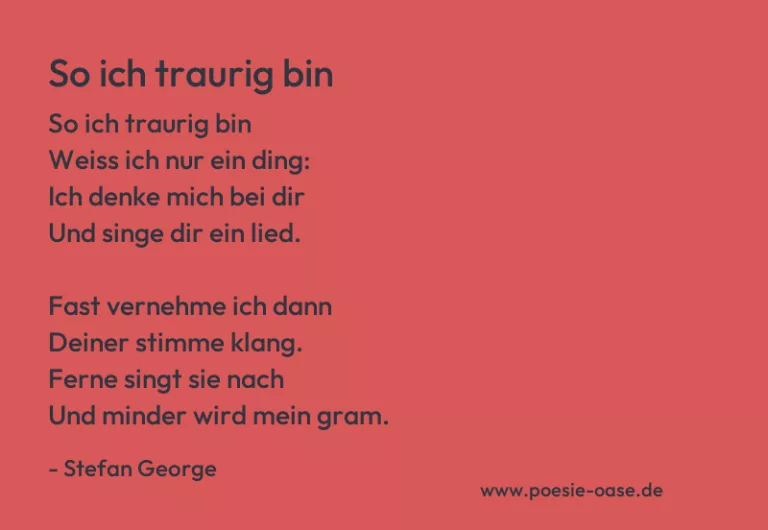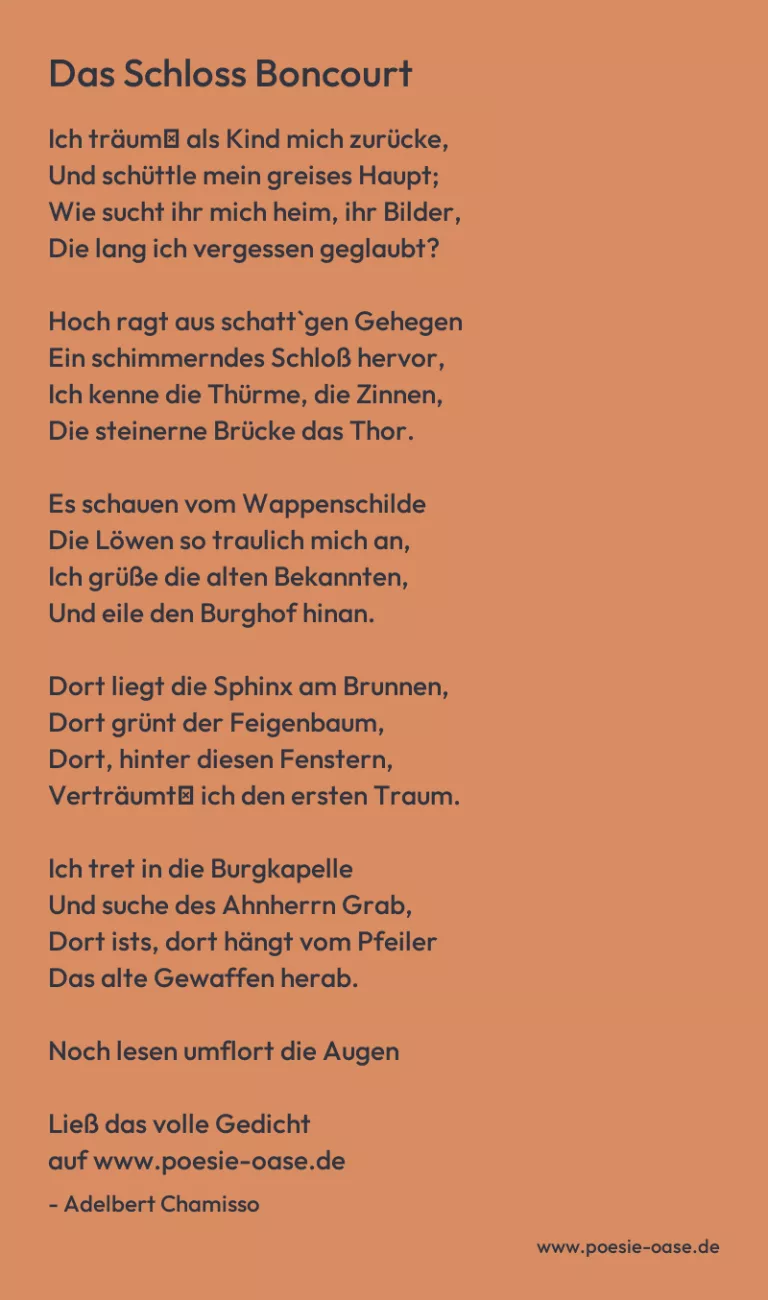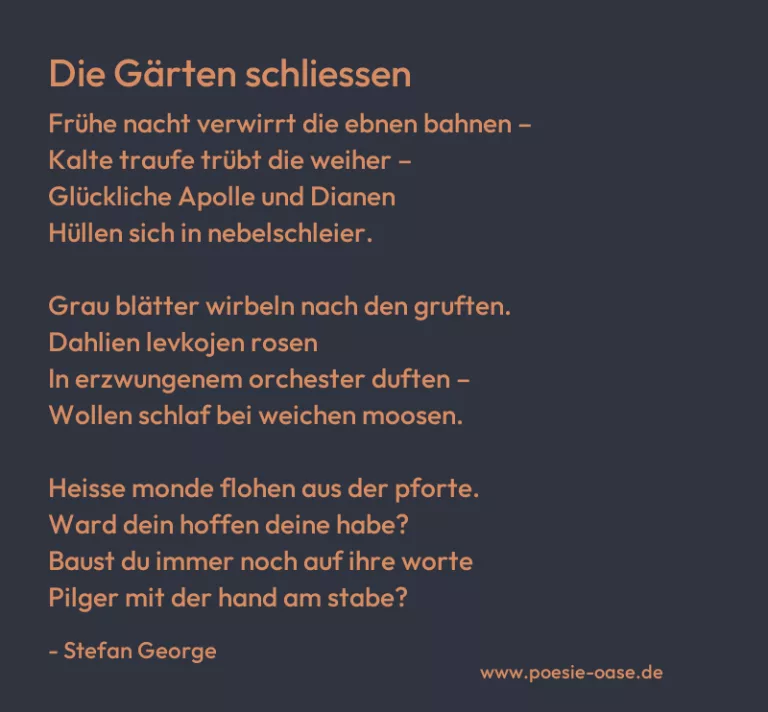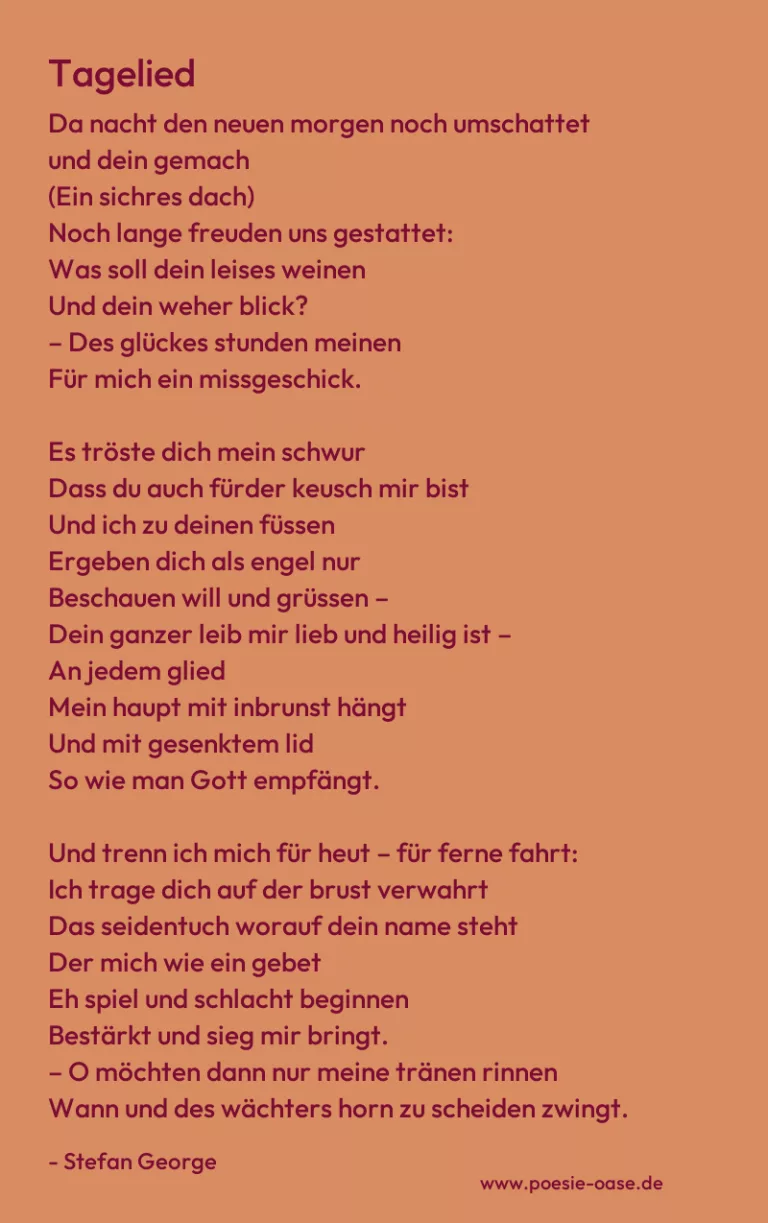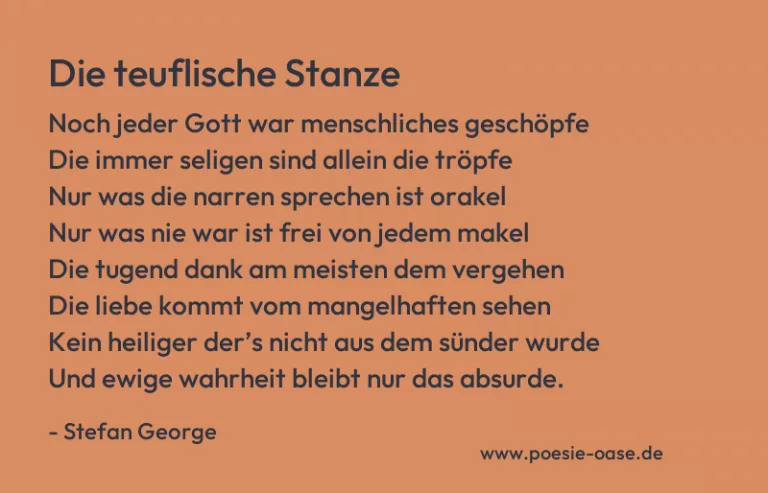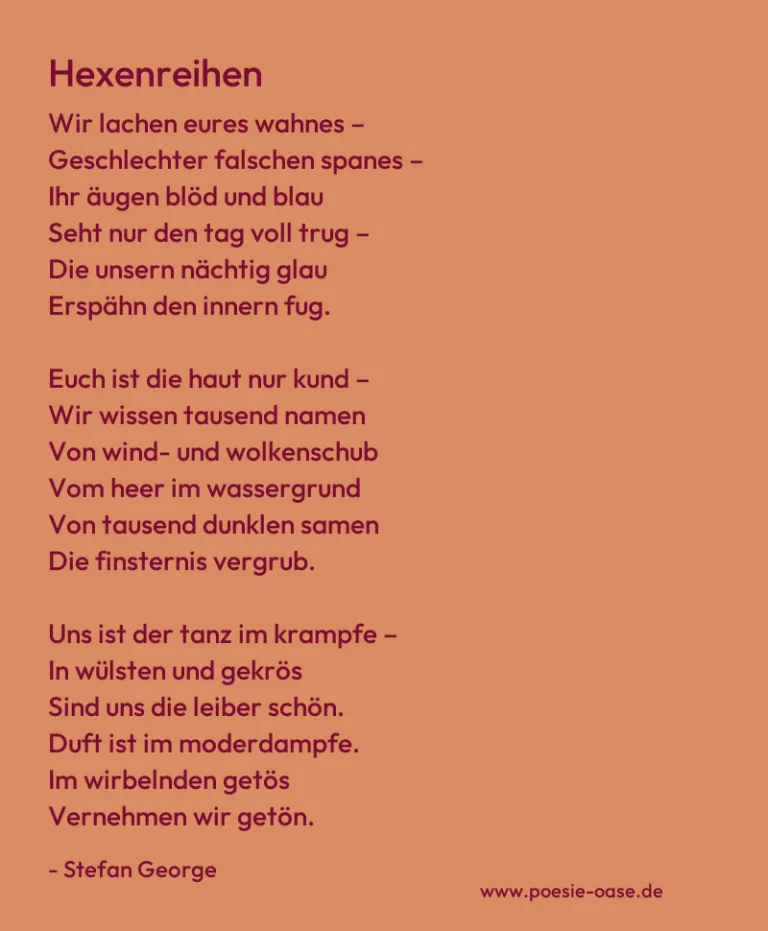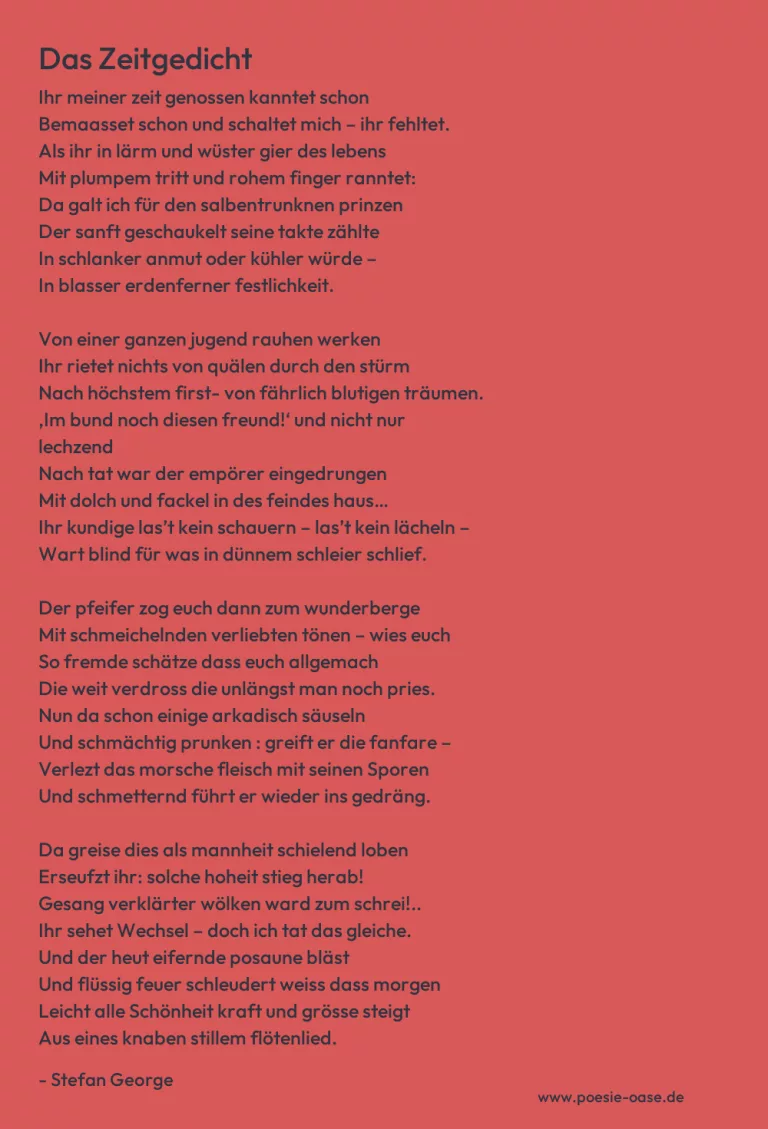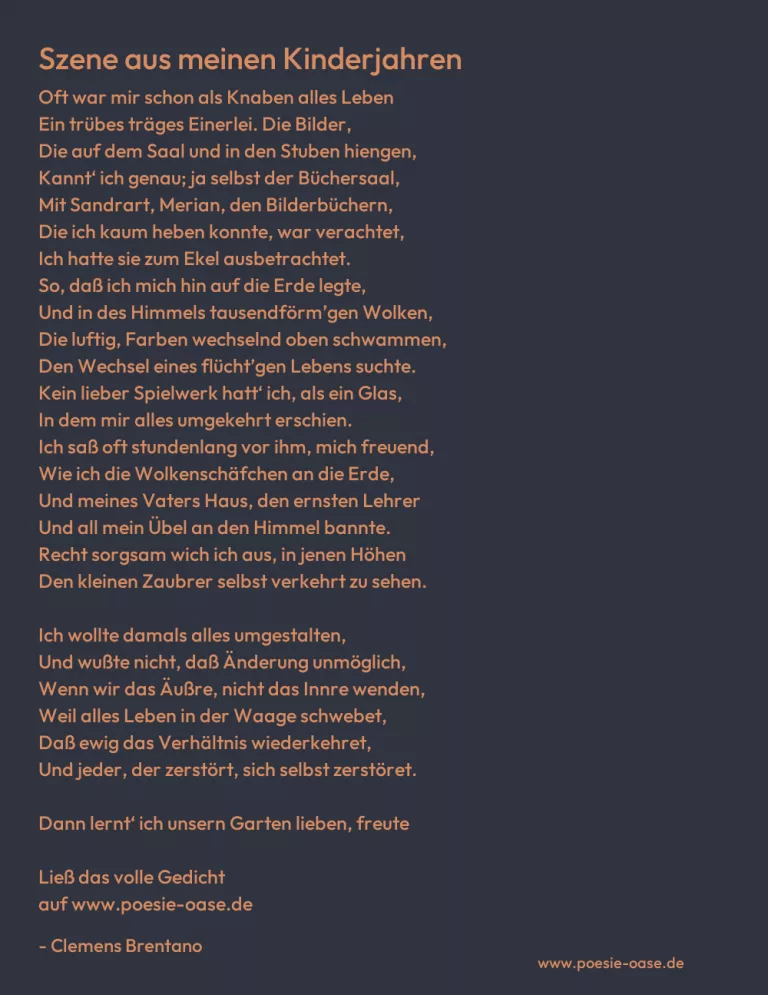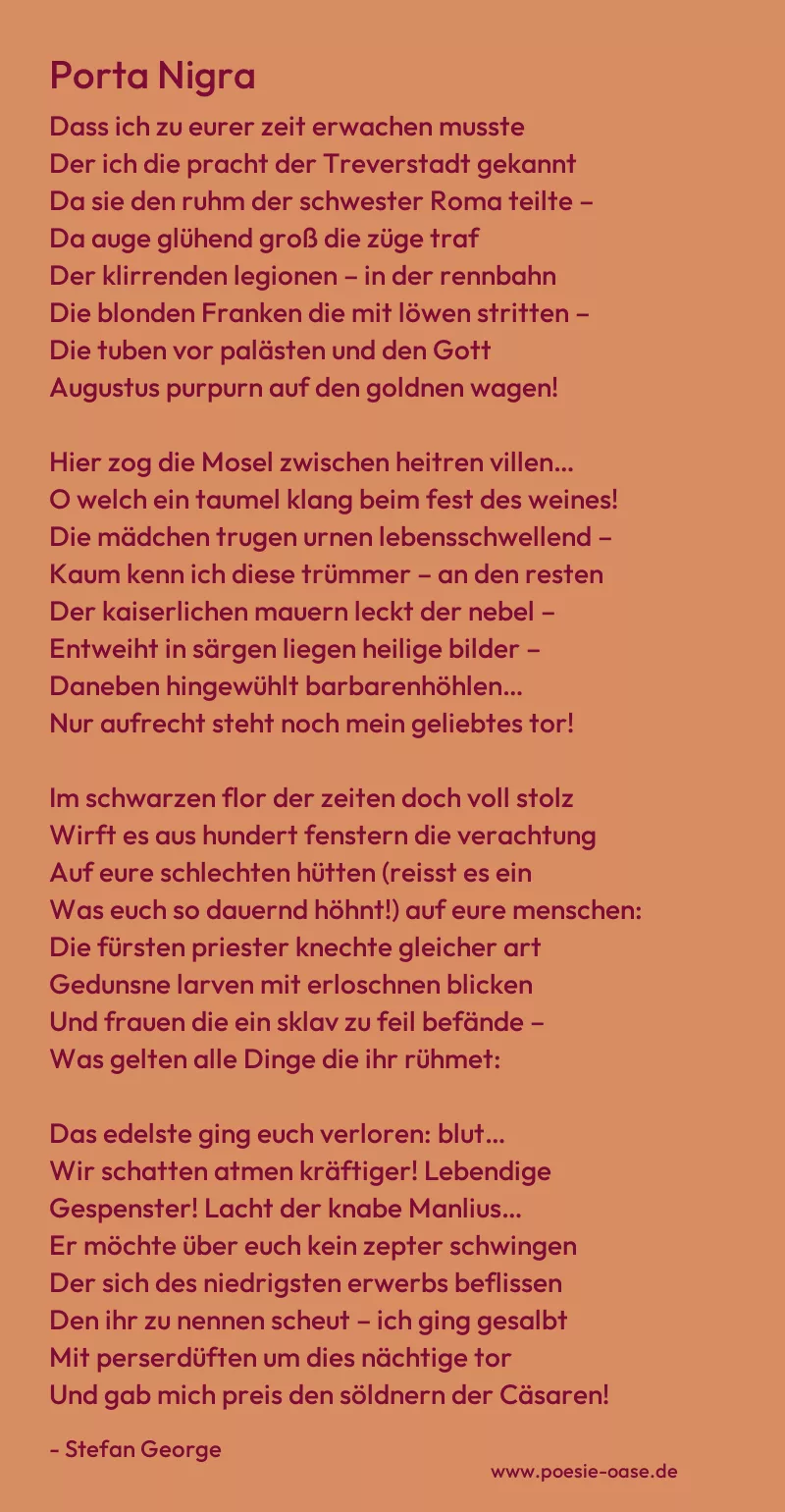Alltag, Angst, Einsamkeit, Erinnerungen, Feiern, Gegenwart, Geld, Gemeinfrei, Harmonie, Heldenmut, Herbst, Religion, Zerstörung
Porta Nigra
Dass ich zu eurer zeit erwachen musste
Der ich die pracht der Treverstadt gekannt
Da sie den ruhm der schwester Roma teilte –
Da auge glühend groß die züge traf
Der klirrenden legionen – in der rennbahn
Die blonden Franken die mit löwen stritten –
Die tuben vor palästen und den Gott
Augustus purpurn auf den goldnen wagen!
Hier zog die Mosel zwischen heitren villen…
O welch ein taumel klang beim fest des weines!
Die mädchen trugen urnen lebensschwellend –
Kaum kenn ich diese trümmer – an den resten
Der kaiserlichen mauern leckt der nebel –
Entweiht in särgen liegen heilige bilder –
Daneben hingewühlt barbarenhöhlen…
Nur aufrecht steht noch mein geliebtes tor!
Im schwarzen flor der zeiten doch voll stolz
Wirft es aus hundert fenstern die verachtung
Auf eure schlechten hütten (reisst es ein
Was euch so dauernd höhnt!) auf eure menschen:
Die fürsten priester knechte gleicher art
Gedunsne larven mit erloschnen blicken
Und frauen die ein sklav zu feil befände –
Was gelten alle Dinge die ihr rühmet:
Das edelste ging euch verloren: blut…
Wir schatten atmen kräftiger! Lebendige
Gespenster! Lacht der knabe Manlius…
Er möchte über euch kein zepter schwingen
Der sich des niedrigsten erwerbs beflissen
Den ihr zu nennen scheut – ich ging gesalbt
Mit perserdüften um dies nächtige tor
Und gab mich preis den söldnern der Cäsaren!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
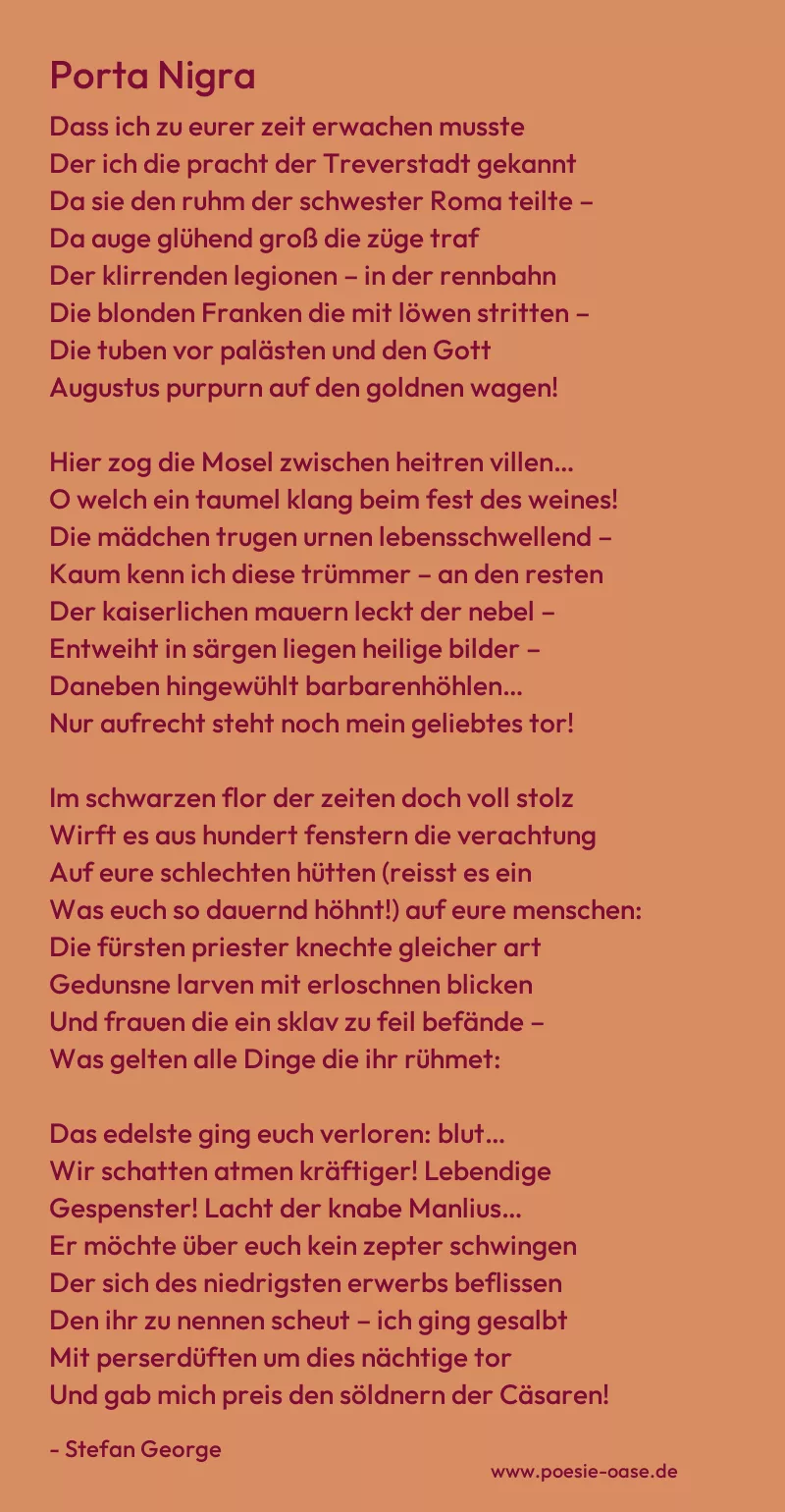
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Porta Nigra“ von Stefan George ist eine eindringliche Klage über den Niedergang der einst glanzvollen römischen Stadt Trier. Das lyrische Ich spricht mit der Stimme eines Geistes oder eines ehemaligen Bewohners aus der Zeit, als die Stadt noch im Glanz des Römischen Reiches stand. Es erinnert sich an eine Vergangenheit voller Pracht und Stärke: Die Legionen marschierten mit „glühenden“ Zügen, blonde Franken kämpften gegen Löwen in der Arena, Trompeten ertönten vor Palästen, und Augustus wurde in Purpur auf einem goldenen Wagen verehrt. Diese kraftvollen Bilder zeichnen ein leuchtendes, heroisches Bild der Vergangenheit.
Der Kontrast zur Gegenwart ist schockierend: Die Mosel fließt nun nicht mehr zwischen „heitren Villen“, sondern durch eine Stadt der Ruinen und Trümmer. Wo einst rauschende Feste stattfanden und lebensfrohe Mädchen mit vollen Urnen wandelten, sind nun nebelverhangene, verfallene Mauern, entweihte Gräber und „Barbarenhöhlen“. Doch eines trotzt dem Verfall: die Porta Nigra, das schwarze Tor, das als einziges Monument noch „aufrecht“ steht und symbolisch die einstige Größe bewahrt.
In der dritten Strophe steigert sich die Anklage des lyrischen Ichs gegen die gegenwärtige Menschheit. Die Porta Nigra blickt mit „Verachtung“ auf die „schlechten Hütten“ und die „gedunsnen Larven mit erloschnen Blicken“, die heutigen Bewohner, die im Vergleich zu den Römern degeneriert erscheinen. Selbst die „Fürsten, Priester, Knechte“ sind kaum voneinander zu unterscheiden – alle sind gleich in ihrer Bedeutungslosigkeit. Die Frauen sind so entwürdigt, dass selbst ein Sklave sie nicht begehren würde. Hier verdichtet sich Georges kulturpessimistische Sicht, die einen Verfall der einstigen römischen Größe beklagt.
Die letzte Strophe gipfelt in einer radikalen Aussage: Das wertvollste Gut, das „Blut“, ist verloren gegangen. Während die Schatten der Vergangenheit stärker atmen als die Lebenden, verspottet der Geist des jungen Manlius die gegenwärtige Welt. Er will nicht über sie herrschen, da selbst der niedrigste Beruf ihm würdevoller erscheint. Schließlich offenbart das lyrische Ich eine persönliche Verbindung zu dieser verlorenen Welt: Es bewegte sich einst, von persischen Düften gesalbt, durch die Straßen von Trier und gab sich den Söldnern Cäsars hin. Diese letzte Enthüllung zeigt eine intime, fast dekadente Verbundenheit mit der alten römischen Kultur und verstärkt die Wehmut über deren Untergang.
„Porta Nigra“ ist damit nicht nur eine Klage über den Verfall einer Stadt, sondern eine umfassende Kritik am Niedergang der Zivilisation, an einer Zeit, die ihrer einstigen Größe nicht mehr gerecht wird. George beschwört hier eine fast mythische Vergangenheit herauf und lässt das Gedicht in tiefer Verachtung für die Gegenwart enden.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.