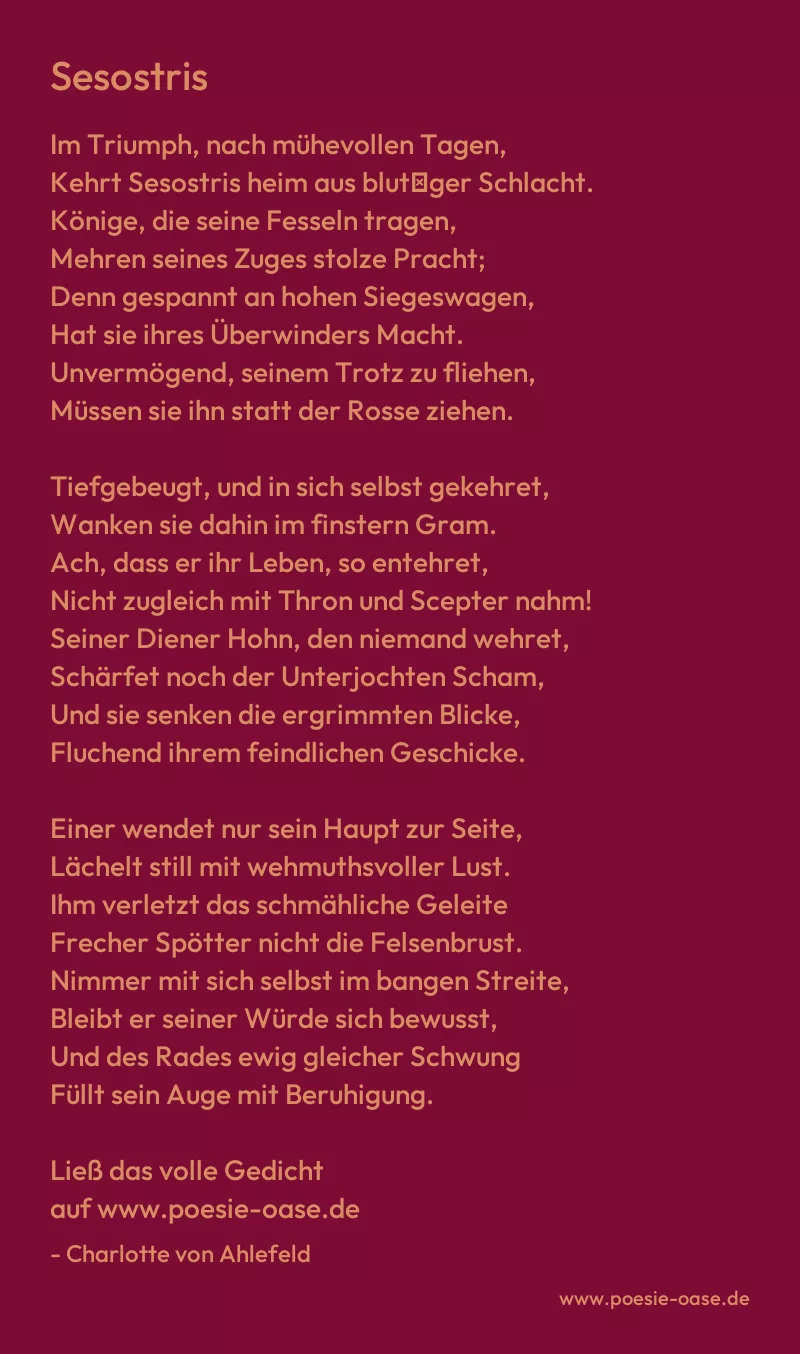Sesostris
Im Triumph, nach mühevollen Tagen,
Kehrt Sesostris heim aus blut′ger Schlacht.
Könige, die seine Fesseln tragen,
Mehren seines Zuges stolze Pracht;
Denn gespannt an hohen Siegeswagen,
Hat sie ihres Überwinders Macht.
Unvermögend, seinem Trotz zu fliehen,
Müssen sie ihn statt der Rosse ziehen.
Tiefgebeugt, und in sich selbst gekehret,
Wanken sie dahin im finstern Gram.
Ach, dass er ihr Leben, so entehret,
Nicht zugleich mit Thron und Scepter nahm!
Seiner Diener Hohn, den niemand wehret,
Schärfet noch der Unterjochten Scham,
Und sie senken die ergrimmten Blicke,
Fluchend ihrem feindlichen Geschicke.
Einer wendet nur sein Haupt zur Seite,
Lächelt still mit wehmuthsvoller Lust.
Ihm verletzt das schmähliche Geleite
Frecher Spötter nicht die Felsenbrust.
Nimmer mit sich selbst im bangen Streite,
Bleibt er seiner Würde sich bewusst,
Und des Rades ewig gleicher Schwung
Füllt sein Auge mit Beruhigung.
Und man hört Sesostris stolz ihn fragen:
Warum bleibt Dein Muth stets gleich und gross?
– Schmachvoll zieh ich Deinen Siegeswagen,
Spricht der König – Schande ist mein Loos.
Doch dies Rad hilft mir mein Elend tragen
Und erhält mich in der Hoffnung Schoos.
Gleich dem Glück hat mich sein Gang belehret,
Dass sich oben schnell nach unten kehret.
Da ergriffen schreckende Gewalten
Rauh den Sieger, der so trotzig war;
Und er lässt den Zug des Wagens halten
Und steigt ab. – Vor seiner Völkerschaar
Reichet er dem tiefgekränkten Alten
Seine Rechte zur Versöhnung dar.
Wohl vergänglich, spricht er, ist das Glück –
Darum nimm die Krone nun zurück!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
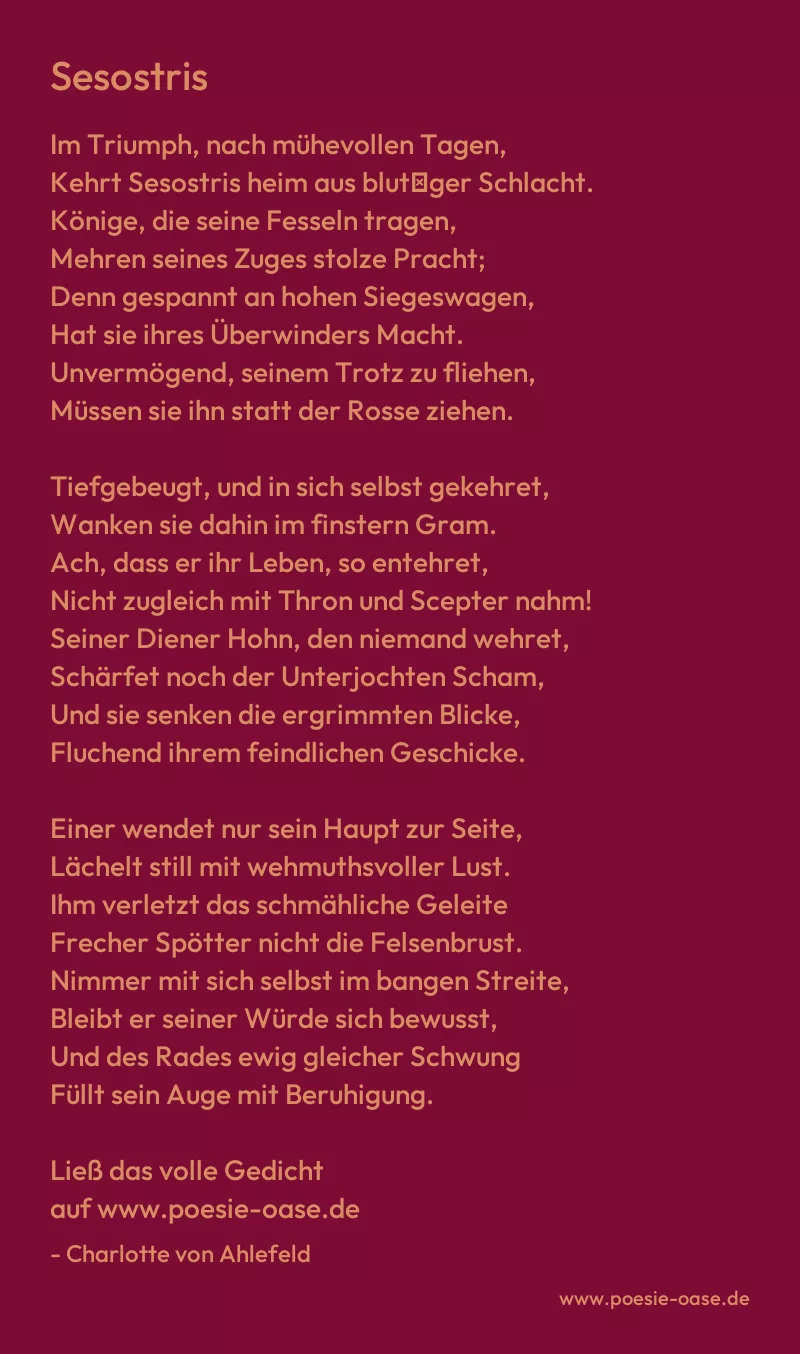
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Sesostris“ von Charlotte von Ahlefeld entfaltet in vier Strophen ein dramatisches Bild des Triumphes und der Demütigung, um eine tiefgründige Lehre über die Vergänglichkeit von Macht und die Bedeutung von innerer Stärke zu vermitteln. Die Szene ist die Rückkehr des siegreichen Pharaos Sesostris, der seine besiegten Gegner, Könige, als Zugtiere seines Wagens zwingt. Diese grausame Demütigung bildet den Rahmen für eine Auseinandersetzung zwischen dem Sieger und einem der Besiegten, die letztlich zu einer unerwarteten Wendung und der Erkenntnis über die wahre Natur des Glücks führt.
Die erste Strophe etabliert die Szenerie und die Ausgangssituation. Sesostris kehrt nach siegreichen Schlachten zurück, und die besiegten Könige werden in einer Demonstration ungezügelter Macht vorgeführt. Die Metapher der „Fesseln tragenden Könige“ unterstreicht die absolute Herrschaft des Pharaos und die Erniedrigung der einst Mächtigen. Die zweite Strophe vertieft das Bild der Demütigung. Die Könige, „tiefgebeugt und in sich selbst gekehret“, werden von Scham und Gram geplagt. Ihre Blicke sind gesenkt, und sie verfluchen ihr Schicksal. Diese Strophe verdeutlicht das Ausmaß der menschlichen Tragödie, die durch den Triumph des Sesostris ausgelöst wird.
In der dritten Strophe tritt jedoch eine überraschende Figur auf: Einer der Könige, der im Gegensatz zu den anderen keinen Gram zeigt, sondern „mit wehmuthsvoller Lust“ lächelt. Er scheint unberührt von der Schmach zu sein, da er sich seiner inneren Würde bewusst ist. Er erkennt in dem Kreisen des Rades eine Metapher für das Auf und Ab des Schicksals. Dieses Erkennen des ewigen Wandels und der Vergänglichkeit alles Irdischen verleiht ihm eine innere Freiheit und Stärke, die den Leser aufhorchen lässt.
Die vierte Strophe ist der Höhepunkt des Gedichts. Sesostris, beeindruckt von der standhaften Haltung des Königs, fragt nach dem Grund für dessen Gleichmut. Die Antwort des Königs offenbart eine tiefe Weisheit: Das Rad symbolisiert das Glück, das sich ständig wandelt. Diese Erkenntnis, dass Macht und Triumph ebenso vergänglich sind wie Niederlage und Leid, führt zu einer unerwarteten Reaktion des Sesostris. Er, überwältigt von dieser Erkenntnis, handelt unerwartet.
Am Ende des Gedichts wird die Macht des Siegers durch das Wissen über die Vergänglichkeit gebrochen. Er erkennt die Fehlerhaftigkeit seines Triumphes und gibt die Krone dem besiegten König zurück. Das Gedicht endet mit einer Versöhnung und der Einsicht in die wahre Natur des Glücks. Ahlefelds Werk ist somit eine tiefsinnige Reflexion über Macht, Demut, die Unbeständigkeit des Schicksals und die Bedeutung von innerer Stärke, die über äußere Umstände hinausgeht.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.