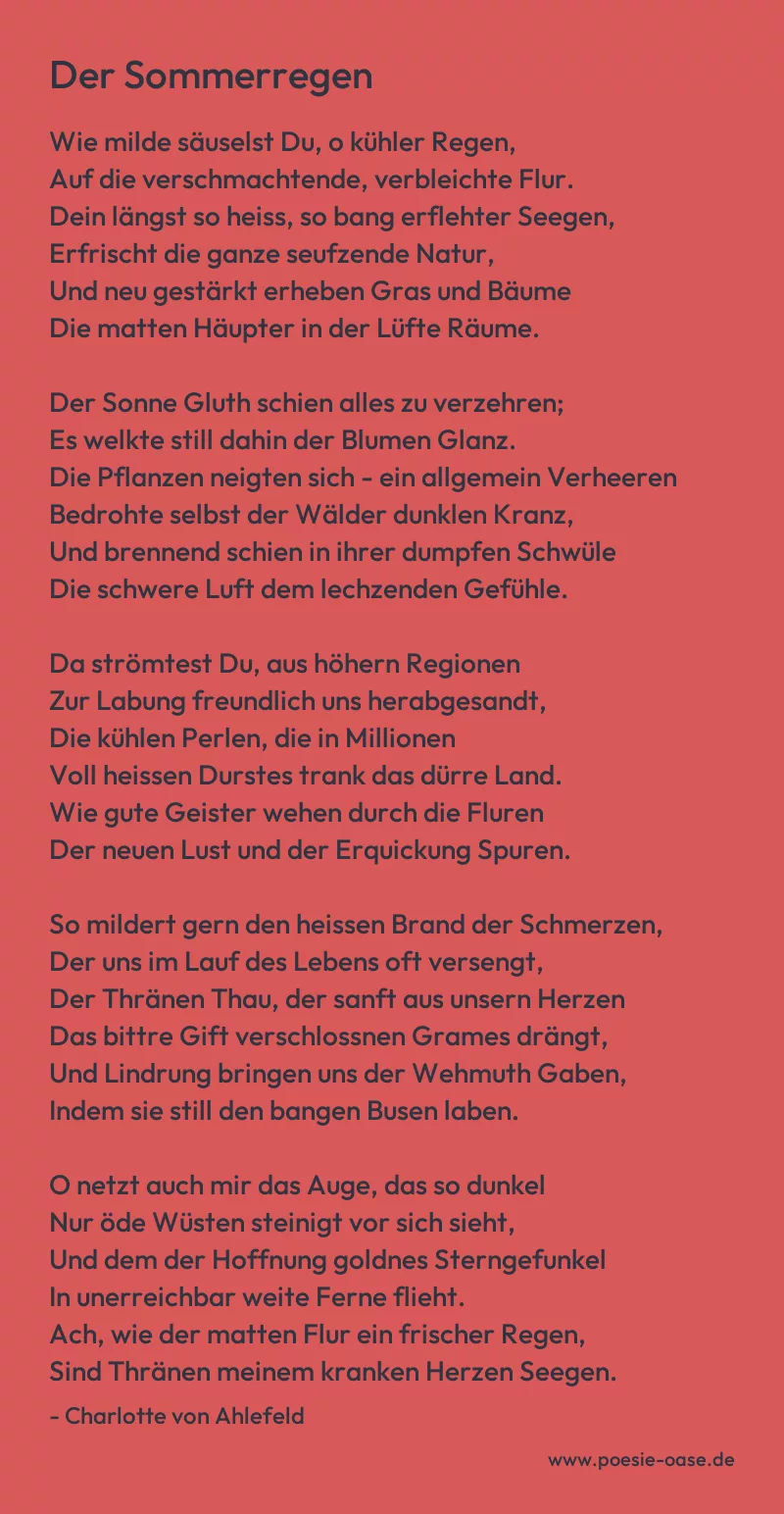Abenteuer & Reisen, Emotionen & Gefühle, Feiern, Freiheit & Sehnsucht, Gedanken, Geschichte & Kultur, Herbst, Herzschmerz, Länder, Leidenschaft, Liebe & Romantik, Natur, Sommer, Wälder & Bäume
Der Sommerregen
Wie milde säuselst Du, o kühler Regen,
Auf die verschmachtende, verbleichte Flur.
Dein längst so heiss, so bang erflehter Seegen,
Erfrischt die ganze seufzende Natur,
Und neu gestärkt erheben Gras und Bäume
Die matten Häupter in der Lüfte Räume.
Der Sonne Gluth schien alles zu verzehren;
Es welkte still dahin der Blumen Glanz.
Die Pflanzen neigten sich – ein allgemein Verheeren
Bedrohte selbst der Wälder dunklen Kranz,
Und brennend schien in ihrer dumpfen Schwüle
Die schwere Luft dem lechzenden Gefühle.
Da strömtest Du, aus höhern Regionen
Zur Labung freundlich uns herabgesandt,
Die kühlen Perlen, die in Millionen
Voll heissen Durstes trank das dürre Land.
Wie gute Geister wehen durch die Fluren
Der neuen Lust und der Erquickung Spuren.
So mildert gern den heissen Brand der Schmerzen,
Der uns im Lauf des Lebens oft versengt,
Der Thränen Thau, der sanft aus unsern Herzen
Das bittre Gift verschlossnen Grames drängt,
Und Lindrung bringen uns der Wehmuth Gaben,
Indem sie still den bangen Busen laben.
O netzt auch mir das Auge, das so dunkel
Nur öde Wüsten steinigt vor sich sieht,
Und dem der Hoffnung goldnes Sterngefunkel
In unerreichbar weite Ferne flieht.
Ach, wie der matten Flur ein frischer Regen,
Sind Thränen meinem kranken Herzen Seegen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
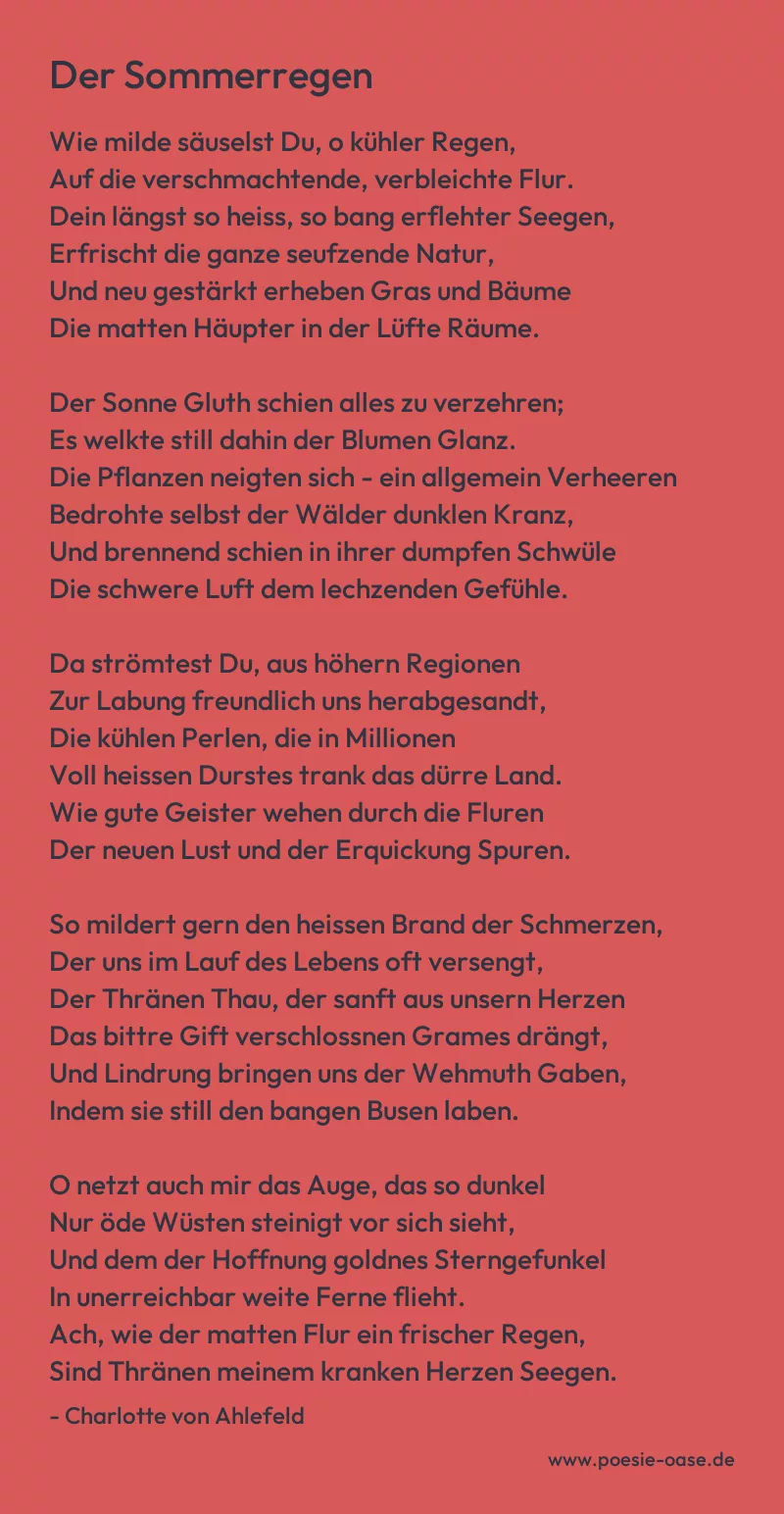
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Sommerregen“ von Charlotte von Ahlefeld ist eine lyrische Hommage an die erfrischende und lebensspendende Kraft des Regens, die sowohl die Natur als auch die menschliche Seele beleben kann. Das Gedicht beginnt mit der Anrede an den Regen, der als „kühler Regen“ beschrieben wird, der mild säuselt und die „verschmachtende, verbleichte Flur“ erfrischt. Hier wird direkt ein Bezug zwischen der äußeren Natur und dem inneren Zustand des lyrischen Ichs hergestellt, das sich nach der ersehnten Erfrischung sehnt. Der Regen wird als Segen gesehen, der die Natur neu belebt und die „seufzende Natur“ erquickt.
In den folgenden Strophen wird die Wirkung der Sonne, die als Gegenspieler des Regens fungiert, beschrieben. Die Sonne, die „Gluth“ zu verzehren scheint, lässt Blumen welken und Pflanzen sich neigen. Die „allgemeine Verheeren“ bedroht sogar die Wälder. Die schwere, dumpfe Luft wird als unerträglich für das „lechzende Gefühl“ empfunden. Durch diesen Kontrast wird die wohltuende Wirkung des Regens umso deutlicher hervorgehoben. Der Regen, der aus „höheren Regionen“ herabgesandt wird, wird als wohltuende Gabe empfangen, die in „Millionen“ Tropfen das dürre Land tränkt und so neue Lust und Erquickung bringt.
Die letzte Strophe des Gedichts leitet über zur Übertragung der Regenmetapher auf die menschliche Erfahrung. Hier wird der Regen mit den Tränen verglichen, die den „heissen Brand der Schmerzen“ lindern und das „bittre Gift verschlossnen Grames“ aus dem Herzen drängen. Die Tränen werden als „Gaben“ der Wehmut gesehen, die den „bangen Busen“ laben. Das lyrische Ich bittet den Regen, auch sein Auge zu netzen, das nur „öde Wüsten“ sieht und für das die Hoffnung in unerreichbarer Ferne liegt. Abschließend werden die Tränen als „Segen“ für das „kranke Herzen“ des lyrischen Ichs bezeichnet.
Die zentrale Metapher des Gedichts ist die Analogie zwischen dem Sommerregen und den Tränen. Beides sind reinigende, erfrischende und lebensspendende Kräfte, die sowohl die äußere Natur als auch die menschliche Seele von Leid und Schmerz befreien können. Ahlefeld nutzt eine einfache, aber eindringliche Sprache und klare Bilder, um die wohltuende Wirkung des Regens und der Tränen zu beschreiben. Das Gedicht spiegelt eine romantische Sehnsucht nach Erneuerung, Trost und der Hoffnung auf Linderung wider und bietet eine tröstliche Botschaft angesichts von Leid und Verzweiflung. Das Gedicht zeigt eine schöne Verbindung zwischen Natur und Seele auf.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.