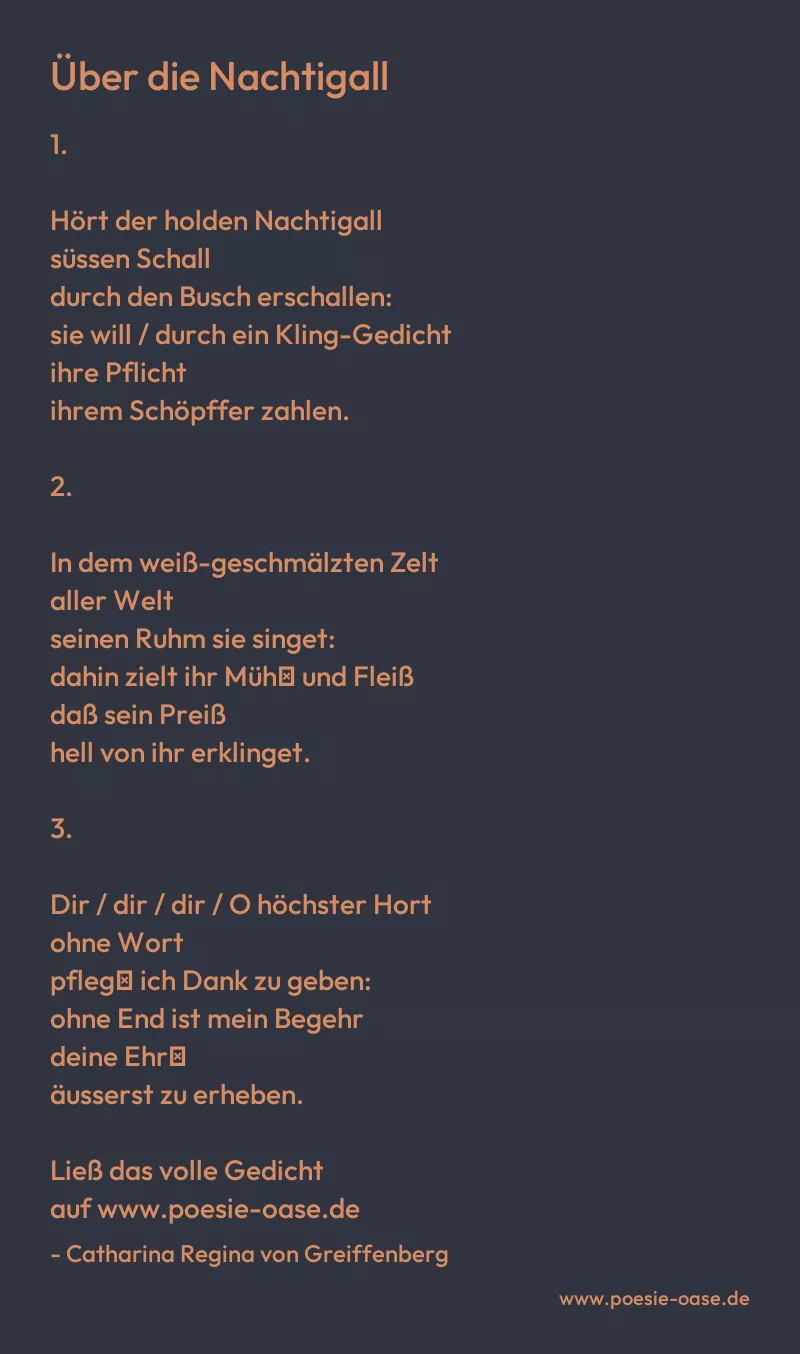Über die Nachtigall
1.
Hört der holden Nachtigall
süssen Schall
durch den Busch erschallen:
sie will / durch ein Kling-Gedicht
ihre Pflicht
ihrem Schöpffer zahlen.
2.
In dem weiß-geschmälzten Zelt
aller Welt
seinen Ruhm sie singet:
dahin zielt ihr Müh′ und Fleiß
daß sein Preiß
hell von ihr erklinget.
3.
Dir / dir / dir / O höchster Hort
ohne Wort
pfleg′ ich Dank zu geben:
ohne End ist mein Begehr
deine Ehr′
äusserst zu erheben.
4.
Jede Feder fordert Lob
ist ein Prob
deiner milden Güte.
Gib / so offt ich sie aufschwing
daß erkling
Dank aus dem Gemüte.
5.
Jedes Würmlein / das ich iss
ist gewiß
deiner Schickung Gabe.
Nimm / Erhalter / vor die Speiß
diesen Preiß
und mich ferner labe!
6.
Dir sey Lob vor diesen Ast
wo ich rast:
doch nit / dich zu loben.
Nein! dein Ruhm wird für und für
dort und hier
hoch von mir erhoben.
7.
Du hast / schöne Singerin
meinen Sinn
auch in was ermundert.
Nur von Gottes Gnad sing ich
weil ich mich
ganz in sie verwundert.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
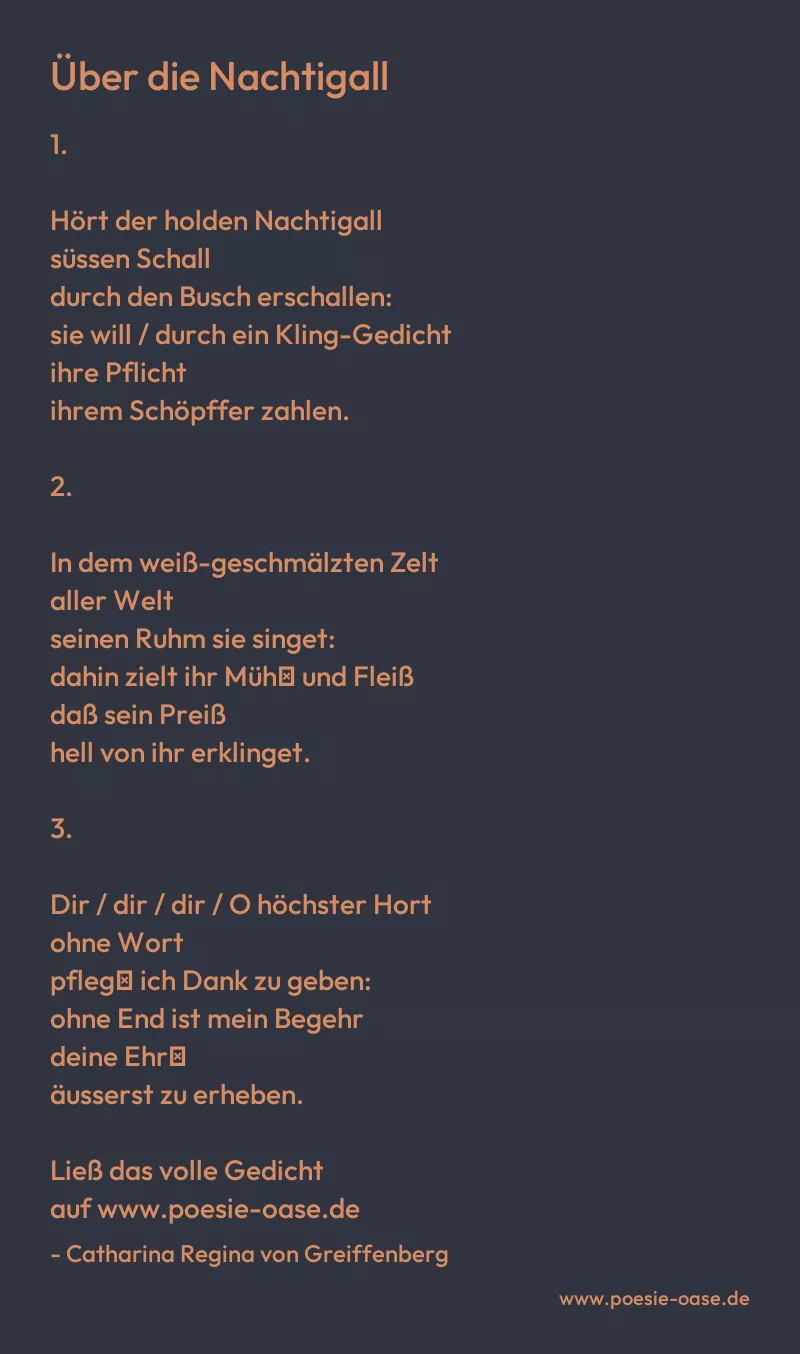
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Über die Nachtigall“ von Catharina Regina von Greiffenberg ist eine Lobpreisung Gottes, die durch die Metapher der Nachtigall als Sängerin erfolgt. Das Gedicht ist in sieben Strophen unterteilt, die jeweils die Dankbarkeit und Bewunderung des lyrischen Ichs für Gottes Schöpfung und Gnade zum Ausdruck bringen. Die Nachtigall, die in der Natur als Inbegriff des melodischen Gesangs gilt, wird hier als Symbol für die menschliche Seele verwendet, die Gottes Lob singt.
In den ersten beiden Strophen wird die Szene gesetzt: Die Nachtigall lässt ihren „süssen Schall“ im Gebüsch erklingen und widmet ihre Lieder ihrem Schöpfer. Der Gesang der Nachtigall wird als ein „Kling-Gedicht“ bezeichnet, was die Verbindung von Musik und Dichtung, von Natur und Kunst betont. Die Nachtigall sieht ihren Gesang als eine Pflicht, als einen Tribut an Gott für seine Herrlichkeit. Der Gesang dient dazu, Gottes Ruhm in der Welt widerzuspiegeln. Die Verse betonen die Erschaffung, die Schönheit und die Anbetung.
Die folgenden Strophen vertiefen die Beziehung zwischen der Nachtigall und Gott. Das lyrische Ich spricht Gott direkt an („Dir / dir / dir“), drückt Dankbarkeit aus („pfleg‘ ich Dank zu geben“) und bekundet das unendliche Verlangen, Gottes Ehre zu erhöhen. Jedes Detail der Nachtigall – jede Feder, das gefundene Würmchen, der Rastplatz – wird als Gabe Gottes wahrgenommen und als Anlass für Dankbarkeit und Lobpreisung genutzt. Die Verwendung des Wortes „Gabe“ und die Betonung der Dankbarkeit unterstreichen die Demut des lyrischen Ichs und die Anerkennung der Allgegenwart Gottes in der Natur.
In der sechsten und siebten Strophe findet die Verehrung ihren Höhepunkt. Die Nachtigall ist sich der Schönheit ihrer Umgebung bewusst („Dir sey Lob vor diesen Ast“), lobt aber nicht nur die Schöpfung, sondern vor allem den Schöpfer. Der Gesang der Nachtigall wird als ein Ausdruck der von Gott empfangenen Gnade gedeutet. Der Vers „Nur von Gottes Gnad sing ich, weil ich mich ganz in sie verwundert“ verdeutlicht die tiefe Verwunderung und Ehrfurcht des lyrischen Ichs vor der göttlichen Gnade, die es befähigt, zu singen und Gott zu preisen. Das Gedicht endet mit einer tiefen Ehrfurcht und der Erkenntnis, dass alles, was die Nachtigall tut und erlebt, von Gottes Gnade getragen ist.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.