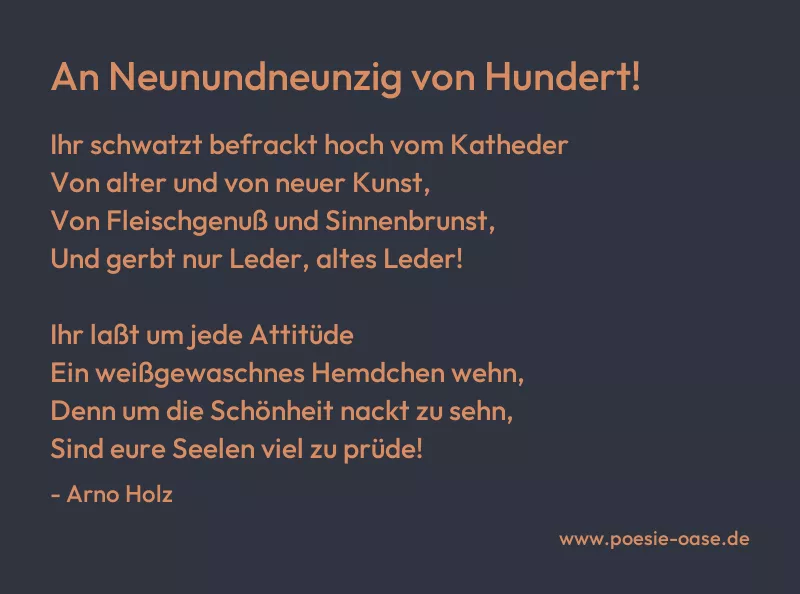An Neunundneunzig von Hundert!
Ihr schwatzt befrackt hoch vom Katheder
Von alter und von neuer Kunst,
Von Fleischgenuß und Sinnenbrunst,
Und gerbt nur Leder, altes Leder!
Ihr laßt um jede Attitüde
Ein weißgewaschnes Hemdchen wehn,
Denn um die Schönheit nackt zu sehn,
Sind eure Seelen viel zu prüde!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
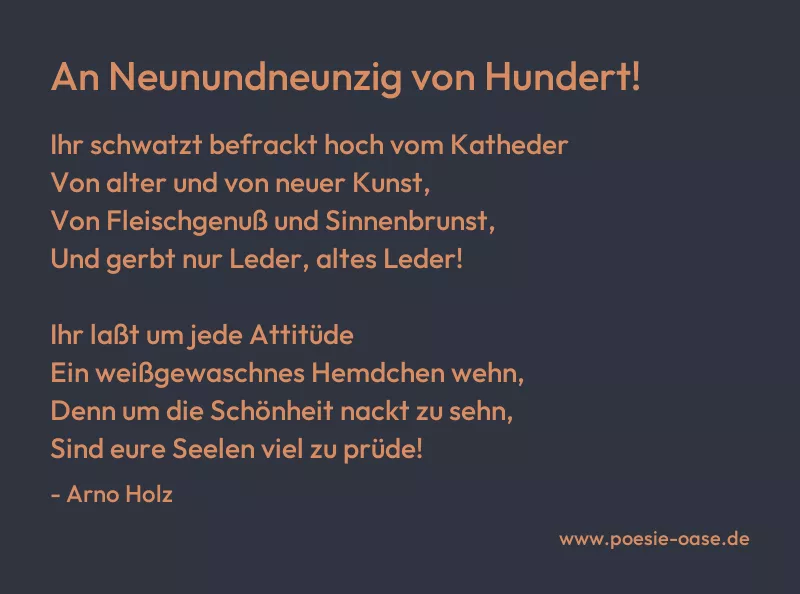
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An Neunundneunzig von Hundert!“ von Arno Holz ist eine scharfe und satirische Kritik an der Kunst- und Geisteswelt seiner Zeit. Das Gedicht richtet sich an eine Mehrheit von „Neunundneunzig von Hundert“, die, wie der Titel bereits andeutet, als repräsentativ für eine konventionelle, verknöcherte und ihrer Ansicht nach unechte künstlerische und intellektuelle Elite steht. Holz verwendet dabei eine bissige Sprache und deutliche Bilder, um seine Ablehnung auszudrücken.
Die ersten vier Zeilen beschreiben die „Neunundneunzig“ als Personen, die „befrackt hoch vom Katheder“ von Kunst und Genuss sprechen, aber letztendlich nichts weiter als „Leder, altes Leder“ gerben. Dies impliziert eine fehlende Substanz und Echtheit in ihren Reden. Sie sind oberflächlich, sprechen über Themen, die sie nicht wirklich verstehen oder fühlen, und produzieren nichts Wertvolles. Der „Fleischgenuss und Sinnenbrunst“ wird zwar erwähnt, aber gleichzeitig in Frage gestellt, was auf eine Heuchelei oder eine fehlende Fähigkeit, diese Aspekte des Lebens wahrhaftig zu erleben, hindeutet.
Die zweite Strophe verschärft die Kritik. Hier wird die prüde Haltung der Angegriffenen betont: Sie verbergen sich hinter formalen, „weißgewaschnes Hemdchen“, wodurch die „Schönheit nackt zu sehn“ unmöglich wird. Dies deutet auf eine fehlende Offenheit gegenüber der Natur, der Sinnlichkeit und der Kunst hin. Holz kritisiert somit nicht nur die intellektuelle Leere, sondern auch die Prüderie und die Unfähigkeit, die Welt mit all ihren Facetten zu erfassen und künstlerisch zu verarbeiten. Die „Attitüde“ ist das, was diese Leute kultivieren, anstatt echtes Verständnis und Erleben.
Das Gedicht ist ein Beispiel für die Kritik am etablierten Kunstbetrieb und den vorherrschenden moralischen Vorstellungen der Zeit. Holz, ein Vertreter des Naturalismus, lehnt die bürgerliche Moralvorstellung ab, die die Natur verleugnet. Seine scharfe, rhetorische Frage verdeutlicht die Diskrepanz zwischen dem, was die Kritisierten vorgeben, und dem, was sie tatsächlich verkörpern oder leisten. Die Einfachheit des Reims und die prägnanten Bilder verstärken die Wirkung der Kritik und machen das Gedicht zu einer wirkungsvollen Abrechnung mit dem etablierten Kunstbetrieb.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.