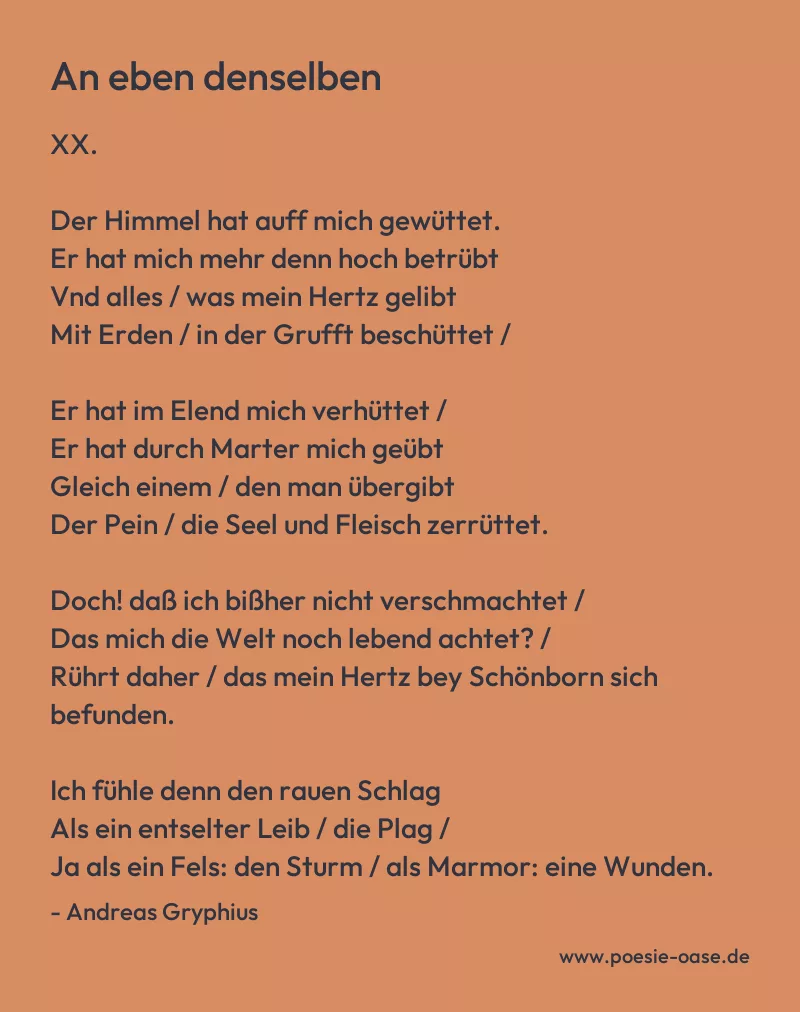An eben denselben
XX.
Der Himmel hat auff mich gewüttet.
Er hat mich mehr denn hoch betrübt
Vnd alles / was mein Hertz gelibt
Mit Erden / in der Grufft beschüttet /
Er hat im Elend mich verhüttet /
Er hat durch Marter mich geübt
Gleich einem / den man übergibt
Der Pein / die Seel und Fleisch zerrüttet.
Doch! daß ich bißher nicht verschmachtet /
Das mich die Welt noch lebend achtet? /
Rührt daher / das mein Hertz bey Schönborn sich befunden.
Ich fühle denn den rauen Schlag
Als ein entselter Leib / die Plag /
Ja als ein Fels: den Sturm / als Marmor: eine Wunden.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
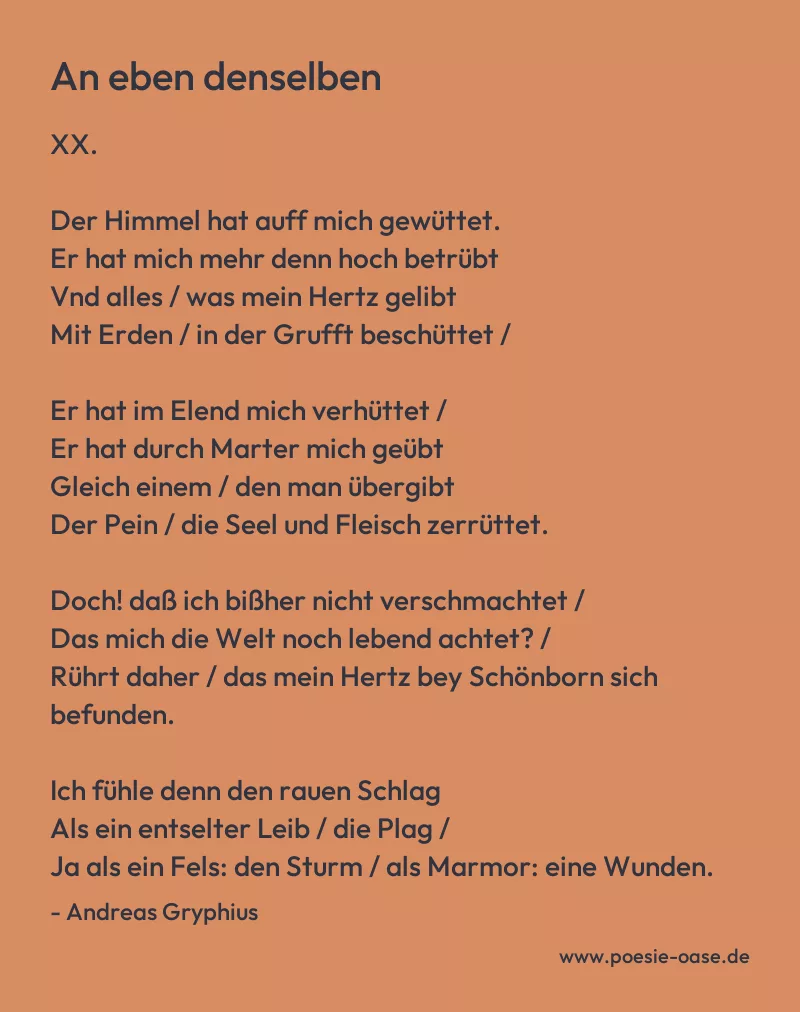
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An eben denselben“ von Andreas Gryphius ist ein Ausdruck tiefen Leids und gleichzeitiger Stärke, der durch die Erfahrung persönlicher und möglicherweise auch politischer Katastrophen geprägt ist. Es offenbart einen Menschen, der von Schicksalsschlägen heimgesucht wurde und dennoch versucht, seine Würde und seinen Glauben zu bewahren. Die ersten acht Zeilen beschreiben eindrücklich das Ausmaß des erlittenen Unglücks: Der Himmel, also Gott, wird als Urheber des Leids dargestellt, der den Sprecher „betrübt“ und ihm alles, was er liebte, entrissen hat. Diese Zeilen sind von düsterer Melancholie und dem Gefühl des Verlustes geprägt, was die Schwere des erlebten Schmerzes verdeutlicht.
Der zweite Teil des Gedichts, beginnend mit der Zeile „Doch! daß ich bißher nicht verschmachtet“, enthüllt die Quelle der Stärke des Sprechers. Die Nennung von „Schönborn“ impliziert eine persönliche Bezugsperson, möglicherweise eine geliebte Person oder eine Quelle der Hoffnung und des Trostes. Diese Person scheint eine zentrale Rolle dabei zu spielen, dass der Sprecher nicht an den erlittenen Leiden zerbricht. Die Formulierung „mein Hertz bey Schönborn sich befunden“ deutet auf eine tiefe emotionale Bindung hin, die dem Sprecher Halt gibt. Dies ist ein zentraler Punkt der Interpretation, da er die Quelle des Überlebens in den Mittelpunkt rückt.
Die letzten drei Zeilen des Gedichts greifen auf Vergleiche aus der Natur zurück, um die innere Stärke des Sprechers zu veranschaulichen. Er nimmt die „rauen Schlag“ wahr, erfährt aber die Plage, wie ein „entselter Leib“ und wird zu einem Fels im Sturm. Diese Metaphern unterstreichen die Fähigkeit, äußeren Widerständen zu trotzen. Durch die Metapher des Marmors und der Wunden wird die Fähigkeit des Sprechers zur Distanzierung und zur Verarbeitung von Schmerz gezeigt. Er scheint in der Lage zu sein, das Leid zu akzeptieren, ohne daran zu zerbrechen.
Insgesamt ist „An eben denselben“ ein Gedicht, das die Zerrissenheit des Menschen zwischen Schmerz und Stärke, Verlust und Hoffnung thematisiert. Gryphius verdeutlicht die schmerzlichen Erfahrungen, aber gleichzeitig auch die Kraft der menschlichen Seele, die in der Lage ist, Widrigkeiten zu überstehen. Die Bezugnahme auf „Schönborn“ als Quelle der Stärke und die Verwendung kraftvoller Naturmetaphern zur Darstellung der inneren Haltung machen dieses Gedicht zu einem eindringlichen Zeugnis menschlicher Widerstandsfähigkeit.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.