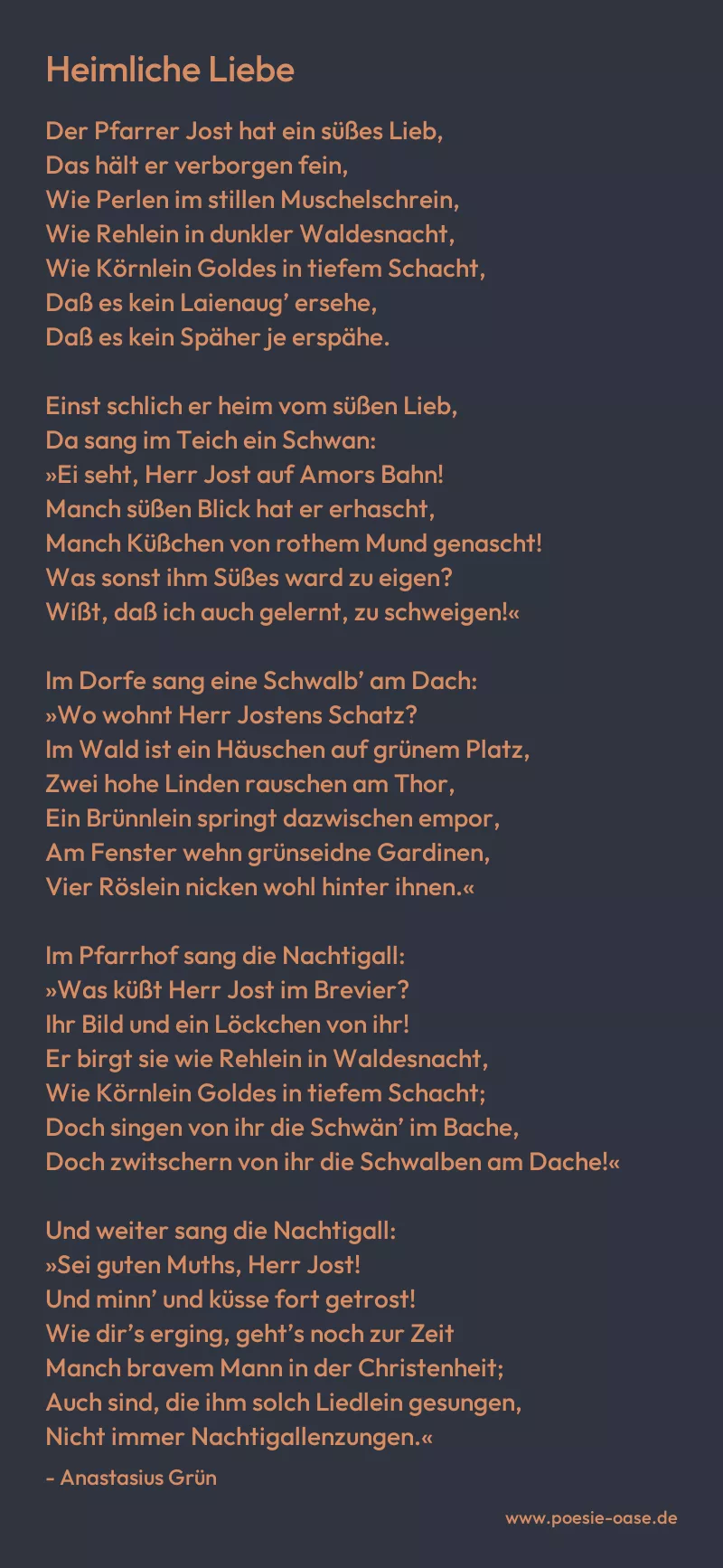Heimliche Liebe
Der Pfarrer Jost hat ein süßes Lieb,
Das hält er verborgen fein,
Wie Perlen im stillen Muschelschrein,
Wie Rehlein in dunkler Waldesnacht,
Wie Körnlein Goldes in tiefem Schacht,
Daß es kein Laienaug’ ersehe,
Daß es kein Späher je erspähe.
Einst schlich er heim vom süßen Lieb,
Da sang im Teich ein Schwan:
»Ei seht, Herr Jost auf Amors Bahn!
Manch süßen Blick hat er erhascht,
Manch Küßchen von rothem Mund genascht!
Was sonst ihm Süßes ward zu eigen?
Wißt, daß ich auch gelernt, zu schweigen!«
Im Dorfe sang eine Schwalb’ am Dach:
»Wo wohnt Herr Jostens Schatz?
Im Wald ist ein Häuschen auf grünem Platz,
Zwei hohe Linden rauschen am Thor,
Ein Brünnlein springt dazwischen empor,
Am Fenster wehn grünseidne Gardinen,
Vier Röslein nicken wohl hinter ihnen.«
Im Pfarrhof sang die Nachtigall:
»Was küßt Herr Jost im Brevier?
Ihr Bild und ein Löckchen von ihr!
Er birgt sie wie Rehlein in Waldesnacht,
Wie Körnlein Goldes in tiefem Schacht;
Doch singen von ihr die Schwän’ im Bache,
Doch zwitschern von ihr die Schwalben am Dache!«
Und weiter sang die Nachtigall:
»Sei guten Muths, Herr Jost!
Und minn’ und küsse fort getrost!
Wie dir’s erging, geht’s noch zur Zeit
Manch bravem Mann in der Christenheit;
Auch sind, die ihm solch Liedlein gesungen,
Nicht immer Nachtigallenzungen.«
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
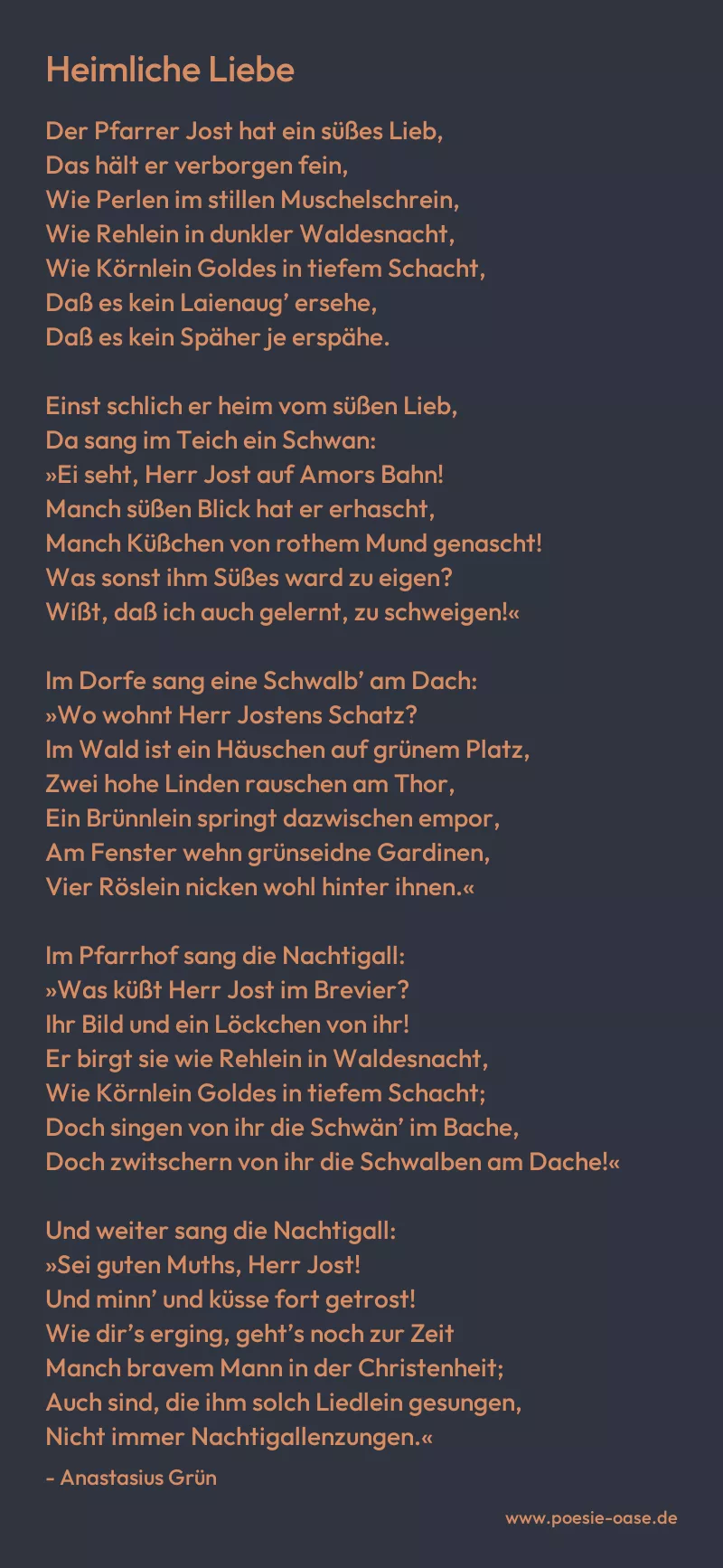
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Heimliche Liebe“ von Anastasius Grün beschreibt auf humorvolle und leicht ironische Weise die geheime Liebe eines Pfarrers namens Jost und die Art und Weise, wie diese trotz aller Heimlichkeit durch die Natur, in Form von Tieren, an die Öffentlichkeit getragen wird. Das Gedicht nutzt eine Reihe von Vergleichen, um die Verborgenheit der Liebe zu betonen und gleichzeitig die Unvermeidlichkeit ihrer Entdeckung aufzuzeigen. Die Verwendung von Bildern aus der Natur, wie Perlen, Rehen, Goldkörnern und dem Waldesnacht, unterstreicht die Kostbarkeit und das Verborgensein der Liebe, während die Tiere (Schwan, Schwalbe, Nachtigall) als unaufhaltsame Überbringer der Nachricht fungieren.
Der Aufbau des Gedichts ist strukturiert durch die sich wiederholende Beschreibung der Heimlichkeit zu Beginn und die anschließende Enthüllung durch die Tiere. Jeder Abschnitt enthält ein neues Detail oder eine neue Perspektive auf die geheime Beziehung, wobei die Tiere als Beobachter und Kommentatoren der Geschehnisse dienen. Der Schwan, die Schwalbe und die Nachtigall haben jeweils ihre eigene Art und Weise, die Liebe des Pfarrers aufzudecken, sei es durch direkte Andeutungen, durch die Beschreibung des Ortes, an dem die Geliebte wohnt, oder durch das Aufdecken von Intimitäten wie einem Bild und einer Haarsträhne im Gebetbuch.
Die Ironie des Gedichts liegt in dem Kontrast zwischen dem frommen Beruf des Pfarrers und seiner menschlichen Sehnsucht nach Liebe und Zuneigung. Jost versucht, seine Liebe zu verbergen, wie ein kostbares Geheimnis, doch die Natur und ihre Geschöpfe scheinen eine Art von moralischer Autorität zu haben, die es unmöglich macht, die Wahrheit zu verschweigen. Die letzte Strophe fügt eine weitere Ebene der Ironie hinzu, indem sie die allgemeine Natur menschlicher Erfahrungen hervorhebt, wo andere Menschen ebenfalls versucht haben, die Geheimnisse der Liebe zu teilen und damit die Ironie der Situation unterstreicht und die Verallgemeinerung des Themas zeigt.
Die Verwendung von Reimen und einem einfachen, volksliedhaften Stil trägt zur Zugänglichkeit und zum Unterhaltungswert des Gedichts bei. Die leichten, fröhlichen Verse stehen im Kontrast zu der eigentlich ernsthaften Thematik der verborgenen Liebe, was den humorvollen Unterton des Gedichts noch verstärkt. Das Gedicht lädt den Leser ein, über die Widersprüche des menschlichen Verhaltens zu schmunzeln und die Unvermeidlichkeit der menschlichen Erfahrung zu erkennen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.