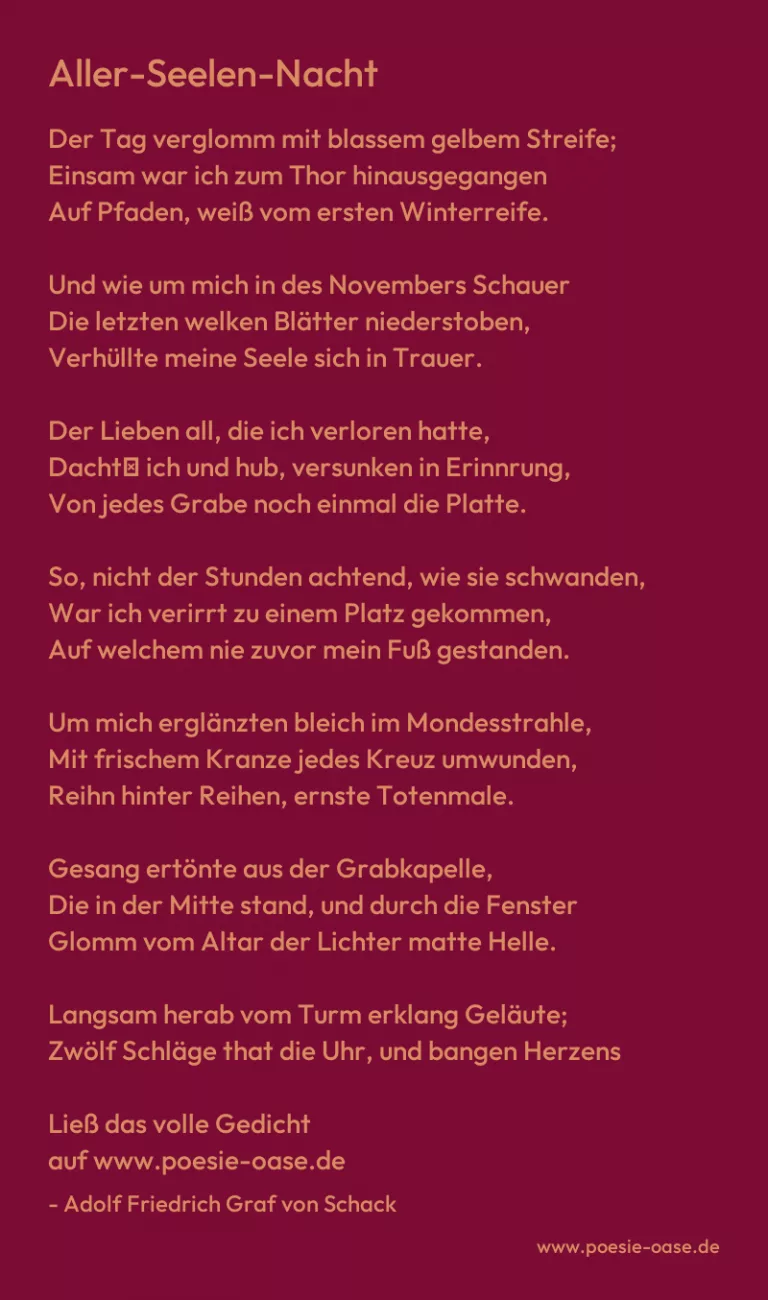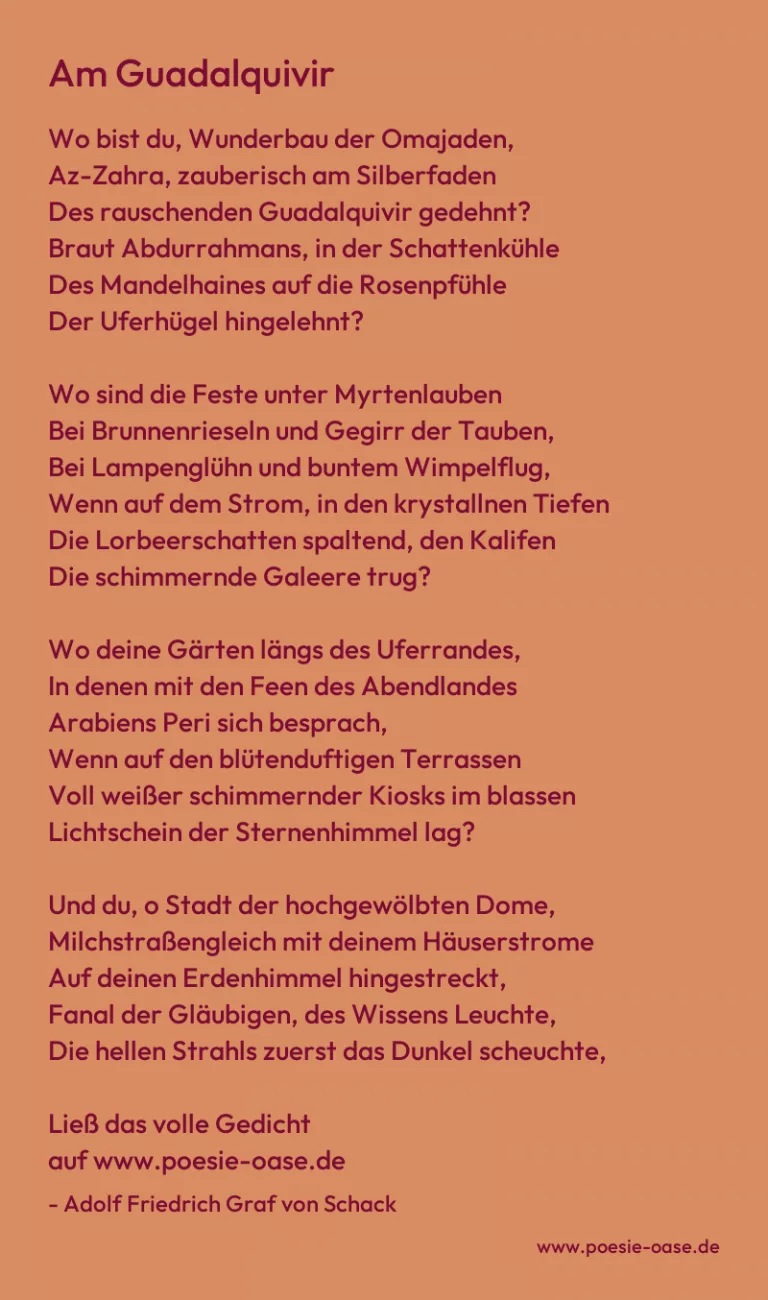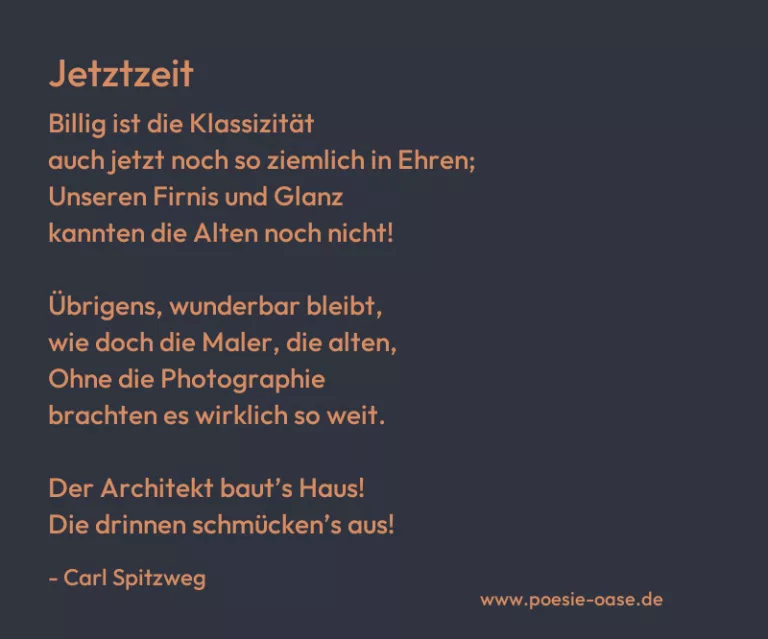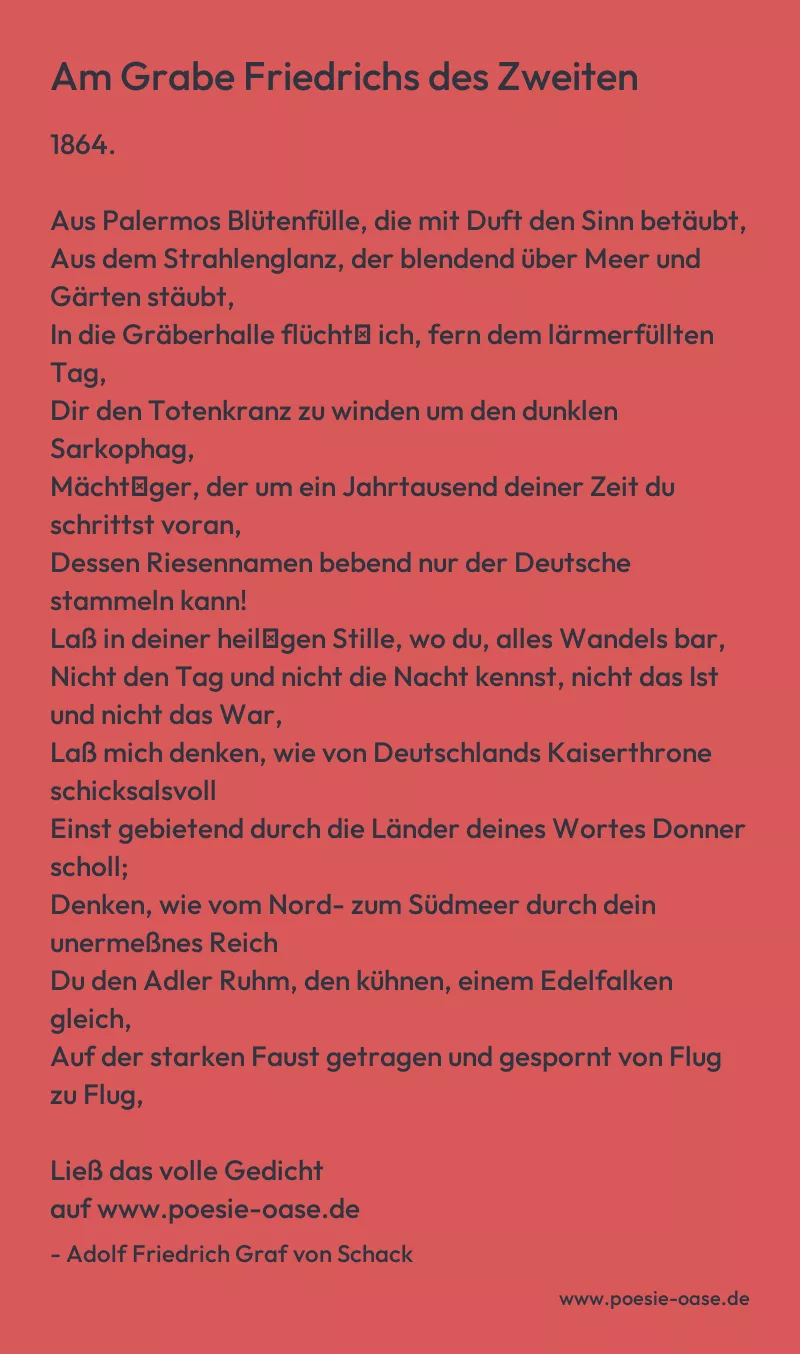1864.
Aus Palermos Blütenfülle, die mit Duft den Sinn betäubt,
Aus dem Strahlenglanz, der blendend über Meer und Gärten stäubt,
In die Gräberhalle flücht′ ich, fern dem lärmerfüllten Tag,
Dir den Totenkranz zu winden um den dunklen Sarkophag,
Mächt′ger, der um ein Jahrtausend deiner Zeit du schrittst voran,
Dessen Riesennamen bebend nur der Deutsche stammeln kann!
Laß in deiner heil′gen Stille, wo du, alles Wandels bar,
Nicht den Tag und nicht die Nacht kennst, nicht das Ist und nicht das War,
Laß mich denken, wie von Deutschlands Kaiserthrone schicksalsvoll
Einst gebietend durch die Länder deines Wortes Donner scholl;
Denken, wie vom Nord- zum Südmeer durch dein unermeßnes Reich
Du den Adler Ruhm, den kühnen, einem Edelfalken gleich,
Auf der starken Faust getragen und gespornt von Flug zu Flug,
Bis die Schwinge, alles wagend, ihn in Sonnenferne trug!
Um dich her mit Schild und Lanze, als ein eisenfester Wall,
Reihten sich die Erdenfürsten, jeder deines Throns Vasall,
Und, das Werk der Nacht zerstörend, für des Priesters Bannfluch taub,
Tratst du, die ihn dreifach krönte, die Tiara in den Staub,
Während an dein eh′rnes Deutschland du das sonn′ge Morgenland
Und des Südens heitre Küsten bandest mit gewalt′ger Hand. –
Aber weh! die hehren Bilder, wer verhüllt sie meinem Blick?
Neuen, immer neuen Wechsel bringt das rollende Geschick,
Und durch siebenhundert Jahre seh′ ich wie im Traumgesicht
Finstrer stets den Himmel kreisen mit erloschnem Sternenlicht,
Seh′ dein Reich in Trümmer sinken, daß, zerbröckelt und zernagt,
Selten noch ein halbgebrochner Pfeiler aus dem Schutte ragt;
Weithin geht durch seine Zinnen, seinen Wall der Riß hindurch,
Und am Boden liegt die starke, liegt die heil′ge Völkerburg.
Trauernd über deinem Lande hat der Genius sich verhüllt;
Von den eignen Söhnen wurde seiner Schande Maß erfüllt;
Seine Lenker in Verblendung denken nicht der Zeit, die war,
Als sich herrschend über alle schwang der doppelhäupt′ge Aar,
Nicht sein Volk, daß ihm der Kaiser, was dem Schiffer der Pilot;
Ohne ihn auf stürm′schem Meere sinkt es selbst im lecken Boot.
Nun verzagend stehn sie alle, da der Boden kracht und wankt;
Wilder tobt um sie die Woge, und der Kompaß trügt und schwankt;
Doch vergebens rollt der Donner mahnend über ihrem Haupt;
In den jähen Abgrund stürzen sie sich selber sinnberaubt.
So dein Land, erhabner Kaiser! Morsch ist alles drinn und hohl;
In der Zeiten Wirbelströmen treibt es ohne Stern und Pol.
Wohl dir, daß dein Auge nimmer schaut dies deutsche Jammerbild!
Möge Trauerflor umhüllen dein berühmtes Wappenschild!
Um dich her im Traume magst du deine Heldensöhne stehn
Und die Schatten der vergangnen großen Tage gleiten sehn;
Doch kein Laut des Lebens dringe, Herrlicher, zu dir herab,
Als das Rauschen deiner Fahnen, wie sie wehen um dein Grab.