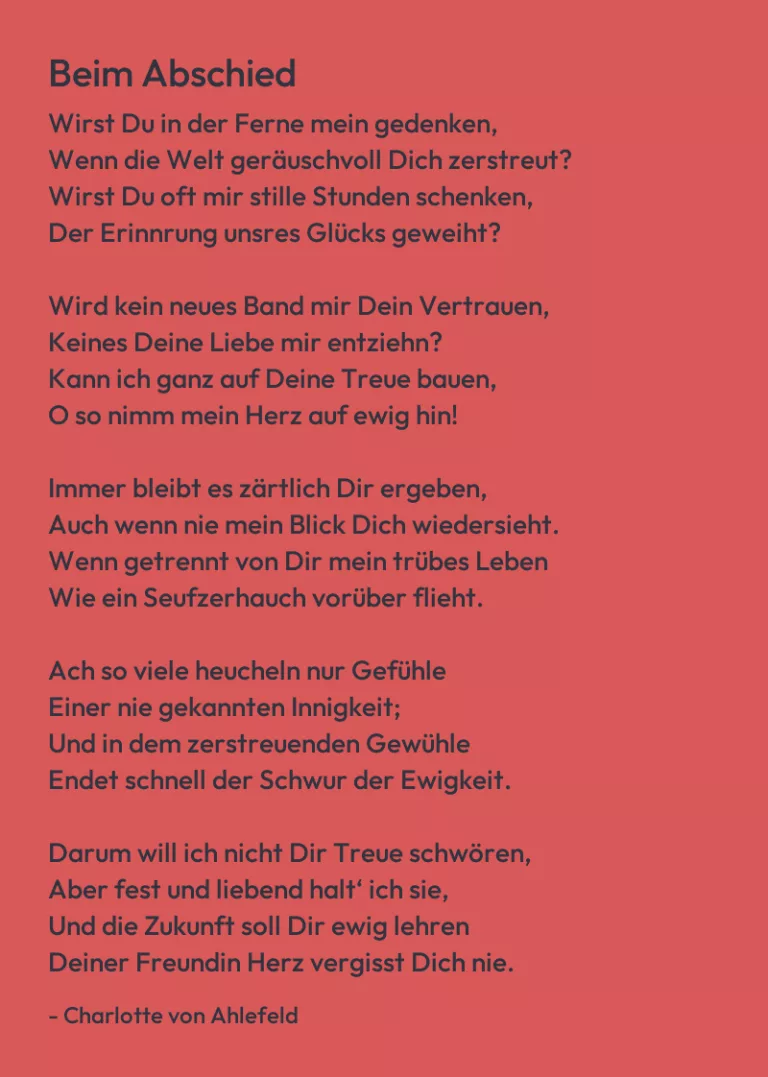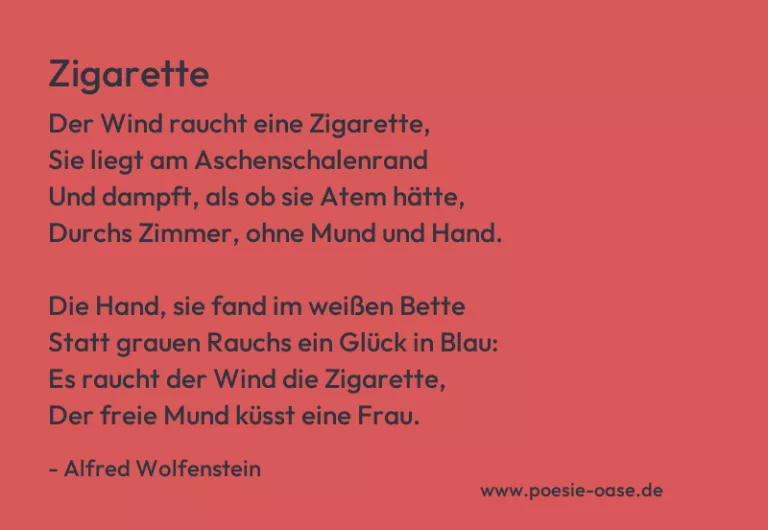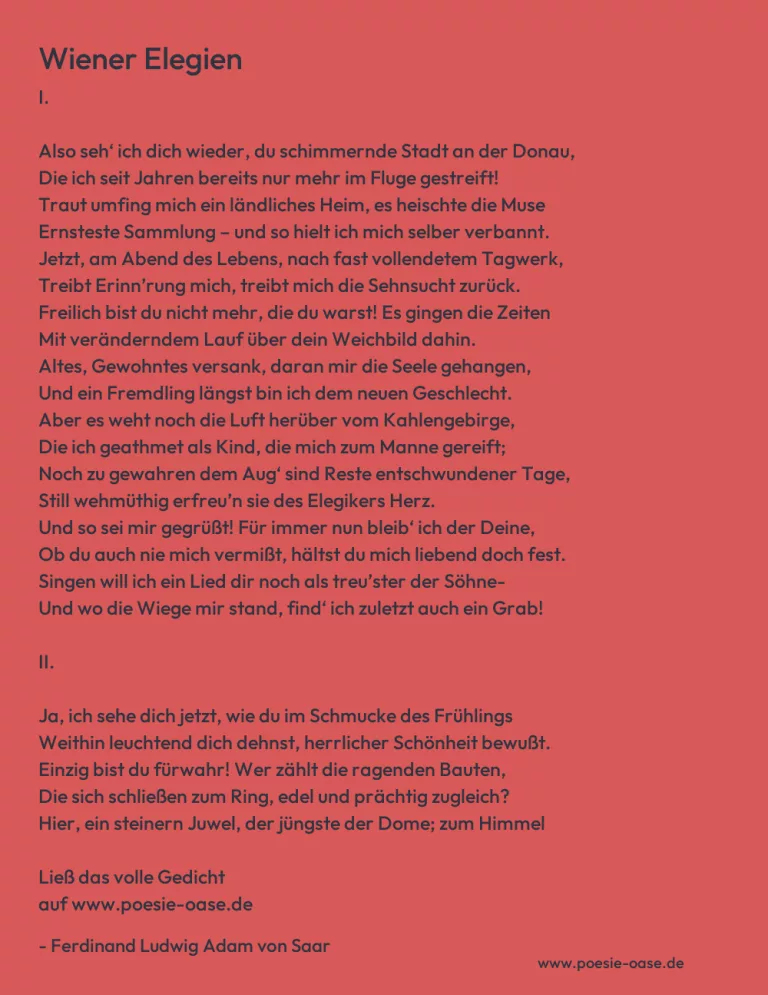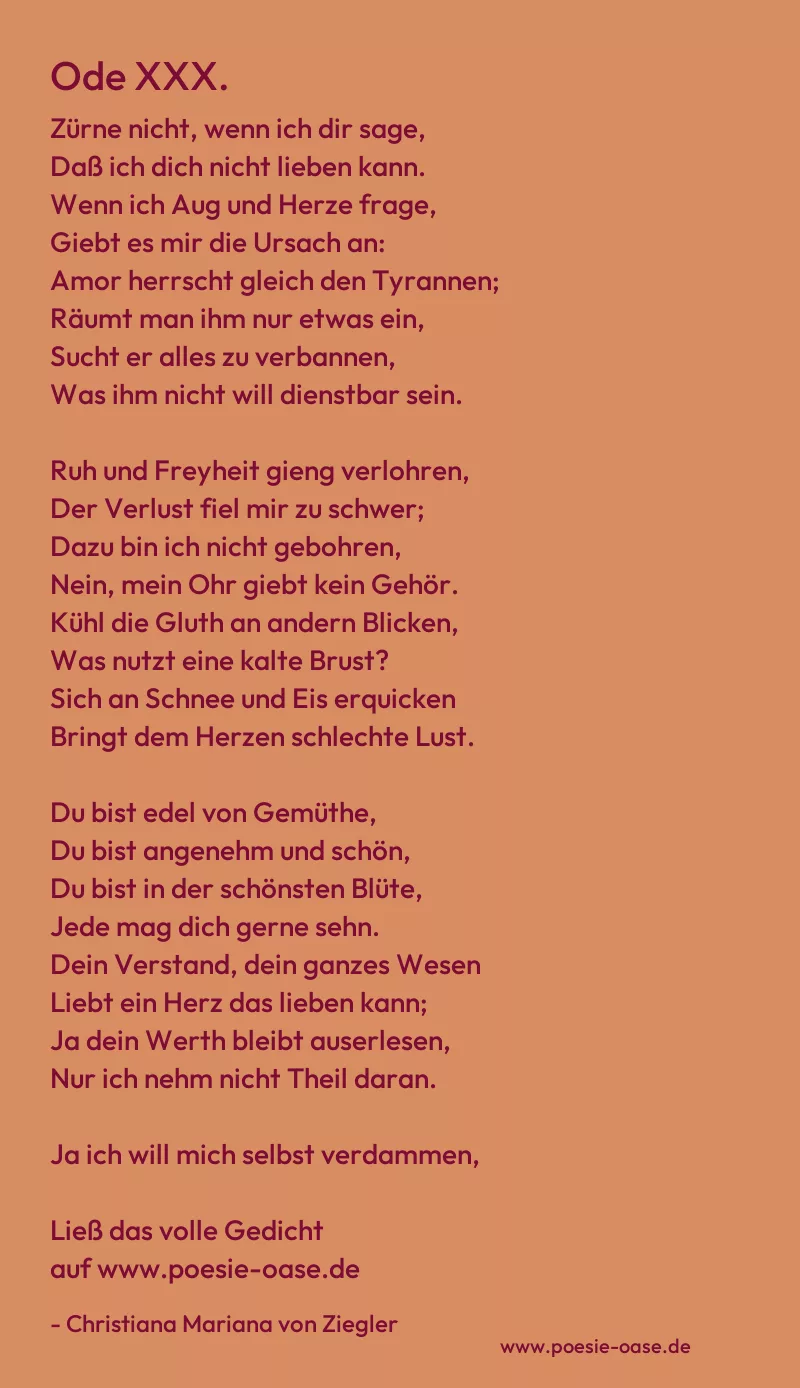Zürne nicht, wenn ich dir sage,
Daß ich dich nicht lieben kann.
Wenn ich Aug und Herze frage,
Giebt es mir die Ursach an:
Amor herrscht gleich den Tyrannen;
Räumt man ihm nur etwas ein,
Sucht er alles zu verbannen,
Was ihm nicht will dienstbar sein.
Ruh und Freyheit gieng verlohren,
Der Verlust fiel mir zu schwer;
Dazu bin ich nicht gebohren,
Nein, mein Ohr giebt kein Gehör.
Kühl die Gluth an andern Blicken,
Was nutzt eine kalte Brust?
Sich an Schnee und Eis erquicken
Bringt dem Herzen schlechte Lust.
Du bist edel von Gemüthe,
Du bist angenehm und schön,
Du bist in der schönsten Blüte,
Jede mag dich gerne sehn.
Dein Verstand, dein ganzes Wesen
Liebt ein Herz das lieben kann;
Ja dein Werth bleibt auserlesen,
Nur ich nehm nicht Theil daran.
Ja ich will mich selbst verdammen,
Mein Herz ist zu felsenfest,
Da im Ursprung deiner Flammen
Es dich gar verschmachten läßt.
Darum muß ich mit dir leiden,
Daß ich dich nicht trösten kann;
Dich und deinen Umgang meiden
Seh ich selbst für strafbar an.
Hoffe nur und sey zufrieden.
Zeit und Stunden ändern sich.
Was der Himmel der beschieden,
Das erhält er auch vor dich.
Er kann Geist und Herze lenken;
Sieht er meine Unschuld an,
Wird er auch an dich gedenken,
Daß ich dich noch lieben kann.
Dennoch will ich mich vergnügen,
Wenn mein Schicksal widerspricht.
Sollte ja die Hoffnung trügen,
Trügt doch deine Liebe nicht.
Ich kann dich doch niemals hassen;
Denn der erste Blick und Tag
Ließ mich was ins Herze fassen,
Das ich nicht gestehen mag.