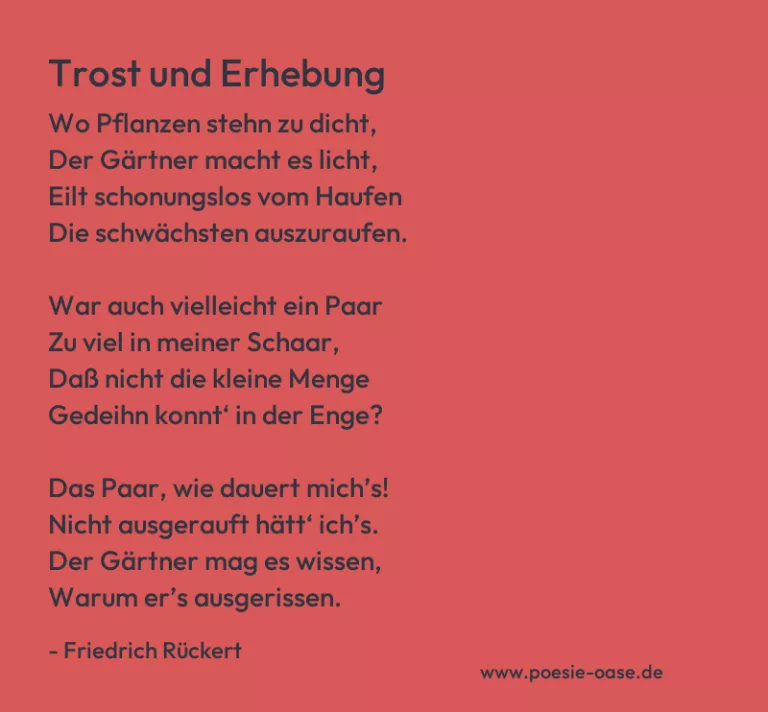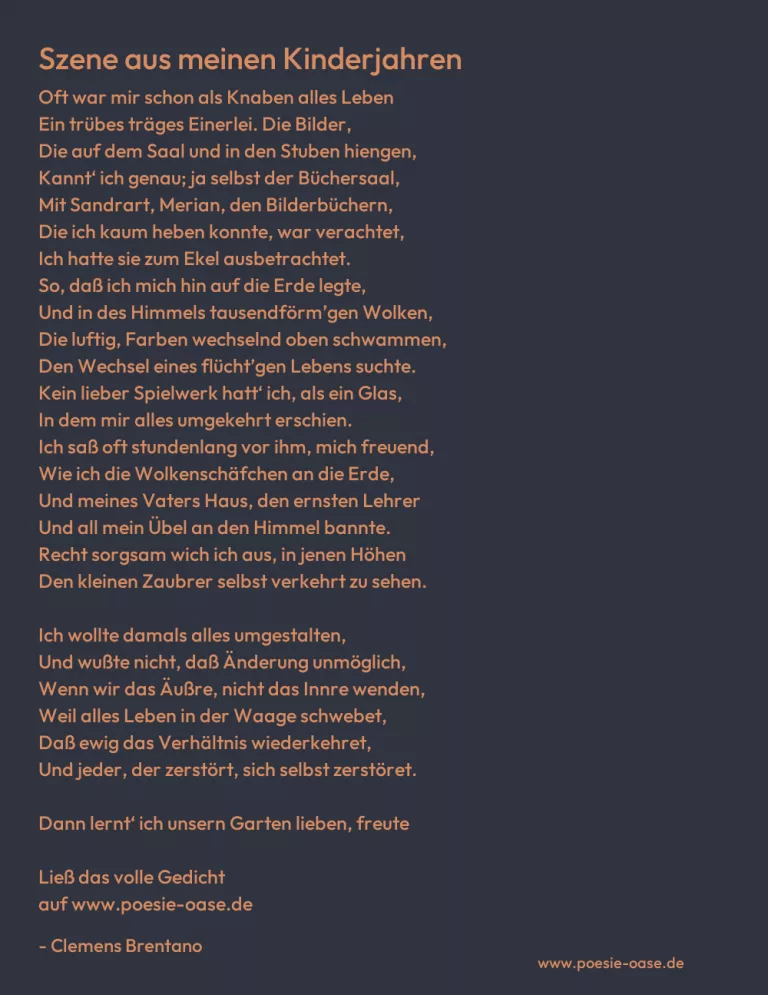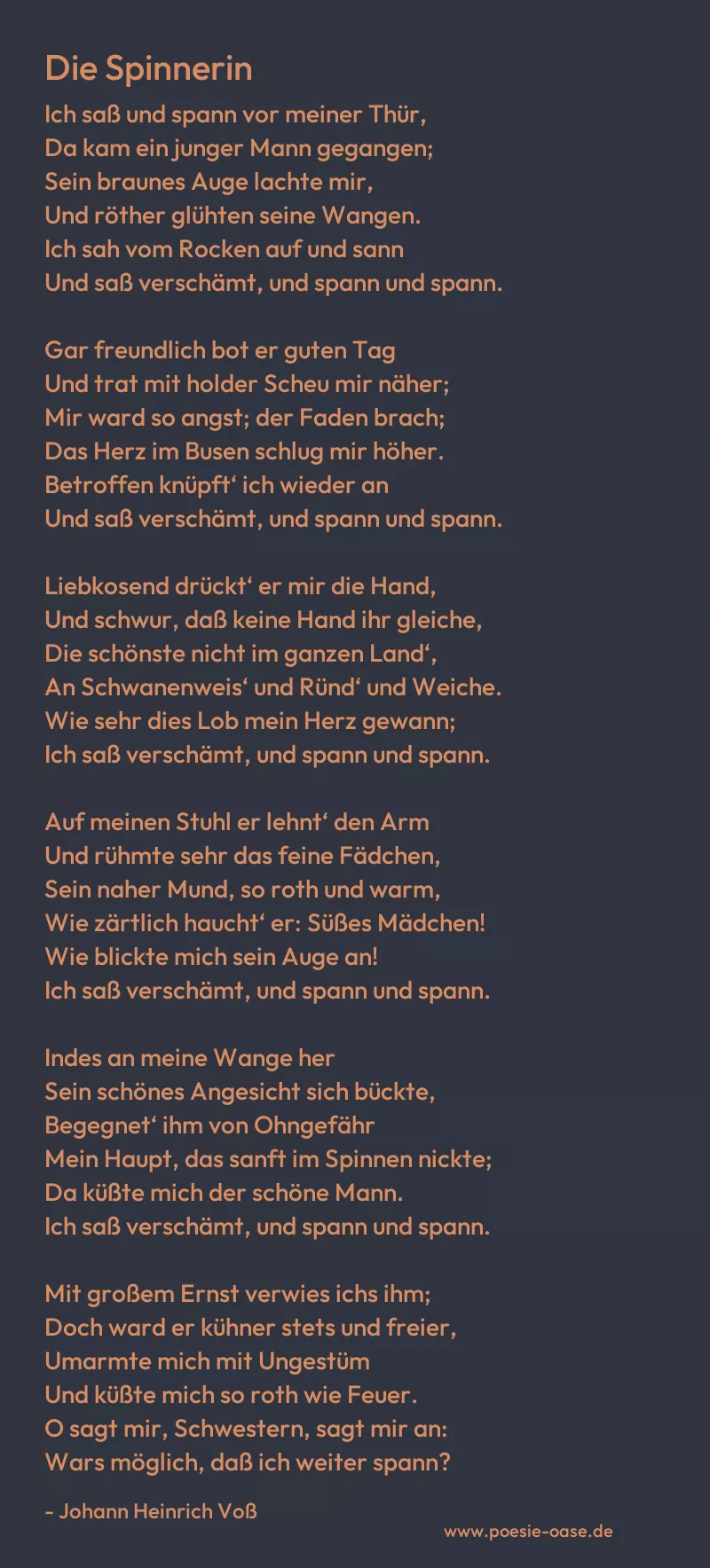Die Spinnerin
Ich saß und spann vor meiner Thür,
Da kam ein junger Mann gegangen;
Sein braunes Auge lachte mir,
Und röther glühten seine Wangen.
Ich sah vom Rocken auf und sann
Und saß verschämt, und spann und spann.
Gar freundlich bot er guten Tag
Und trat mit holder Scheu mir näher;
Mir ward so angst; der Faden brach;
Das Herz im Busen schlug mir höher.
Betroffen knüpft‘ ich wieder an
Und saß verschämt, und spann und spann.
Liebkosend drückt‘ er mir die Hand,
Und schwur, daß keine Hand ihr gleiche,
Die schönste nicht im ganzen Land‘,
An Schwanenweis‘ und Ründ‘ und Weiche.
Wie sehr dies Lob mein Herz gewann;
Ich saß verschämt, und spann und spann.
Auf meinen Stuhl er lehnt‘ den Arm
Und rühmte sehr das feine Fädchen,
Sein naher Mund, so roth und warm,
Wie zärtlich haucht‘ er: Süßes Mädchen!
Wie blickte mich sein Auge an!
Ich saß verschämt, und spann und spann.
Indes an meine Wange her
Sein schönes Angesicht sich bückte,
Begegnet‘ ihm von Ohngefähr
Mein Haupt, das sanft im Spinnen nickte;
Da küßte mich der schöne Mann.
Ich saß verschämt, und spann und spann.
Mit großem Ernst verwies ichs ihm;
Doch ward er kühner stets und freier,
Umarmte mich mit Ungestüm
Und küßte mich so roth wie Feuer.
O sagt mir, Schwestern, sagt mir an:
Wars möglich, daß ich weiter spann?
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
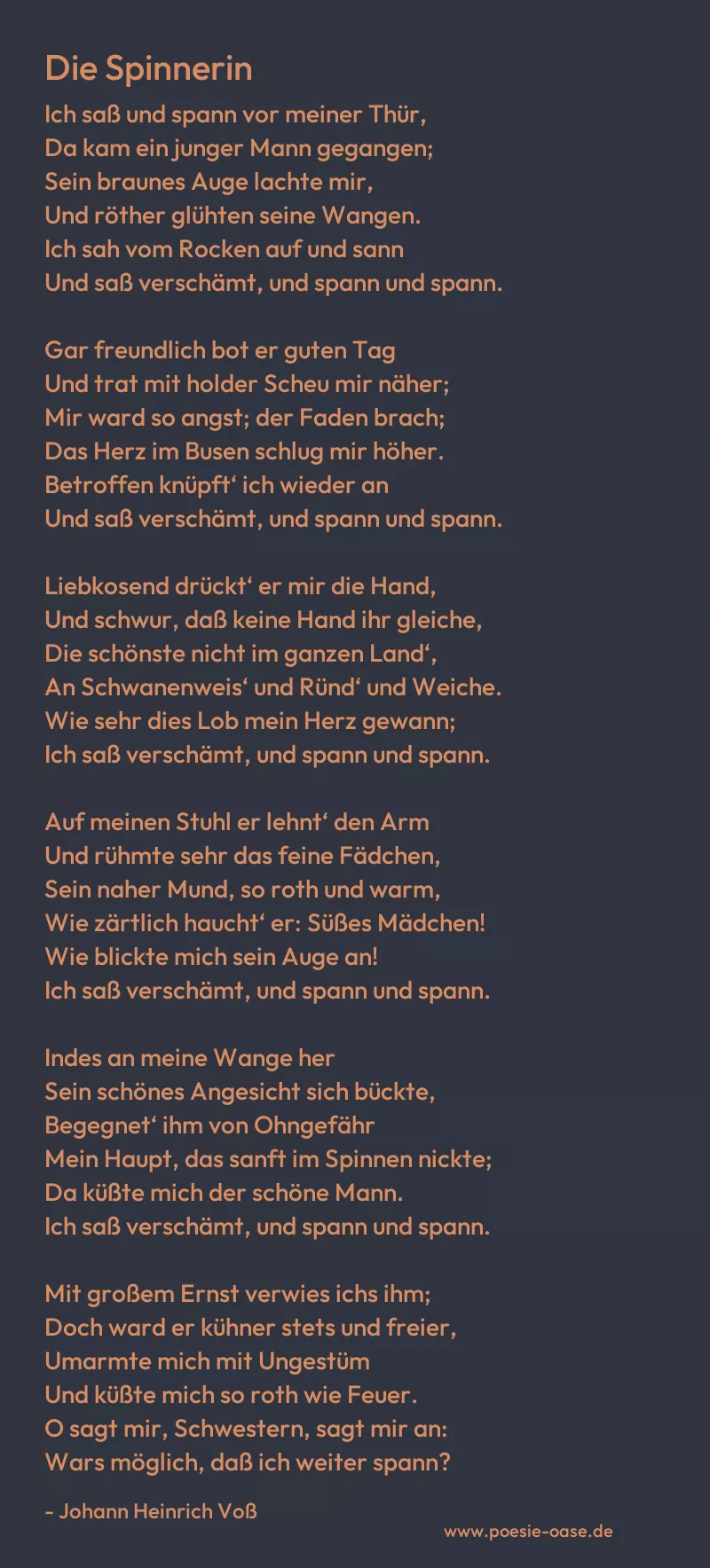
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die Spinnerin“ von Johann Heinrich Voß erzählt in schlichter, liedhafter Form die Begegnung einer jungen Frau mit einem charmanten, zudringlichen Verehrer. In einem durchgehend ruhigen, gereimten Ton entfaltet sich eine kleine Szene aus dem Alltagsleben, die jedoch tief in Emotion und weiblichem Erleben verwurzelt ist. Die Wiederholung der Zeile „Ich saß verschämt, und spann und spann“ am Ende jeder Strophe gibt dem Text eine ruhige, beinahe resignative Rhythmik und unterstreicht den inneren Zwiespalt zwischen Anstand und aufkeimender Zuneigung.
Die Szene beginnt harmlos: Die Sprecherin sitzt vor ihrer Tür und widmet sich dem traditionellen Frauenhandwerk, dem Spinnen. Der herannahende junge Mann weckt sofort ihr Interesse. Seine äußere Erscheinung – das lachende Auge, die roten Wangen – lässt sie erröten, doch sie versucht, ihre Arbeit fortzusetzen. Schon in dieser ersten Begegnung deutet sich eine Spannung zwischen äußeren Konventionen (Sitte, Zurückhaltung) und innerer Bewegung (Erregung, Neugier) an.
Mit jeder Strophe wird die Annäherung intimer: Der Mann spricht sie an, berührt ihre Hand, macht Komplimente über ihre Schönheit und Geschicklichkeit. Der schlichte, liebevolle Ton seiner Worte und die scheinbare Unschuld des Kontakts lassen die Grenzen zwischen Höflichkeit und Verführung verschwimmen. Die junge Frau reagiert durchgehend mit Scham, innerer Unruhe und äußerlicher Beschäftigung – das Spinnen dient ihr als Schutzhandlung, aber auch als Ausdruck ihrer Unsicherheit.
Der Wendepunkt kommt mit dem Kuss: Was zuerst wie ein zufälliger Moment beschrieben wird – „mein Haupt, das sanft im Spinnen nickte“ – endet mit dem ersten Kuss des Mannes. Die darauf folgende Strophe beschreibt, wie die Annäherung zunehmend fordernder wird. Trotz eines versuchten Tadels wird der Mann dreister, umarmt sie, küsst sie heftiger. Die scheinbar harmlose Liebeswerbung schlägt in körperliche Leidenschaft um, gegen die sich die Sprecherin nur noch halbherzig wehrt.
In der Schlussfrage liegt eine doppelte Bedeutung: „Wars möglich, daß ich weiter spann?“ verweist sowohl auf die unterbrochene Tätigkeit als auch auf die seelische Erschütterung der Sprecherin. Die Frage bleibt offen, stellt aber auch das Spannungsverhältnis zwischen Sitte und Begehren, zwischen Pflichterfüllung und Lust zur Diskussion. Voß gelingt es, in einfacher Sprache und volksliedhafter Form eine komplexe Gefühlslage zu schildern, die gleichermaßen humorvoll, sinnlich und nachdenklich ist.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.