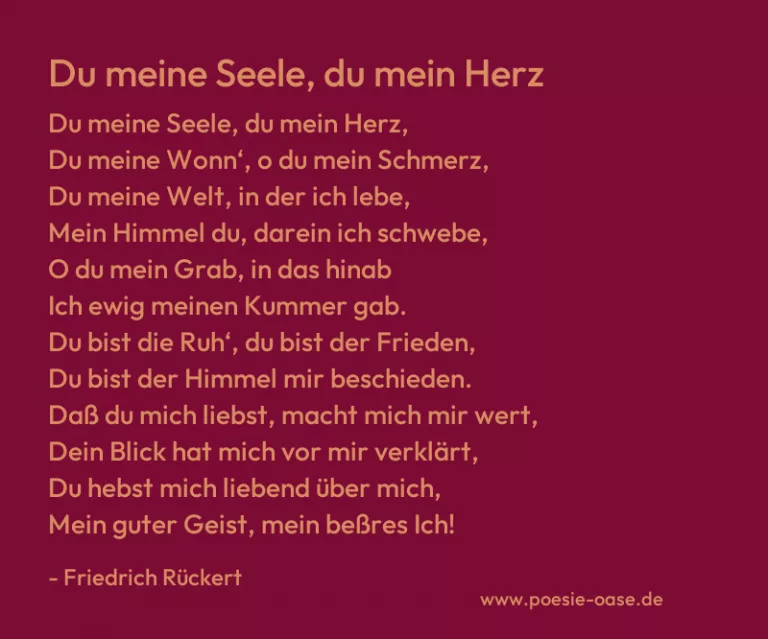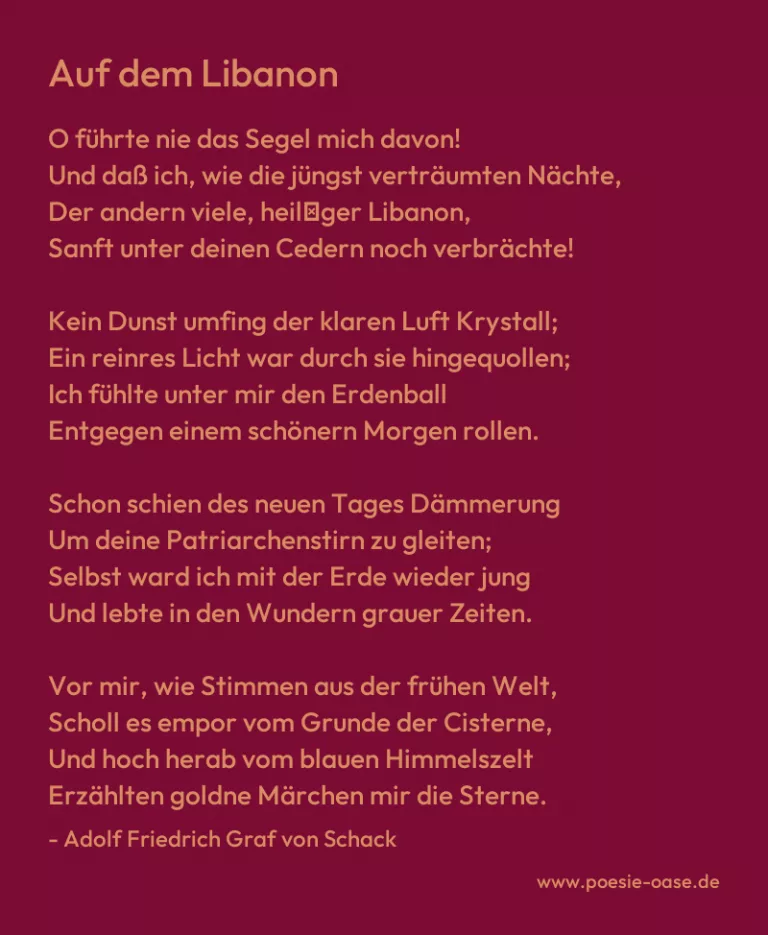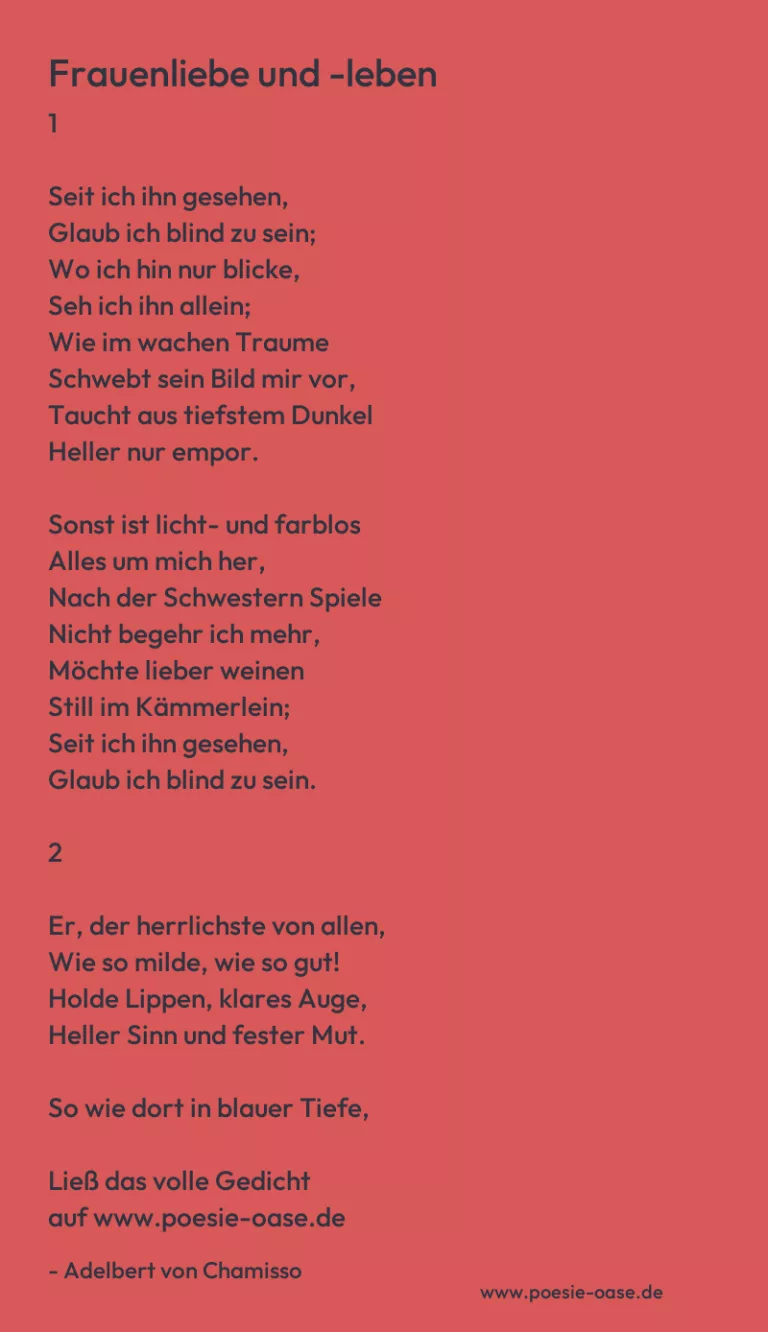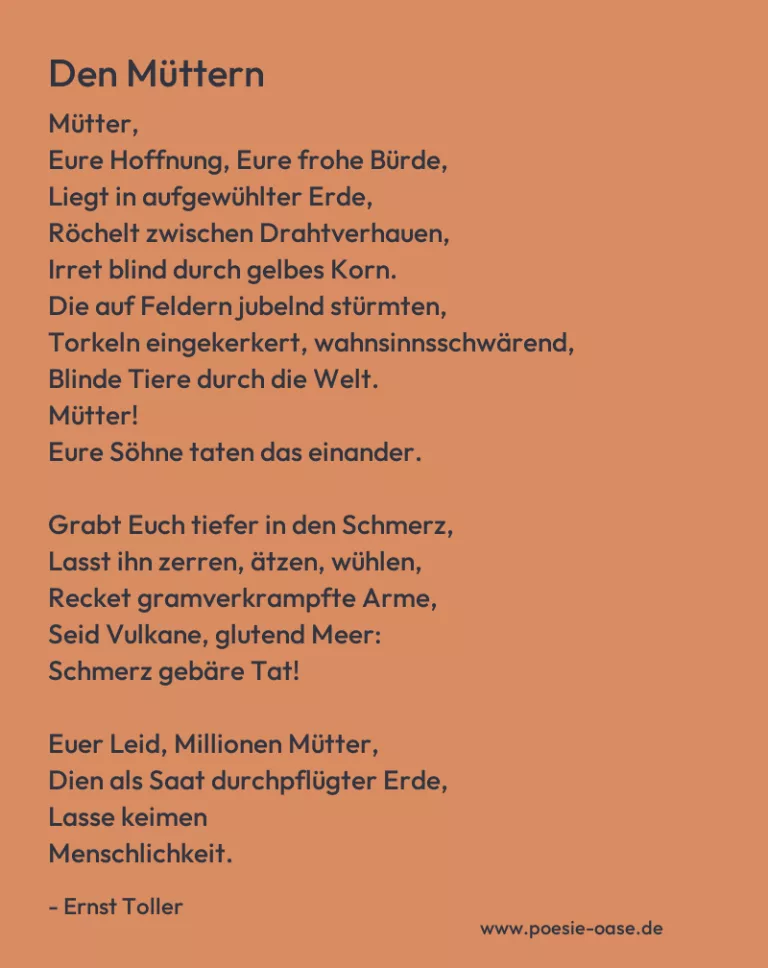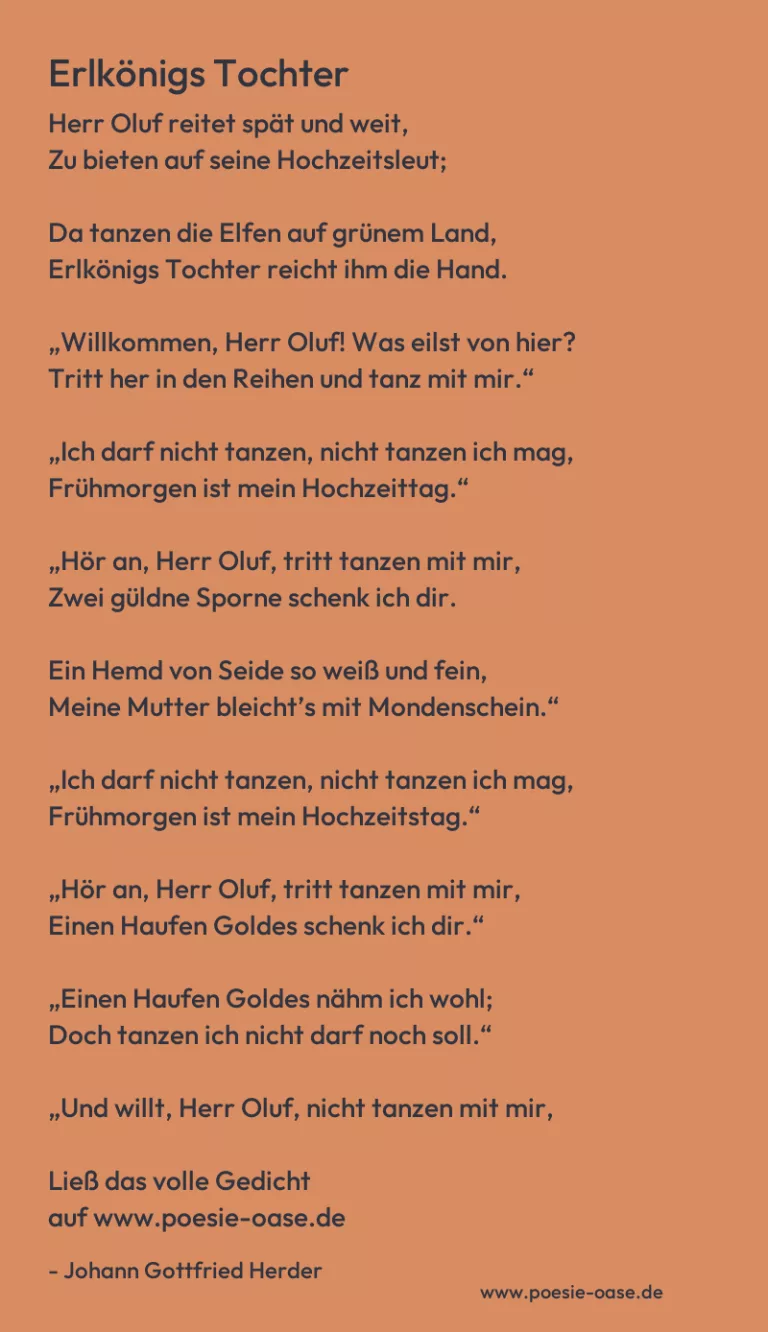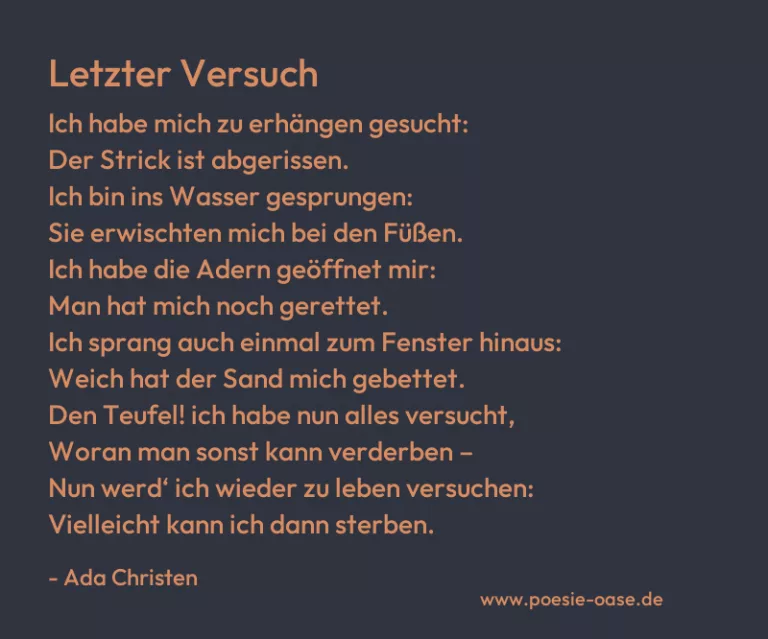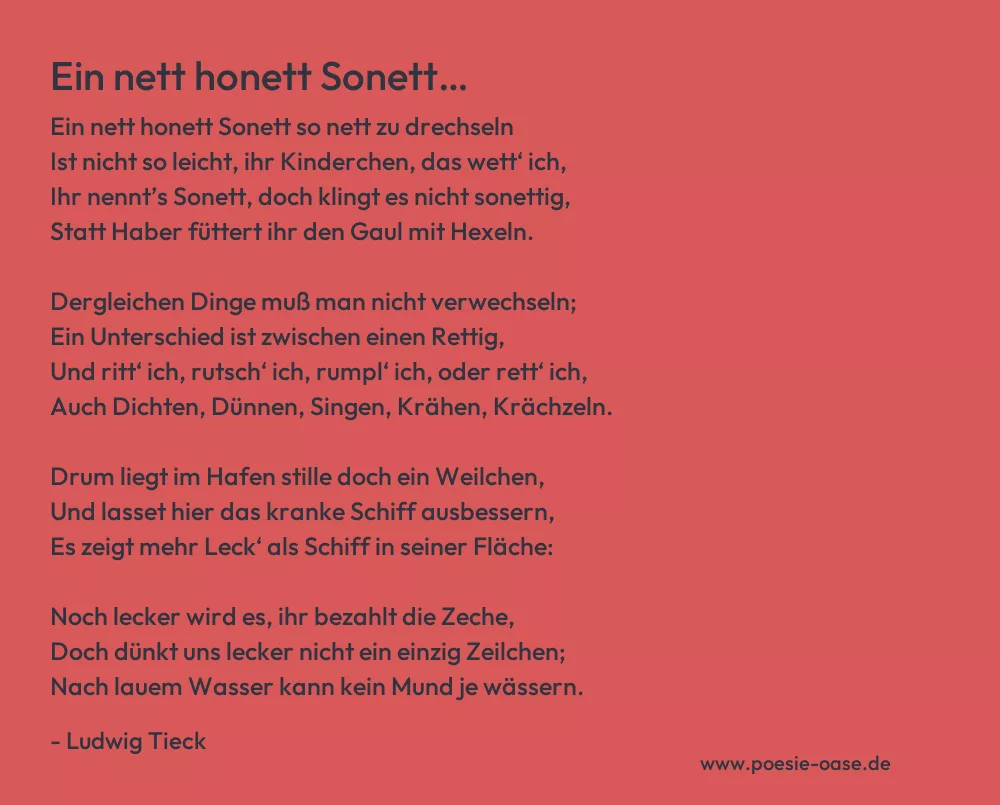Ein nett honett Sonett…
Ein nett honett Sonett so nett zu drechseln
Ist nicht so leicht, ihr Kinderchen, das wett‘ ich,
Ihr nennt’s Sonett, doch klingt es nicht sonettig,
Statt Haber füttert ihr den Gaul mit Hexeln.
Dergleichen Dinge muß man nicht verwechseln;
Ein Unterschied ist zwischen einen Rettig,
Und ritt‘ ich, rutsch‘ ich, rumpl‘ ich, oder rett‘ ich,
Auch Dichten, Dünnen, Singen, Krähen, Krächzeln.
Drum liegt im Hafen stille doch ein Weilchen,
Und lasset hier das kranke Schiff ausbessern,
Es zeigt mehr Leck‘ als Schiff in seiner Fläche:
Noch lecker wird es, ihr bezahlt die Zeche,
Doch dünkt uns lecker nicht ein einzig Zeilchen;
Nach lauem Wasser kann kein Mund je wässern.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
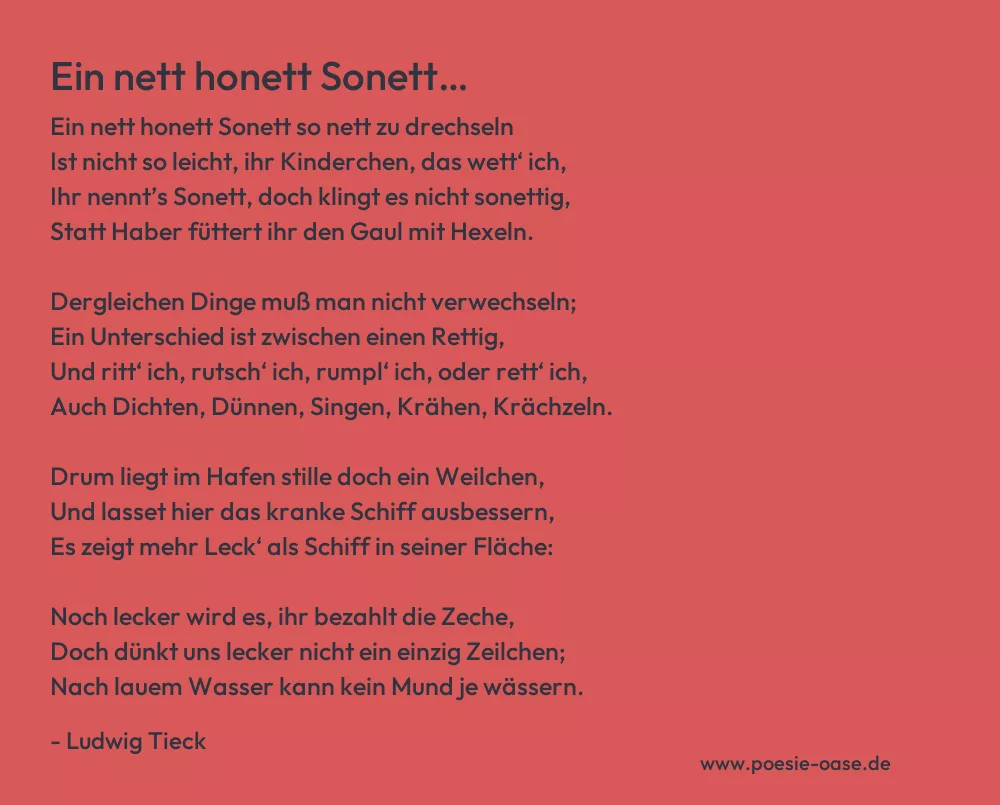
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ein nett honett Sonett…“ von Ludwig Tieck ist eine humorvolle und ironische Auseinandersetzung mit der Kunstform des Sonetts und der poetischen Sprache im Allgemeinen. Schon der Titel mit dem absichtlichen Rechtschreibfehler „honett“ anstelle von „honett“ und der spielerischen, unorthodoxen Struktur deutet darauf hin, dass Tieck sich über die formalen und stilistischen Zwänge der klassischen Poesie lustig macht.
In der ersten Strophe spielt Tieck mit der Idee des „Sonetts“, einem wohlbekannten, aber nicht leicht zu meisternden poetischen Format. Er stellt fest, dass es „nicht so leicht“ ist, ein wirklich gutes Sonett zu verfassen. Dabei kritisiert er die „Kinderchen“, die „Haber füttern“ und die Kunstform mit „Hexeln“ statt mit echter Poesie nähren. Die humorvolle und absurde Wortwahl („Gaul mit Hexeln“) macht deutlich, dass Tieck eine gewisse Ironie gegenüber dem formalen Dichten hegt und die Kluft zwischen Anspruch und tatsächlicher Ausführung hervorhebt.
Die zweite Strophe setzt diesen humorvollen Ton fort, indem Tieck den Unterschied zwischen scheinbar ähnlichen, aber völlig unterschiedlichen Begriffen betont. Der „Rettig“ (ein Gemüse) und „ritt‘ ich, rutsch‘ ich, rumpl‘ ich, oder rett‘ ich“ sind hier Teil einer scherzhaften Gegenüberstellung, die den formalen Unterschied zwischen echter poetischer Sprache und ihren willkürlichen Varianten aufzeigt. Der poetische Ausdruck wird so zu einer Art Sprachspiel, das Tieck gleichzeitig respektiert und verspottet.
In der dritten Strophe kritisiert Tieck die Poesie, die er als „kranke Schiff“ bezeichnet. Das „Schiff“ – metaphorisch für das Gedicht – wird als defekt und ausbesserungsbedürftig dargestellt. Dies symbolisiert eine gewisse Missachtung gegenüber der vermeintlichen Perfektion der klassischen Dichtkunst und zugleich eine Anerkennung der Tatsache, dass auch die hohe Kunst fehlerhaft sein kann. Die „leckeren“ Versuche werden durch das Wort „Leck‘“ in den Kontext des ausgebesserten Schiffs gestellt, was eine scharfe, aber humorvolle Kritik an der Unvollkommenheit des poetischen Schaffens darstellt.
Das Gedicht endet mit einer Ironie, die auf den „laue[n] Wasser“ hinweist, die „kein Mund je wässern“ kann. Hier wird die Unmöglichkeit betont, dass „laues Wasser“ (also etwas lau und belanglos) jemals zu einer vollwertigen poetischen Leistung werden kann. Tieck deutet darauf hin, dass wahre Kunst nicht aus halben Bemühungen oder lauen Versuchen entstehen kann. Das Sonett wird also zum Spiel mit der Form, bei dem Tieck die Ideale der klassischen Dichtkunst sowohl bewundert als auch verspottet.
Tiecks Gedicht ist ein kunstvolles, humorvolles Spiel mit der Form des Sonetts und zugleich eine satirische Reflexion über die Künstlichkeit der poetischen Praxis. Es stellt die Frage nach der Authentizität und der wahren Bedeutung des dichterischen Schaffens, indem es die Form des Sonetts auf eine humorvolle und zugleich tiefgründige Weise hinterfragt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.