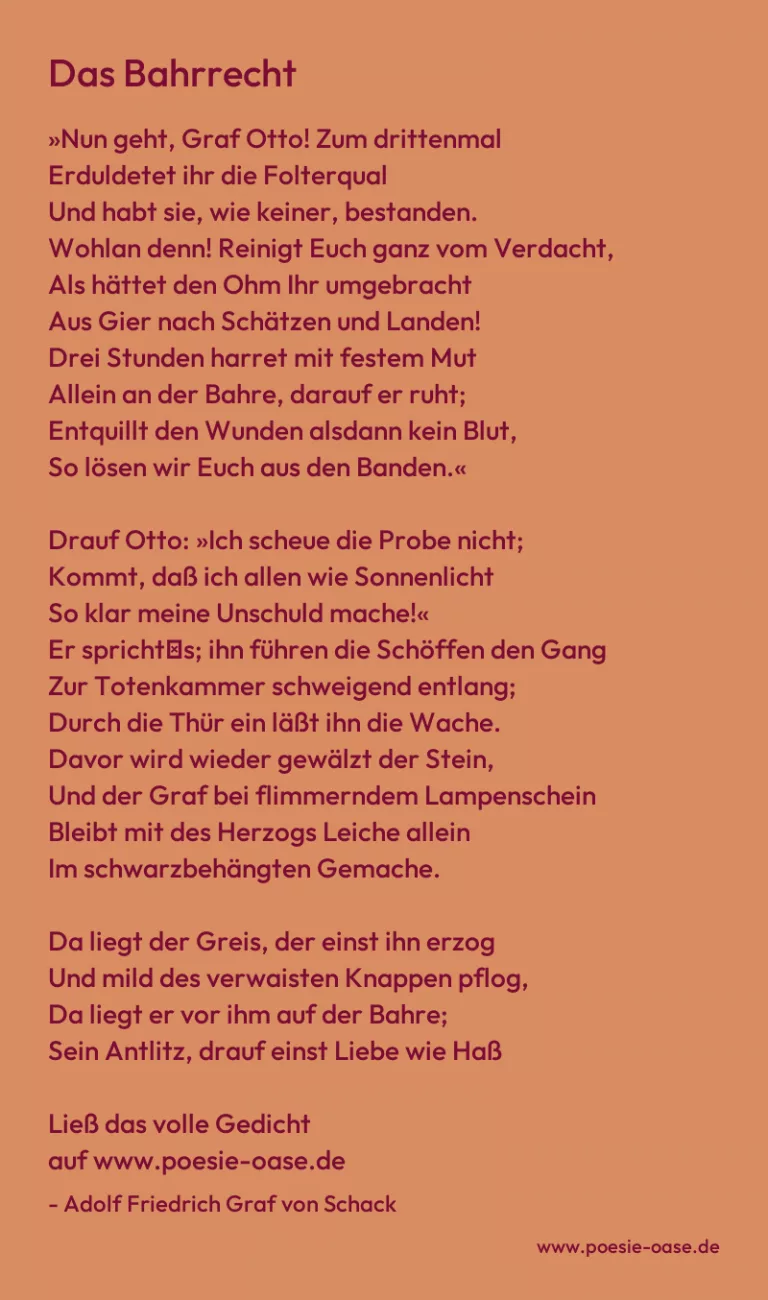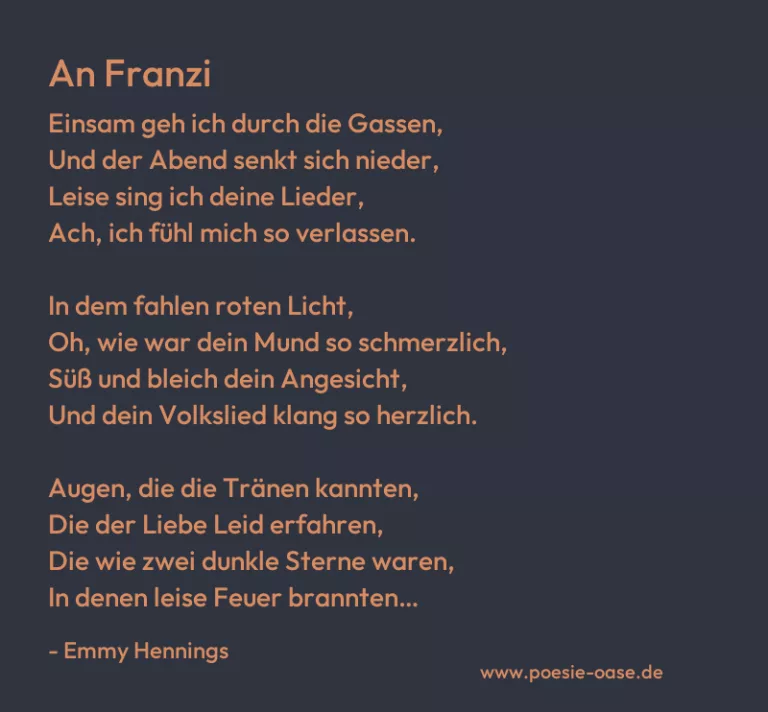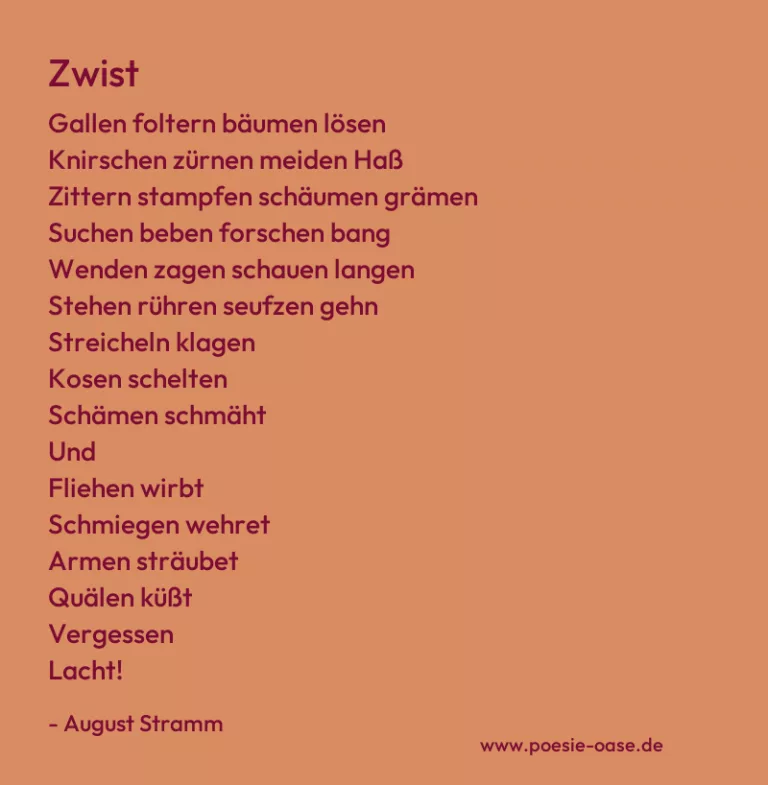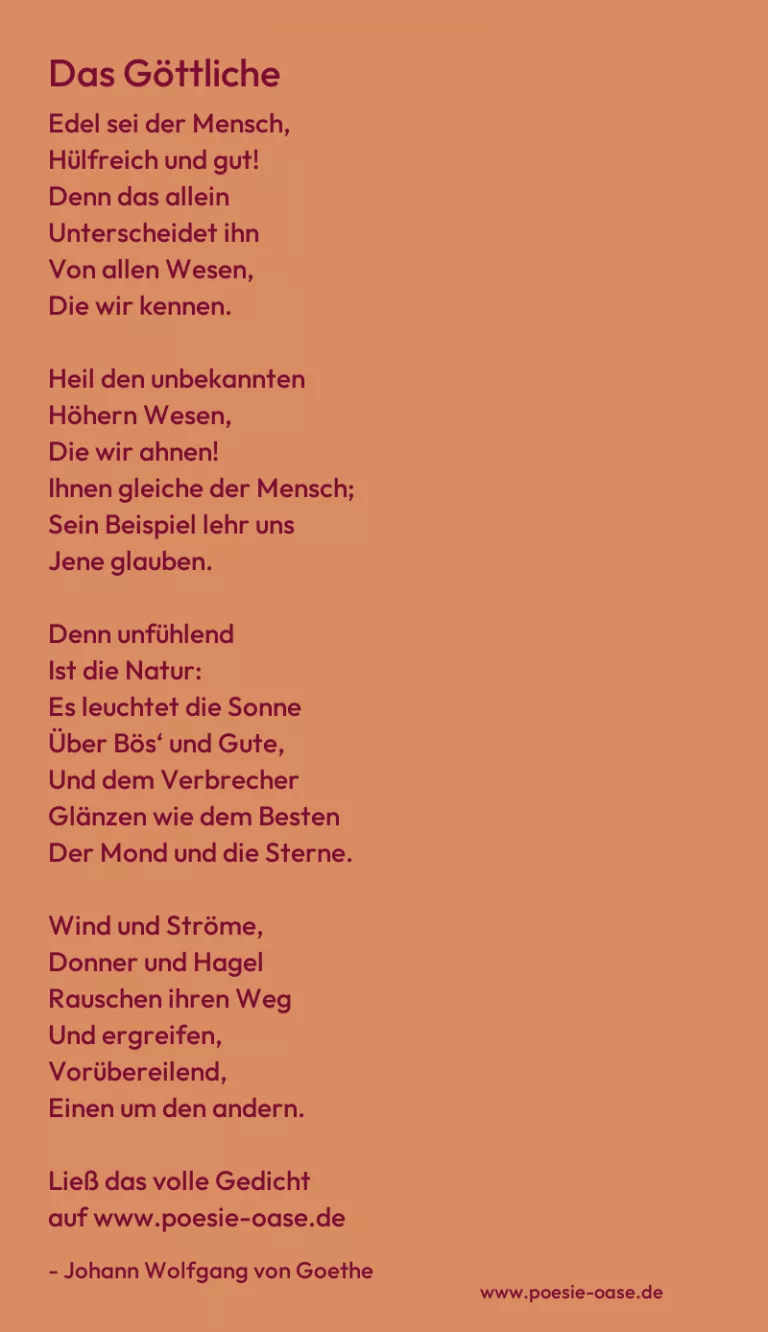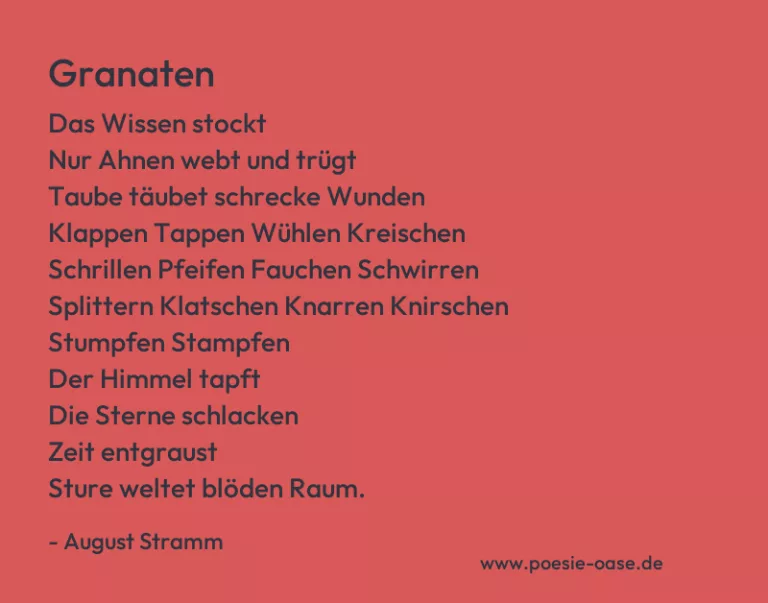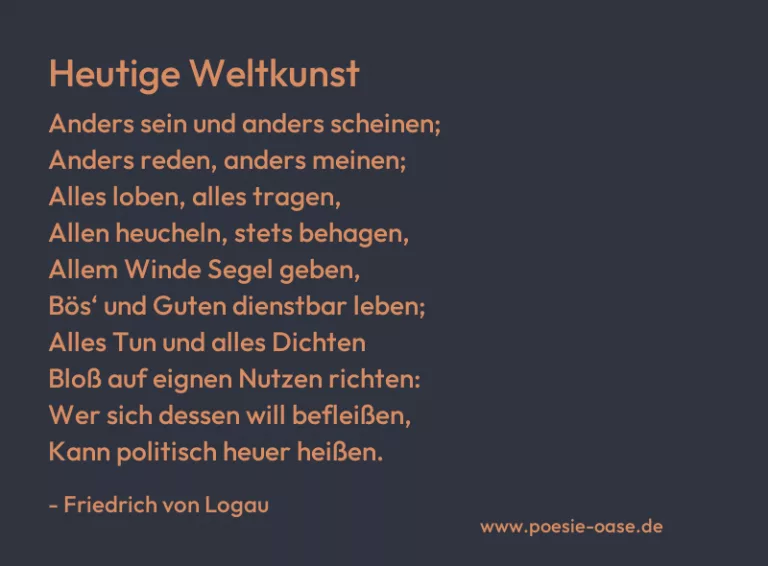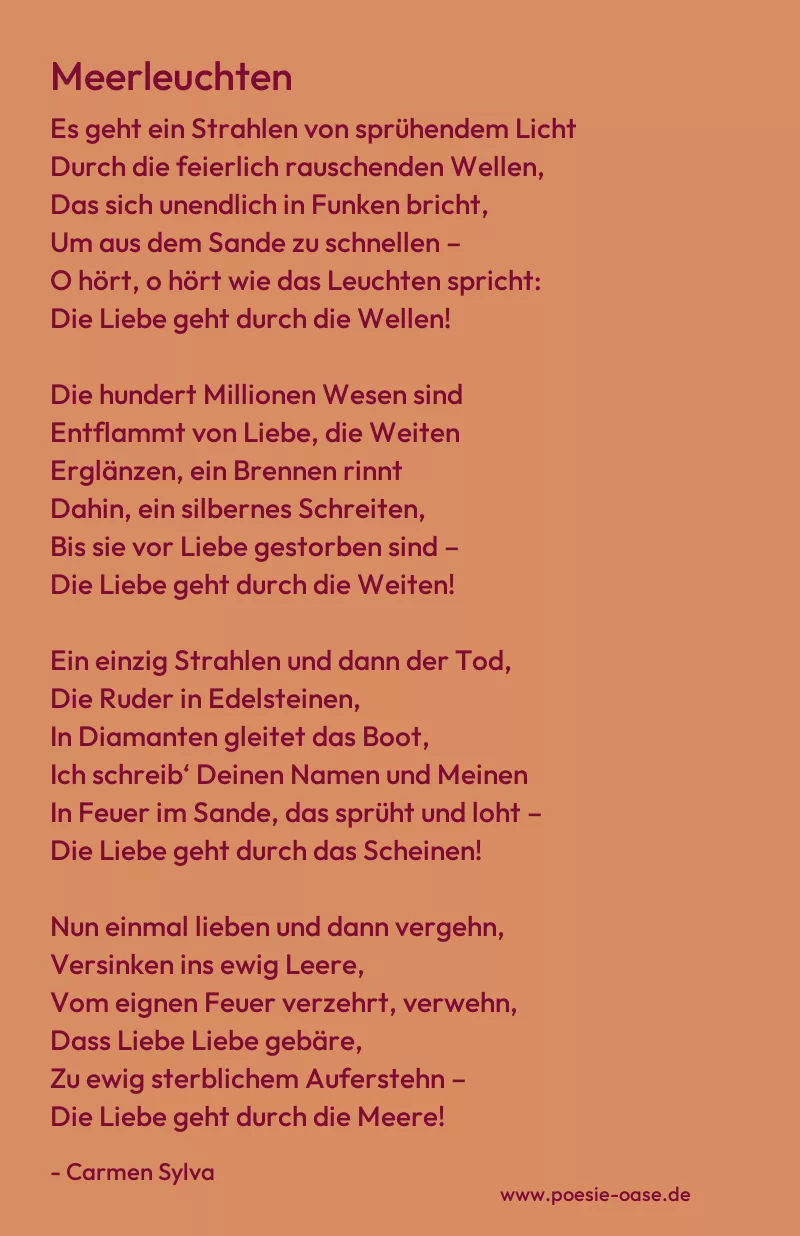Meerleuchten
Es geht ein Strahlen von sprühendem Licht
Durch die feierlich rauschenden Wellen,
Das sich unendlich in Funken bricht,
Um aus dem Sande zu schnellen –
O hört, o hört wie das Leuchten spricht:
Die Liebe geht durch die Wellen!
Die hundert Millionen Wesen sind
Entflammt von Liebe, die Weiten
Erglänzen, ein Brennen rinnt
Dahin, ein silbernes Schreiten,
Bis sie vor Liebe gestorben sind –
Die Liebe geht durch die Weiten!
Ein einzig Strahlen und dann der Tod,
Die Ruder in Edelsteinen,
In Diamanten gleitet das Boot,
Ich schreib‘ Deinen Namen und Meinen
In Feuer im Sande, das sprüht und loht –
Die Liebe geht durch das Scheinen!
Nun einmal lieben und dann vergehn,
Versinken ins ewig Leere,
Vom eignen Feuer verzehrt, verwehn,
Dass Liebe Liebe gebäre,
Zu ewig sterblichem Auferstehn –
Die Liebe geht durch die Meere!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
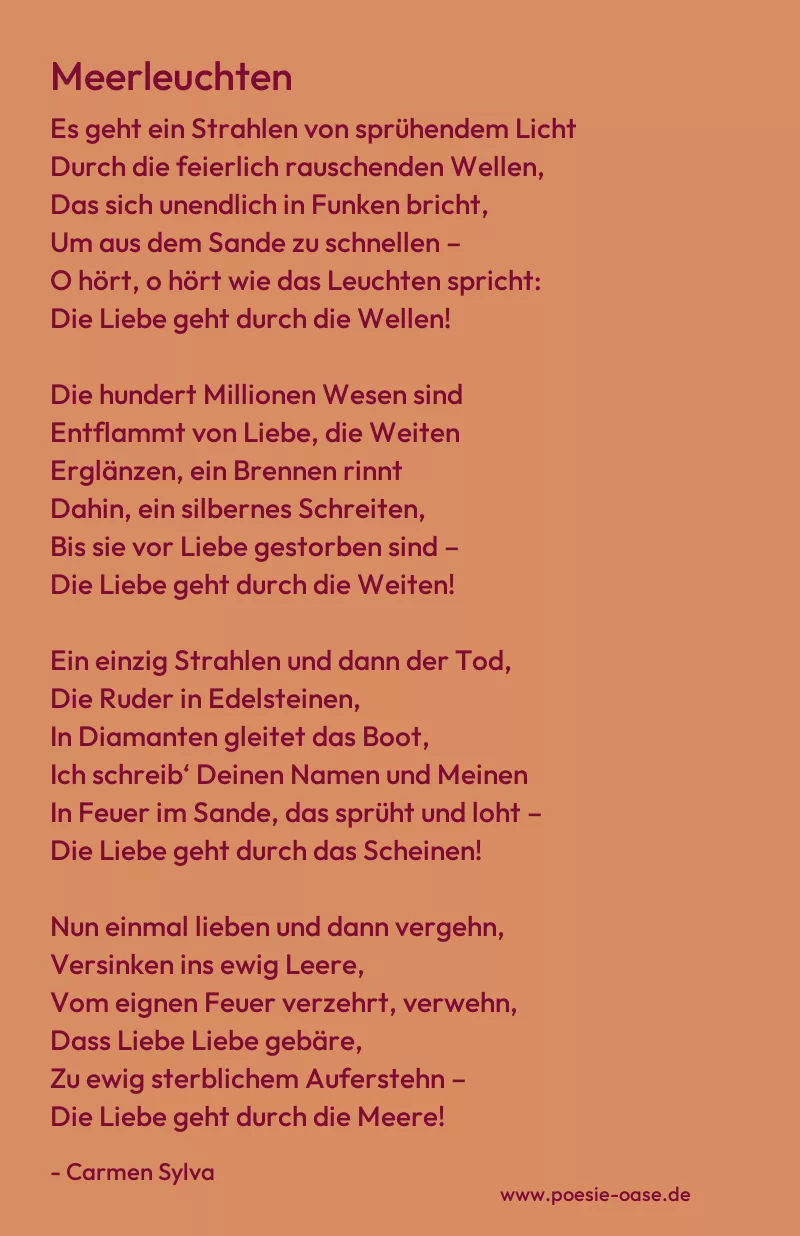
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Meerleuchten“ von Carmen Sylva thematisiert auf poetische Weise die unsterbliche Kraft der Liebe, die sich in den Elementen des Meeres widerspiegelt. Zu Beginn beschreibt die Dichterin ein „Strahlen von sprühendem Licht“, das sich in den „feierlich rauschenden Wellen“ bricht. Dieses Licht, das sich unendlich in Funken auflöst, symbolisiert die kraftvolle und transzendente Natur der Liebe, die den Wellen des Meeres ähnelt: unaufhaltsam, tief und weit. Das Leuchten spricht direkt von der Liebe, die in den Wellen „durch die Wellen geht“ – ein Bild für die Bewegung und die emotionale Kraft, die Liebe über die Zeit und das Meer hinweg transportiert.
Die zweite Strophe intensiviert dieses Bild, indem sie von den „hundert Millionen Wesen“ spricht, die „entflammt von Liebe“ sind. Hier wird die unermessliche Weite des Meeres und die Vernichtung durch Liebe dargestellt. Die „Weiten“ glänzen in einem „Brennen“, und die Wesen sterben vor Liebe – eine Metapher für die unaufhaltsame und allumfassende Macht der Liebe, die auch in ihrer Intensität zum Untergang führen kann. Dieser Gedanke des „verglühenden“ Begehrens wird mit einem silbernen Schreiten, einem fast magischen Bild, poetisch hervorgehoben.
In der dritten Strophe erscheint das Bild der „Ruder in Edelsteinen“ und das „Boot“, das „in Diamanten gleitet“. Diese bildhaften Elemente verweben Liebe mit Reichtum und Schönheit. Das „Schreiben des Namens“ im Feuer im Sande und das „Sprühen und Lohten“ symbolisieren eine Vereinigung, die so stark und unvergänglich wie das Feuer selbst ist. Das „Scheinen“ verweist auf eine glänzende, jedoch vergängliche Liebe, die ebenso dem Tod unterliegt.
Die letzte Strophe bringt das Gedicht zu einem philosophischen Abschluss, indem sie das Konzept des Lebens und der Liebe als vergänglichen Zyklus darstellt. „Einmal lieben und dann vergehn“, verweist auf die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens, das sich jedoch durch die „Liebe“ immer wieder neu erschafft. Das Bild der Liebe, die sich selbst „verzehrt“ und „verweht“, symbolisiert die Selbstopferung und die Unendlichkeit des Kreislaufs von Leben und Tod. Am Ende steht das „Auferstehen“ aus dem „Ewig-Leeren“, was die Idee der Wiedergeburt und die fortwährende Präsenz der Liebe im Unendlichen unterstreicht.
Carmen Sylva bringt hier eine tiefgründige, fast mystische Vision der Liebe zum Ausdruck, die sowohl schöpferisch als auch zerstörerisch ist. Ihre poetische Sprache und die kraftvollen Bilder des Meeres, des Feuers und des Scheins spiegeln die Komplexität und die Dualität der Liebe wider: eine unaufhaltsame Kraft, die Leben hervorbringt und gleichzeitig in den Tod führt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.