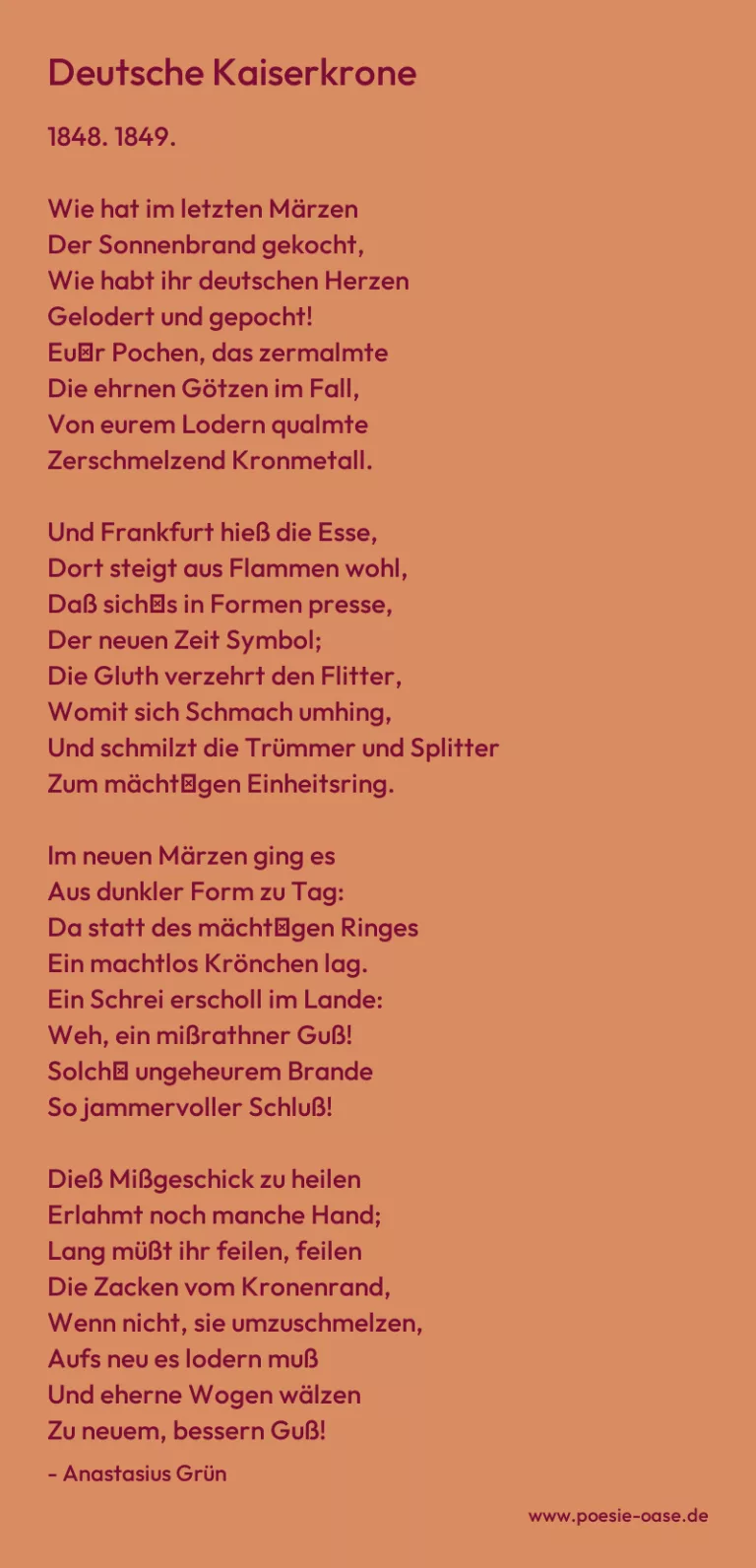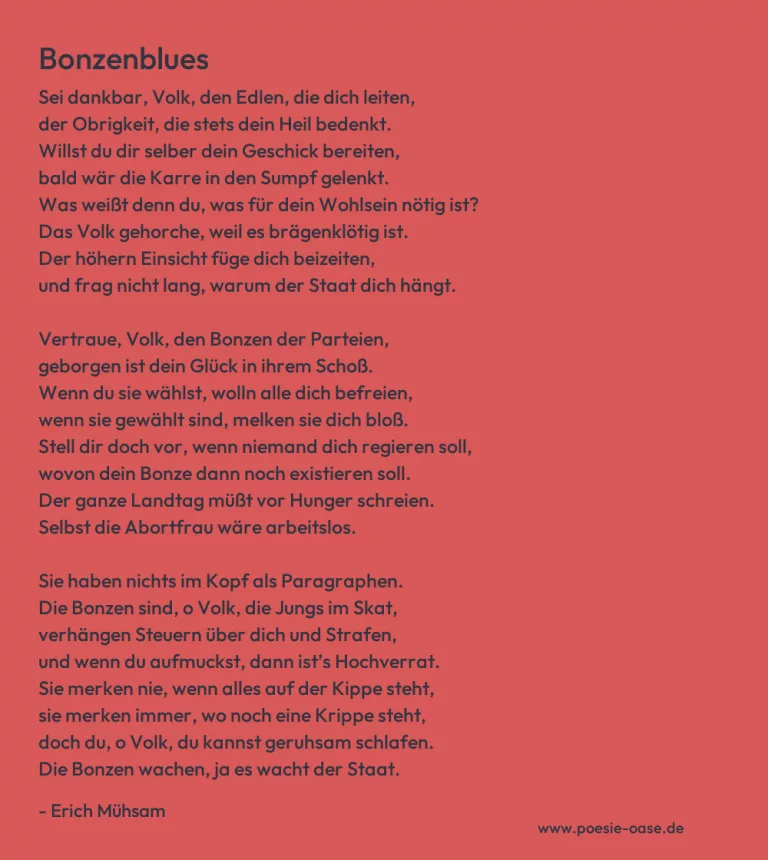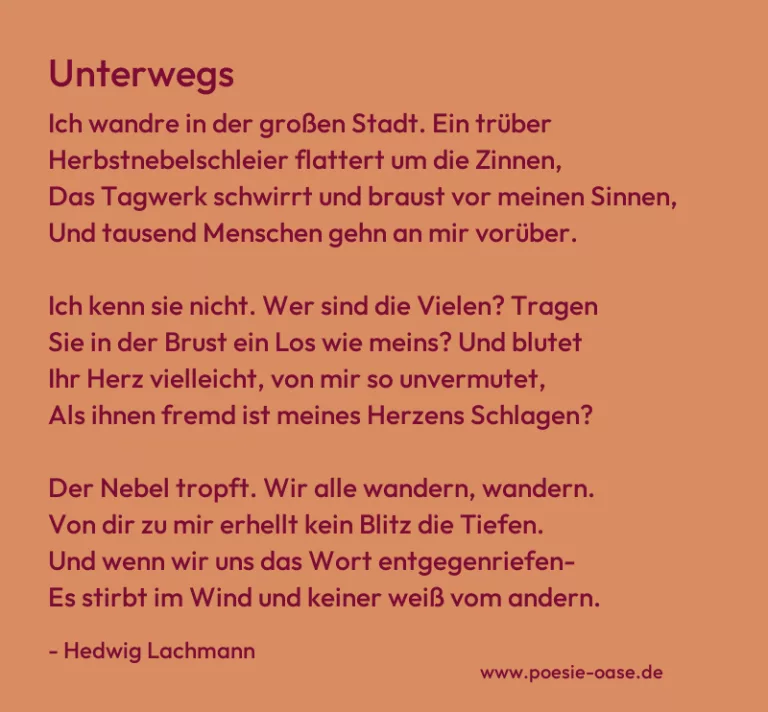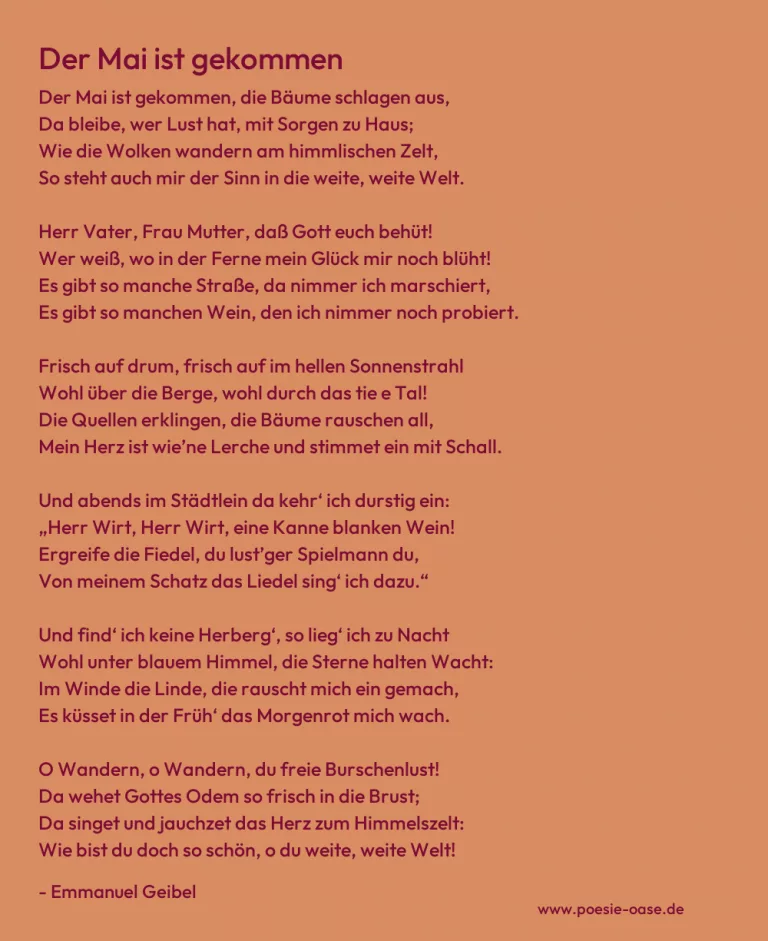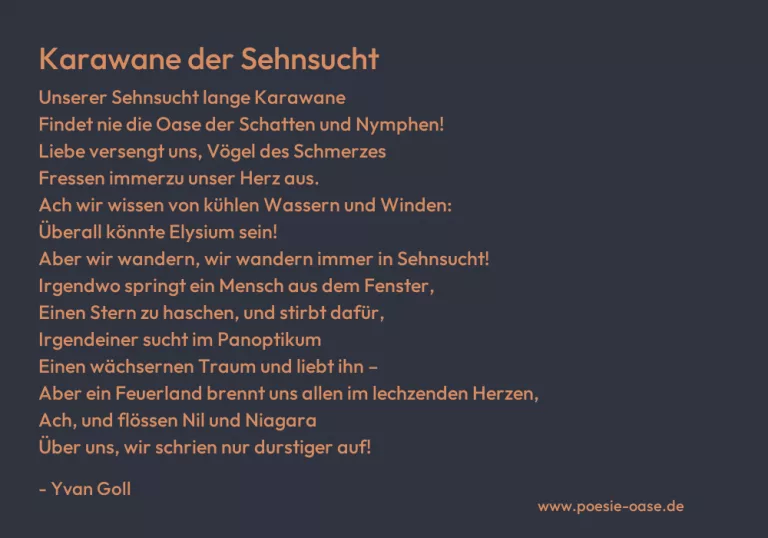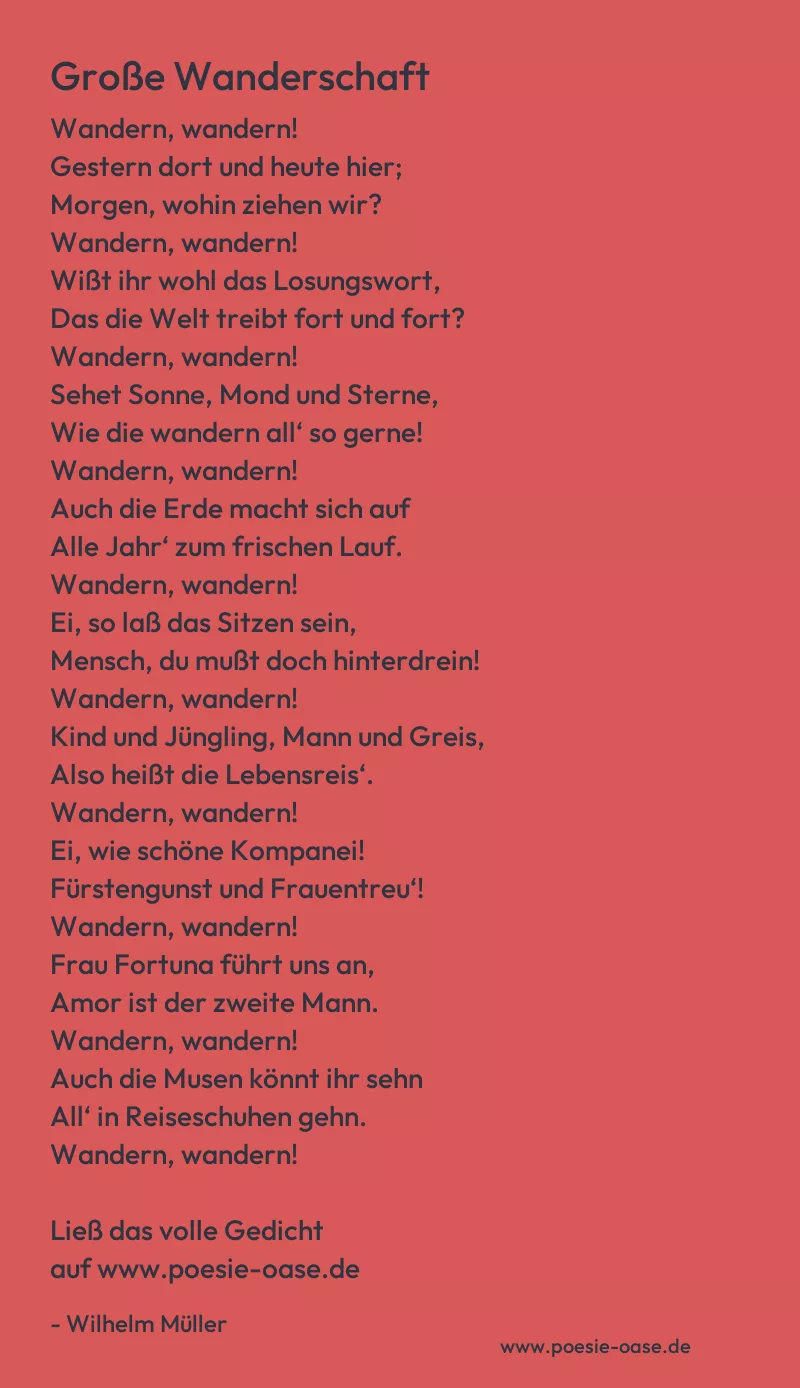Chaos, Gegenwart, Gemeinfrei, Götter, Helden & Prinzessinnen, Herbst, Himmel & Wolken, Lachen, Natur, Sommer, Wagnisse, Weihnachten
Große Wanderschaft
Wandern, wandern!
Gestern dort und heute hier;
Morgen, wohin ziehen wir?
Wandern, wandern!
Wißt ihr wohl das Losungswort,
Das die Welt treibt fort und fort?
Wandern, wandern!
Sehet Sonne, Mond und Sterne,
Wie die wandern all‘ so gerne!
Wandern, wandern!
Auch die Erde macht sich auf
Alle Jahr‘ zum frischen Lauf.
Wandern, wandern!
Ei, so laß das Sitzen sein,
Mensch, du mußt doch hinterdrein!
Wandern, wandern!
Kind und Jüngling, Mann und Greis,
Also heißt die Lebensreis‘.
Wandern, wandern!
Ei, wie schöne Kompanei!
Fürstengunst und Frauentreu‘!
Wandern, wandern!
Frau Fortuna führt uns an,
Amor ist der zweite Mann.
Wandern, wandern!
Auch die Musen könnt ihr sehn
All‘ in Reiseschuhen gehn.
Wandern, wandern!
Mars fährt auf Aprillenwetter,
Laune heißt des Ruhmes Vetter.
Wandern, wandern!
Liebes Herz, so zieh‘ nur mit,
Halte wacker Schritt und Tritt!
Wandern, wandern!
Heute hier und morgen dort,
Und zu Haus an jedem Ort.
Wandern, wandern!
Regen, Sturm und Sonnenschein,
Rebensaft und Gerstenwein.
Wandern, wandern!
Heute blond und morgen braun
Ist mein Schätzchen anzuschaun.
Wandern, wandern!
Kalt und warm und schlicht und kraus,
Bienenschwarm und Schneckenhaus.
Wandern, wandern!
Heut‘ hab‘ ich dies Lied erdacht,
Morgen wird es ausgelacht.
Wandern, wandern!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
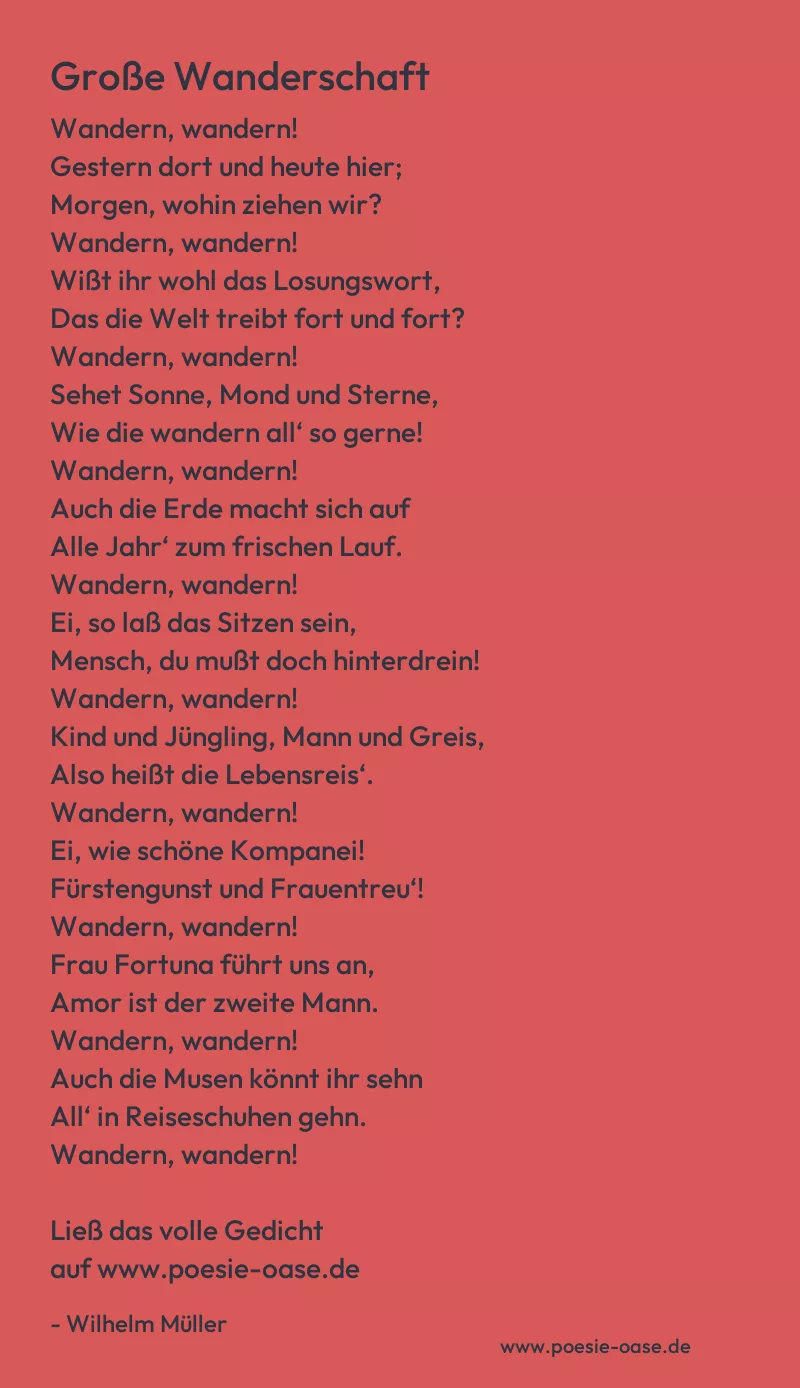
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Große Wanderschaft“ von Wilhelm Müller feiert in schwungvollen, wiederholenden Versen das Motiv des ständigen Unterwegsseins. Das Wort „Wandern“, das fast in jeder Zeile erscheint, wird zum rhythmischen Leitmotiv eines Lebensgefühls, das Bewegung, Veränderung und Offenheit zum Ideal erhebt. Müller zeichnet hier ein lebensbejahendes, fast volkstümlich anmutendes Bild vom Dasein als Reise, bei der Stillstand nicht vorgesehen ist.
Der erste Teil des Gedichts betont die universelle Gültigkeit dieses Wanderns. Nicht nur der Mensch, sondern auch Sonne, Mond, Sterne und sogar die Erde selbst sind in ständiger Bewegung. Das Wandern erscheint als Naturgesetz, dem sich auch der Mensch fügen muss: „Mensch, du mußt doch hinterdrein!“ Die Lebensreise beginnt schon in der Kindheit und reicht bis ins Greisenalter – Wandern wird so zum Symbol des ganzen menschlichen Lebenslaufs.
Im mittleren Teil erweitert sich das Wandermotiv zu einer Art Gesellschaftsbild. Es zeigt, dass nicht nur gewöhnliche Menschen, sondern auch Fürsten, Musen und Götter wie Fortuna, Amor und Mars unterwegs sind. Selbst Ruhm, Liebe und künstlerische Inspiration sind launisch und flüchtig – das Leben ist in allen Aspekten ein Spiel von Bewegung, Zufall und Wechsel. Die scheinbar festen Größen verlieren ihren Halt, was einerseits humorvoll, andererseits tiefsinnig wirkt.
Gegen Ende gewinnt das Gedicht eine persönliche, fast verspielte Note. Das Wandern ist nun auch Ausdruck von Liebesabenteuern, wechselnden Gefühlen, Begegnungen und Wetterlagen. Der Wanderer lebt mit allem, was kommt – ob Regen oder Sonne, ob hell oder dunkel, schön oder schlicht. Selbst das eigene Lied, das heute gedichtet wird und morgen vielleicht verspottet, unterliegt diesem ewigen Kreislauf.
„Große Wanderschaft“ vermittelt mit seiner eingängigen Form und der heiteren Sprache eine Lebensphilosophie des ständigen Aufbruchs. Das Gedicht feiert die Freiheit, sich nicht zu binden, offen zu bleiben für Neues und das Leben in seiner Vielfalt zu umarmen. Trotz aller Flüchtigkeit schwingt darin auch ein gewisser Trost: Wer sich dem Wandern hingibt, ist immer „zu Haus an jedem Ort“.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.