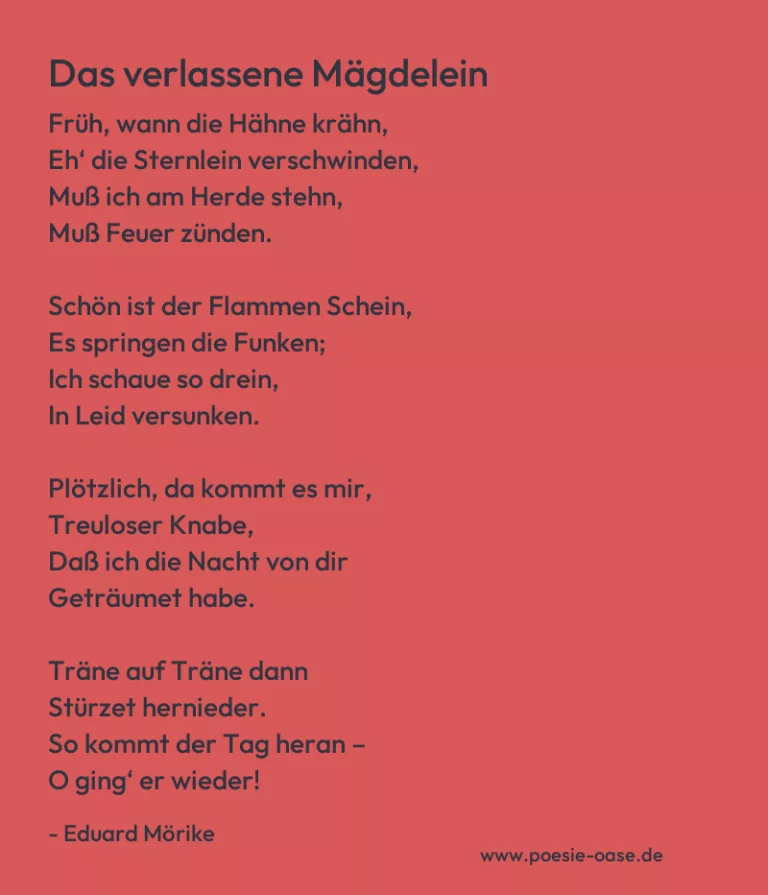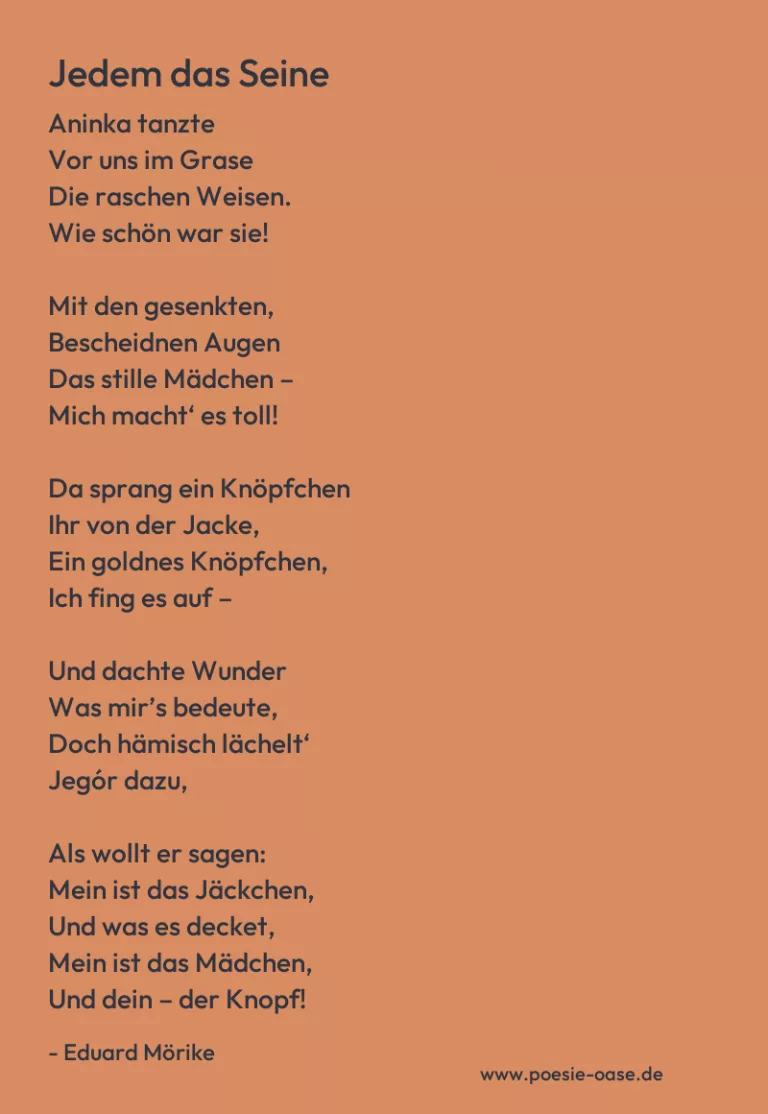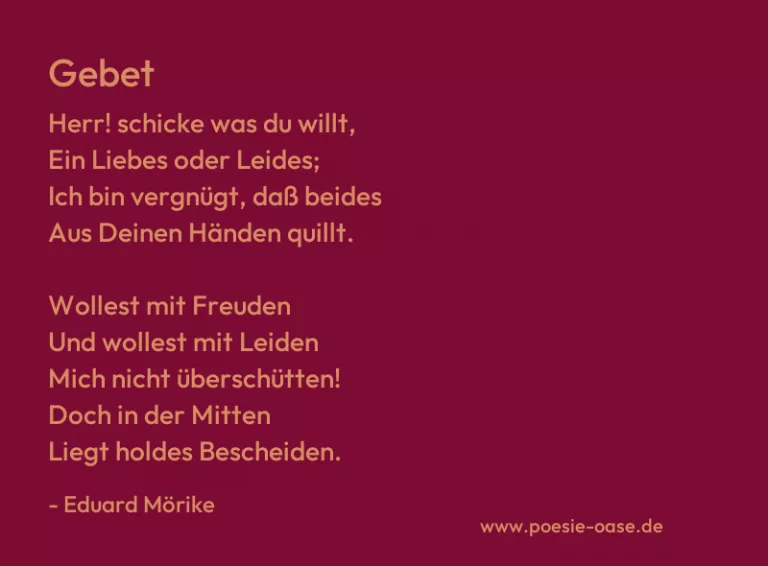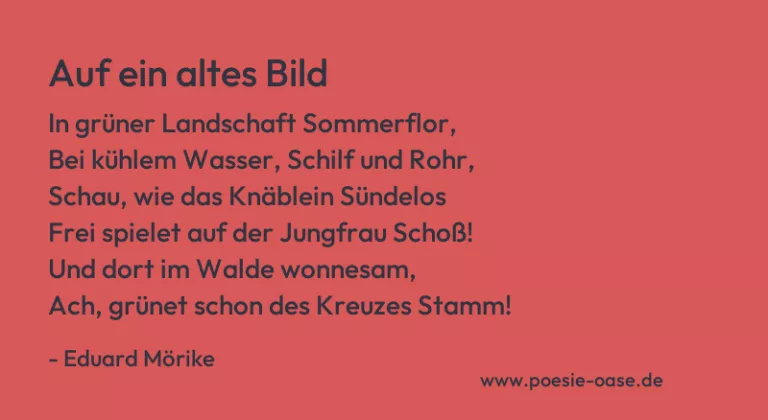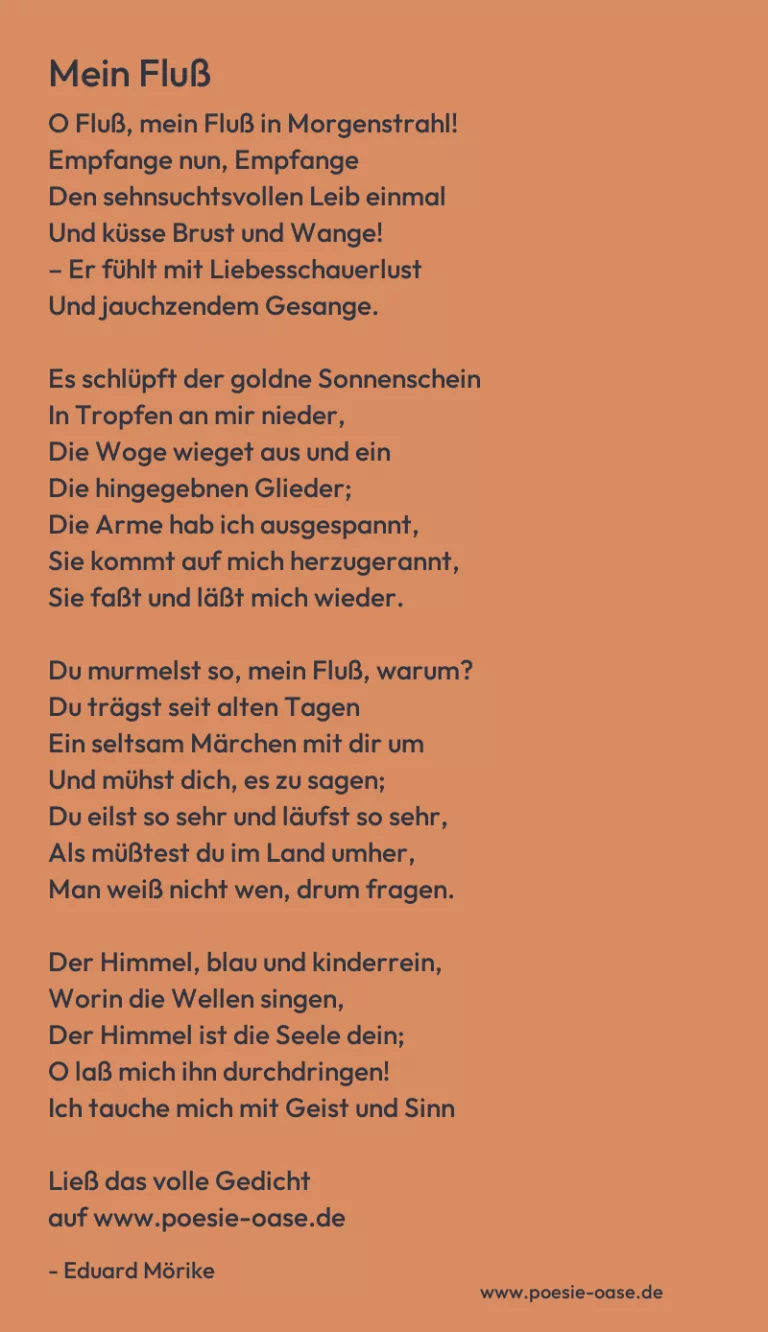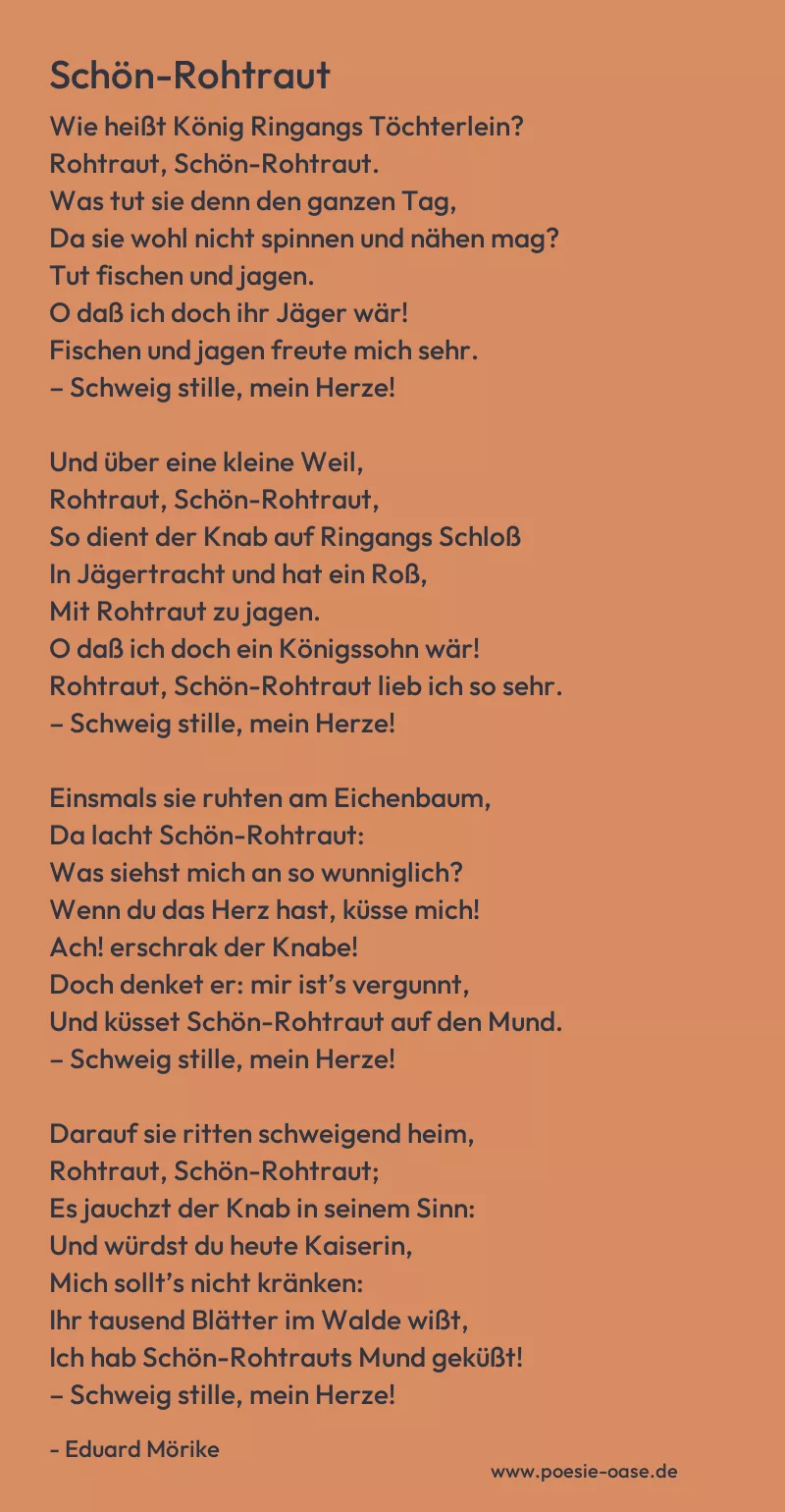Schön-Rohtraut
Wie heißt König Ringangs Töchterlein?
Rohtraut, Schön-Rohtraut.
Was tut sie denn den ganzen Tag,
Da sie wohl nicht spinnen und nähen mag?
Tut fischen und jagen.
O daß ich doch ihr Jäger wär!
Fischen und jagen freute mich sehr.
– Schweig stille, mein Herze!
Und über eine kleine Weil,
Rohtraut, Schön-Rohtraut,
So dient der Knab auf Ringangs Schloß
In Jägertracht und hat ein Roß,
Mit Rohtraut zu jagen.
O daß ich doch ein Königssohn wär!
Rohtraut, Schön-Rohtraut lieb ich so sehr.
– Schweig stille, mein Herze!
Einsmals sie ruhten am Eichenbaum,
Da lacht Schön-Rohtraut:
Was siehst mich an so wunniglich?
Wenn du das Herz hast, küsse mich!
Ach! erschrak der Knabe!
Doch denket er: mir ist’s vergunnt,
Und küsset Schön-Rohtraut auf den Mund.
– Schweig stille, mein Herze!
Darauf sie ritten schweigend heim,
Rohtraut, Schön-Rohtraut;
Es jauchzt der Knab in seinem Sinn:
Und würdst du heute Kaiserin,
Mich sollt’s nicht kränken:
Ihr tausend Blätter im Walde wißt,
Ich hab Schön-Rohtrauts Mund geküßt!
– Schweig stille, mein Herze!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
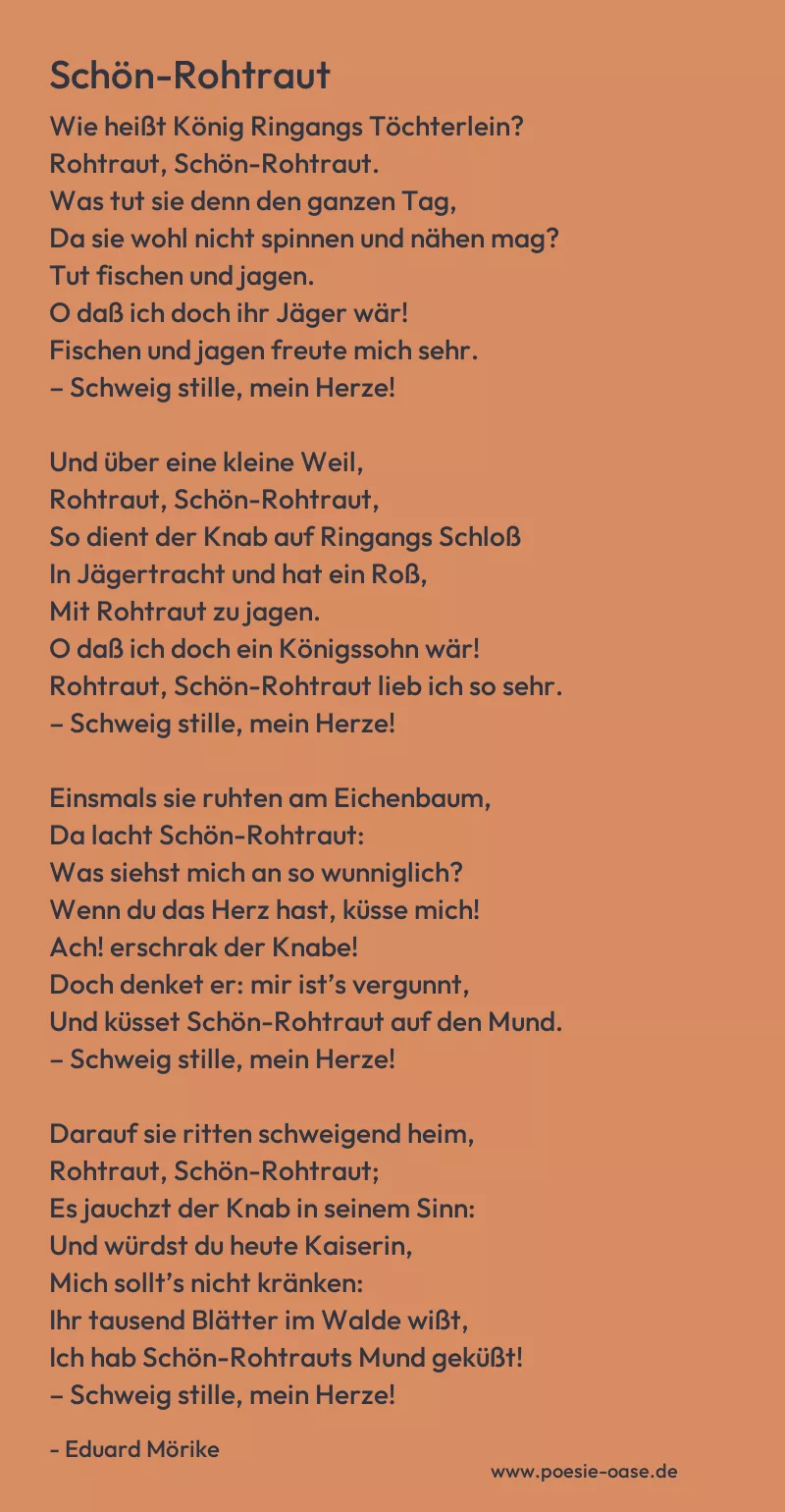
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Schön-Rohtraut“ von Eduard Mörike erzählt in balladenhafter Form die schwärmerische Liebesgeschichte eines jungen Mannes zur Königstochter Rohtraut. In vier Strophen entfaltet sich eine märchenhafte Handlung, die von Begehren, Mut und stiller Freude erzählt – mit einem immer wiederkehrenden Refrain: „– Schweig stille, mein Herze!“ Dieses leise Innehalten am Ende jeder Strophe verleiht dem Gedicht eine zarte, beinahe verschämte Intimität.
Im Zentrum steht ein einfacher Knabe, der die Königstochter zunächst nur aus der Ferne bewundert. Rohtraut, ungewöhnlich für ihr Standesbewusstsein, beschäftigt sich nicht mit höfischer Handarbeit, sondern mit „fischen und jagen“. Schon das verleiht ihr einen Hauch von Unkonventionalität und Freiheit – Eigenschaften, die das Ich faszinieren. Der Wunsch, ihr Jäger zu sein, entspringt einer Mischung aus romantischem Ideal und konkretem Begehren nach Nähe.
Die zweite Strophe beschreibt die Erfüllung dieses Wunsches: Der Knabe tritt in den Dienst des Königs und wird tatsächlich Jagdgefährte der Prinzessin. Damit verwebt Mörike Realität und romantische Sehnsucht – durch Mut und Hingabe wird das Unerreichbare greifbar. Doch das Liebesbekenntnis bleibt noch im Verborgenen, das Herz ist voller Gefühl, doch es wird durch den Refrain stets zur Stille gemahnt.
In der dritten Strophe kommt es zum Höhepunkt: In einer intimen Szene unter einem Eichenbaum fordert Rohtraut selbst zum Kuss auf. Ihre Selbstbestimmtheit ist bemerkenswert – sie handelt aktiv, stellt das Spiel der höfischen Konventionen auf den Kopf. Der Knabe erschrickt zwar, gibt sich jedoch der Situation hin – ein Moment der Vereinigung, zart und kraftvoll zugleich. Der Kuss ist die Erfüllung des Traums, doch auch dieser Augenblick wird nicht laut bejubelt, sondern innerlich bewegt erfahren.
Die letzte Strophe schildert die Rückkehr in den Alltag, aber mit einem verwandelten Inneren: Der Knabe jubelt still in sich hinein, denn nichts, nicht einmal Rohtrauts mögliche Heirat mit einem Kaiser, könnte das Erlebte schmälern. Der Kuss bleibt sein größter Schatz, getragen von einem tiefen, stillen Glück.
„Schön-Rohtraut“ ist ein feines, poetisches Märchen über unerwartete Nähe zwischen Standesunterschieden, über den Mut zur Liebe und die stille Freude am erfüllten Wunsch. Mörike gelingt es, in schlichter Sprache und klarer Struktur ein romantisches Ideal zu gestalten, das gleichermaßen sinnlich wie zurückhaltend ist – voller Empfindung, aber frei von Pathos.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.