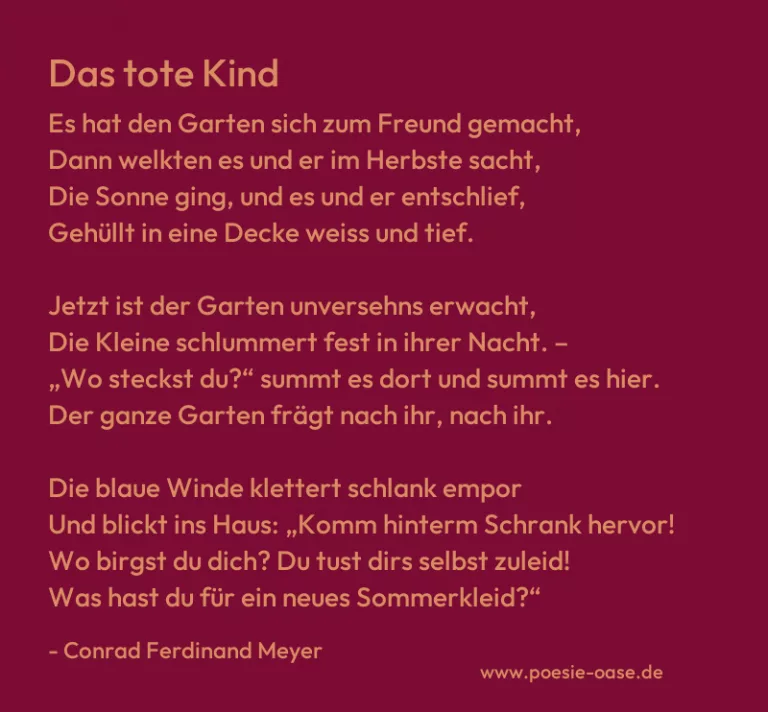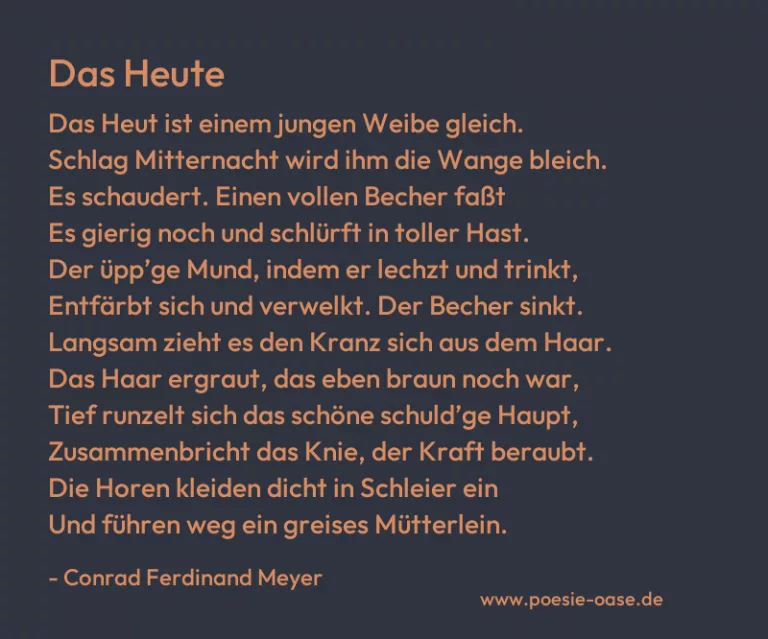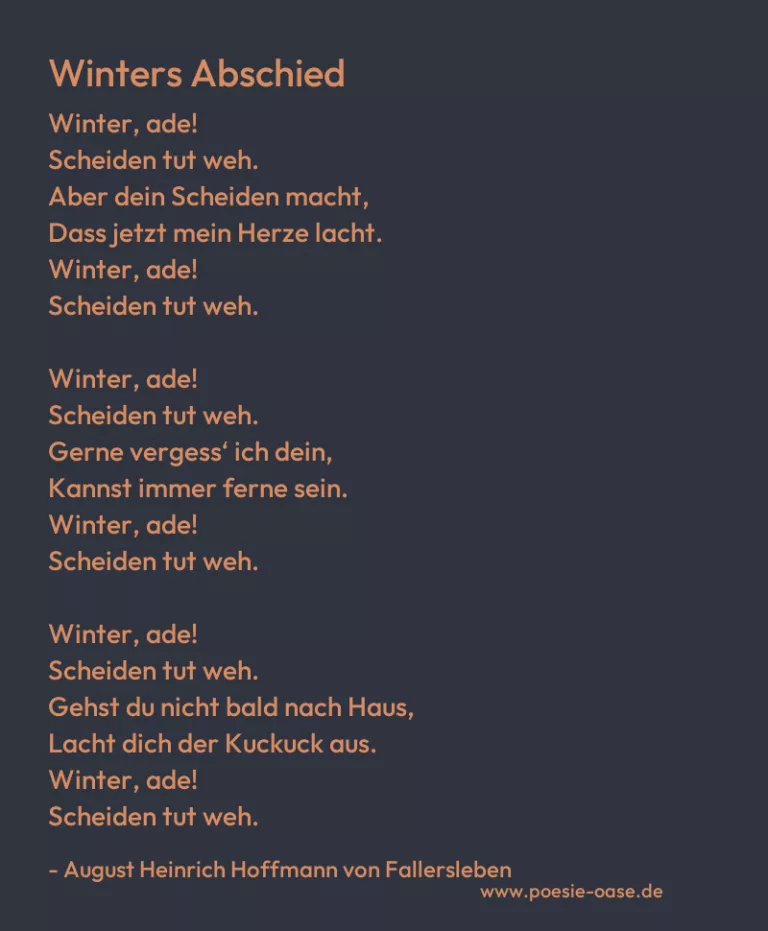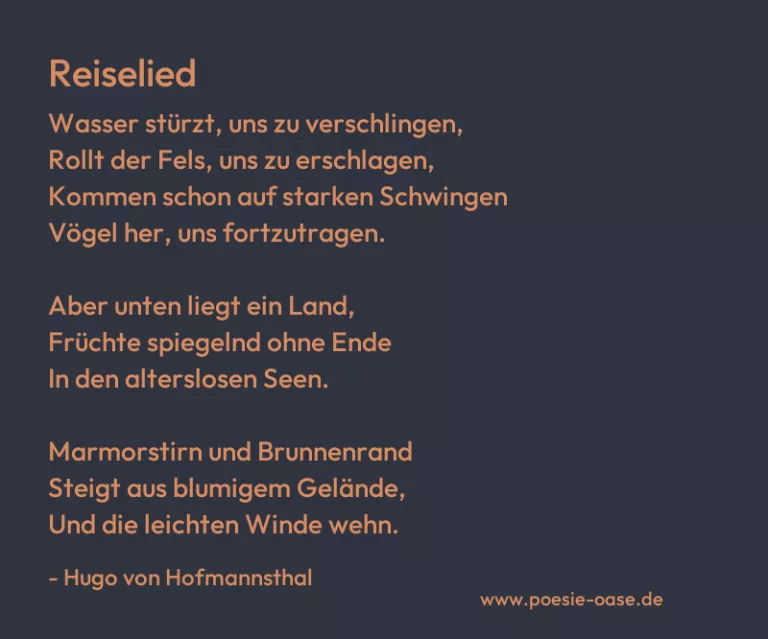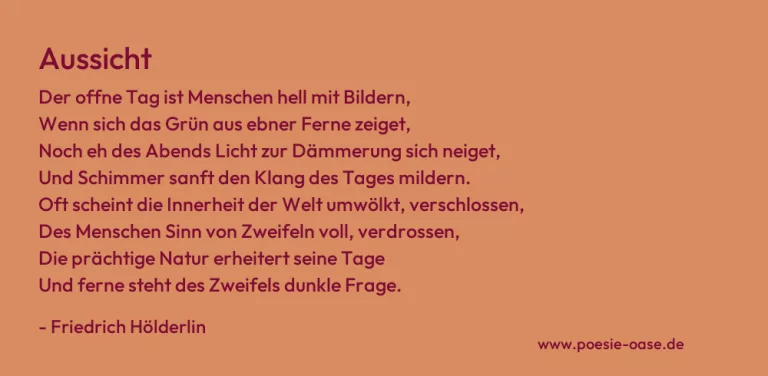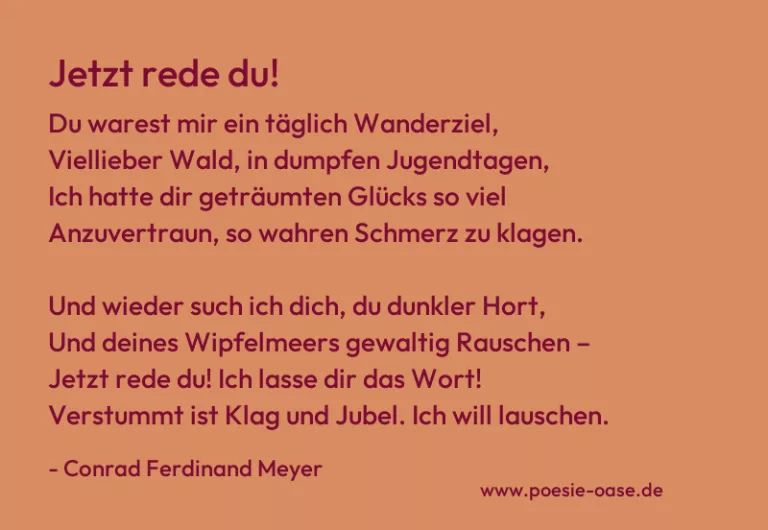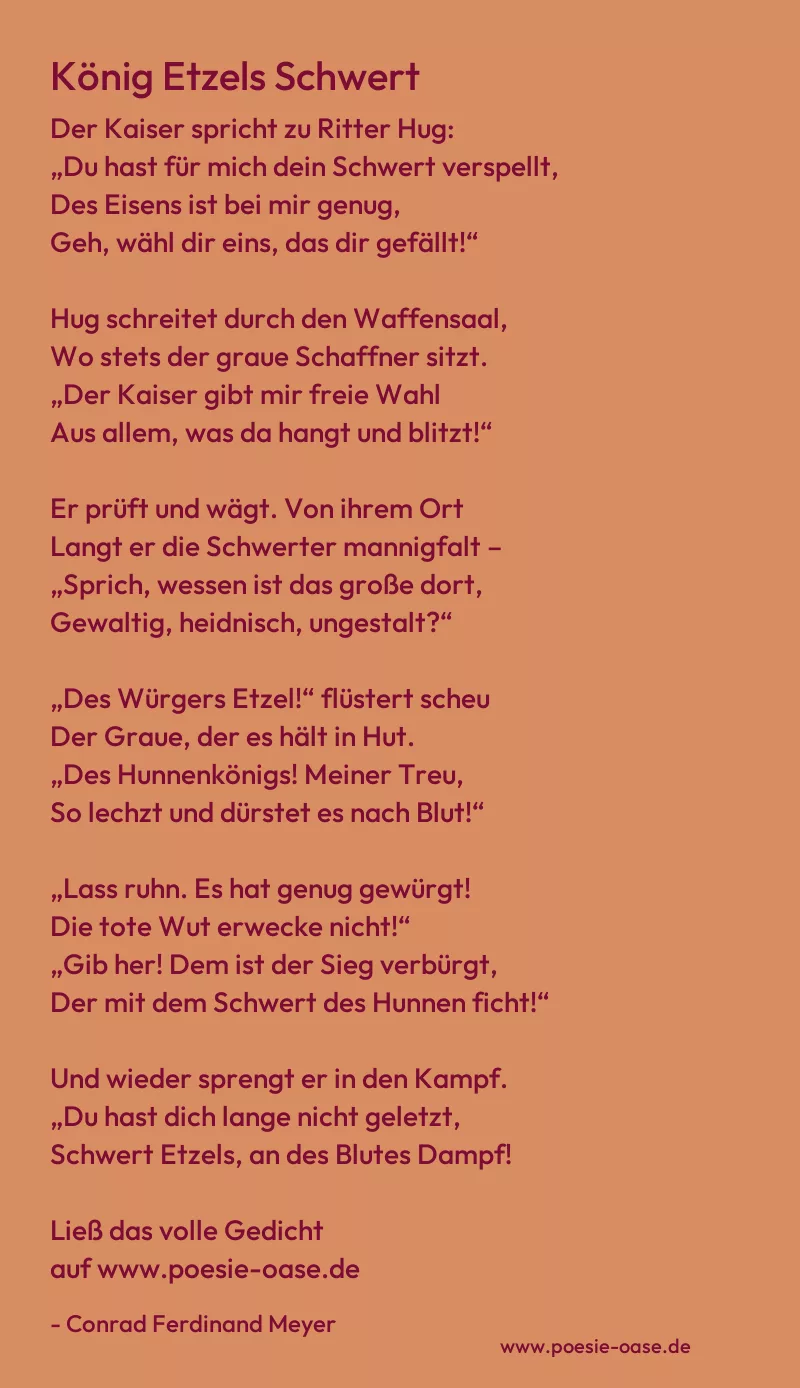Der Kaiser spricht zu Ritter Hug:
„Du hast für mich dein Schwert verspellt,
Des Eisens ist bei mir genug,
Geh, wähl dir eins, das dir gefällt!“
Hug schreitet durch den Waffensaal,
Wo stets der graue Schaffner sitzt.
„Der Kaiser gibt mir freie Wahl
Aus allem, was da hangt und blitzt!“
Er prüft und wägt. Von ihrem Ort
Langt er die Schwerter mannigfalt –
„Sprich, wessen ist das große dort,
Gewaltig, heidnisch, ungestalt?“
„Des Würgers Etzel!“ flüstert scheu
Der Graue, der es hält in Hut.
„Des Hunnenkönigs! Meiner Treu,
So lechzt und dürstet es nach Blut!“
„Lass ruhn. Es hat genug gewürgt!
Die tote Wut erwecke nicht!“
„Gib her! Dem ist der Sieg verbürgt,
Der mit dem Schwert des Hunnen ficht!“
Und wieder sprengt er in den Kampf.
„Du hast dich lange nicht geletzt,
Schwert Etzels, an des Blutes Dampf!
Drum freue dich und trinke jetzt!“
Er schwingt es weit, er mäht und mäht
Und Etzels Schwert, es schwelgt und trinkt,
Bis müd die Sonne niedergeht
Und hinter rote Wolken sinkt.
Als längst er schon im Mondlicht braust,
Wird ihm der Arm vom Schlagen matt,
Er frägt das Schwert in seiner Faust:
„Schwert Etzels, bist noch nicht du satt?
Lass ab! Heut ist genug getan!“
Doch weh, es weiß von keiner Rast,
Es hebt ein neues Morden an
Und trifft und frisst, was es erfasst.
„Lass ab!“ Es zuckt in grauser Lust,
Der Ritter stürzt mit seinem Pferd
Und jubelnd sticht ihn durch die Brust
Des Hunnen unersättlich Schwert.