Gefurzt wird immer in der Nacht,
und immer so, daß es schön kracht.
Gefurzt wird immer in der Nacht…
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
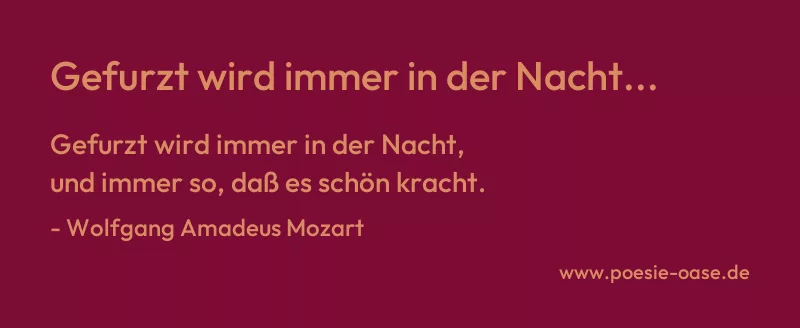
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Gefurzt wird immer in der Nacht…“ von Wolfgang Amadeus Mozart ist ein kurzes, humoristisches Werk, das sich dem trivialen, aber allgegenwärtigen Thema des nächtlichen Furzens widmet. Die Direktheit und Unverblümtheit des Ausdrucks stehen im Kontrast zu Mozarts sonstigem Schaffen und verleihen dem Gedicht eine besondere, fast subversive Note. Es bricht mit Erwartungen an den Komponisten klassischer Musik und zeigt eine unkonventionelle, spielerische Seite.
Die einfache Struktur und der Reim tragen zur Komik des Gedichts bei. Die Formulierung „Gefurzt wird immer in der Nacht“ impliziert eine unumstößliche Gewissheit, eine Art Naturgesetz des menschlichen Daseins. Das Adjektiv „schön“ in Verbindung mit dem Verb „kracht“ verstärkt den humoristischen Effekt, indem es dem eigentlich unfeinen Vorgang eine positive Konnotation verleiht. Es spielt mit der Absurdität, eine banale Körperfunktion ästhetisch zu überhöhen.
Das Gedicht lässt Raum für verschiedene Interpretationen. Es könnte als humorvolle Kritik an gesellschaftlichen Konventionen und Tabus verstanden werden, die bestimmte Körperfunktionen als unanständig stigmatisieren. Mozart scheint sich über diese Konventionen hinwegzusetzen und die Normalität des Furzens zu betonen. Es kann aber auch schlichtweg als ein Ausdruck von Albernheit und Lebensfreude interpretiert werden, ein Beweis dafür, dass auch große Künstler Momente der Unbeschwertheit und des kindlichen Humors haben. Die Kürze des Gedichts konzentriert die komische Wirkung und macht es zu einem prägnanten, humorvollen Einwurf.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
