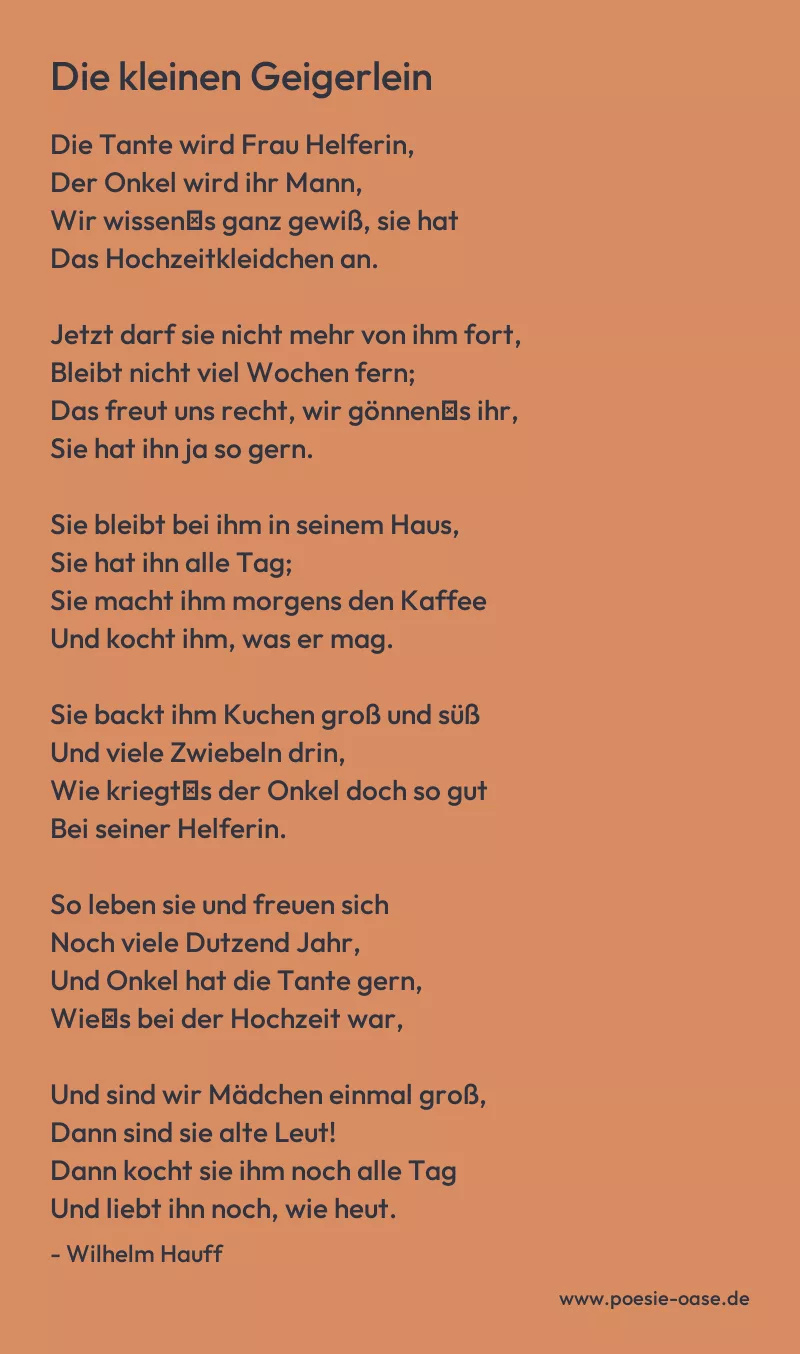Die kleinen Geigerlein
Die Tante wird Frau Helferin,
Der Onkel wird ihr Mann,
Wir wissen′s ganz gewiß, sie hat
Das Hochzeitkleidchen an.
Jetzt darf sie nicht mehr von ihm fort,
Bleibt nicht viel Wochen fern;
Das freut uns recht, wir gönnen′s ihr,
Sie hat ihn ja so gern.
Sie bleibt bei ihm in seinem Haus,
Sie hat ihn alle Tag;
Sie macht ihm morgens den Kaffee
Und kocht ihm, was er mag.
Sie backt ihm Kuchen groß und süß
Und viele Zwiebeln drin,
Wie kriegt′s der Onkel doch so gut
Bei seiner Helferin.
So leben sie und freuen sich
Noch viele Dutzend Jahr,
Und Onkel hat die Tante gern,
Wie′s bei der Hochzeit war,
Und sind wir Mädchen einmal groß,
Dann sind sie alte Leut!
Dann kocht sie ihm noch alle Tag
Und liebt ihn noch, wie heut.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
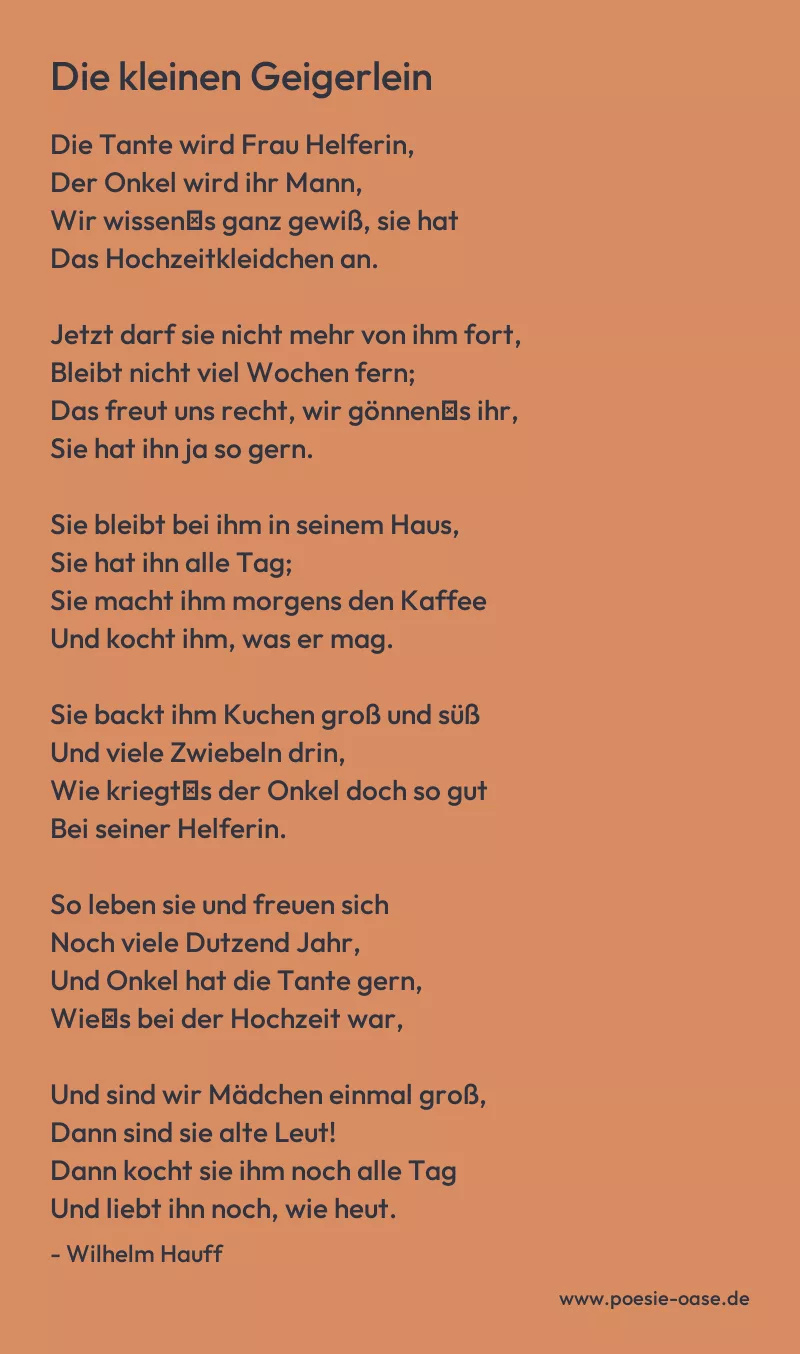
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die kleinen Geigerlein“ von Wilhelm Hauff zeichnet ein idyllisches Bild einer beständigen, harmonischen Ehe aus der Perspektive von Kindern. Es ist ein schlichtes, heiteres Gedicht, das die Freude und den Respekt junger Beobachter gegenüber der Beziehung zwischen der „Tante“ und dem „Onkel“ widerspiegelt. Die wiederholten Aussagen, wie „Wir wissen’s ganz gewiß“, unterstreichen die kindliche Gewissheit und das ungetrübte Vertrauen in die Stabilität der ehelichen Bindung.
Das Gedicht konzentriert sich auf die alltäglichen Aspekte des Ehelebens: die gemeinsame Zeit im Haus, die gegenseitige Fürsorge, manifestiert durch das Zubereiten des Kaffees und der Lieblingsgerichte, sowie die Zuneigung, die die Eheleute füreinander empfinden. Die Beschreibung des Backens von Kuchen mit Zwiebeln mag aus kindlicher Perspektive ungewöhnlich erscheinen, verdeutlicht aber die Hingabe der Tante an den Onkel und ihre Bemühungen, ihn glücklich zu machen. Die „viele Zwiebeln drin“ werden dabei fast schon als ein Zeichen der Liebe und des guten Essens dargestellt.
Die Zeitlosigkeit der Liebe wird durch die Wiederholung des Anfangszustands am Ende des Gedichts betont. Die Aussage „Und Onkel hat die Tante gern, / Wie’s bei der Hochzeit war“ und der Hinweis darauf, dass die Tante auch im Alter weiterhin kocht und liebt, verstärken den Eindruck einer unerschütterlichen und anhaltenden Zuneigung. Diese Vorstellung von einem beständigen Glück ist besonders aus der Perspektive der Kinder wichtig, die eine heile Welt sehen und die Geborgenheit einer funktionierenden Familie bewundern.
Die Sprache des Gedichts ist einfach und kindgerecht, was die kindliche Perspektive und die Einfachheit der dargebotenen Glücksvorstellung unterstreicht. Durch die Wiederholungen und die Reime wird das Gedicht leicht verständlich und einprägsam. Das Gedicht vermittelt ein Gefühl von Wärme, Geborgenheit und Hoffnung auf eine ebenso liebevolle und dauerhafte Beziehung, wie sie von den Kindern wahrgenommen wird. Es ist ein Loblied auf die Ehe, gesehen durch die Augen der kindlichen Bewunderung.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.