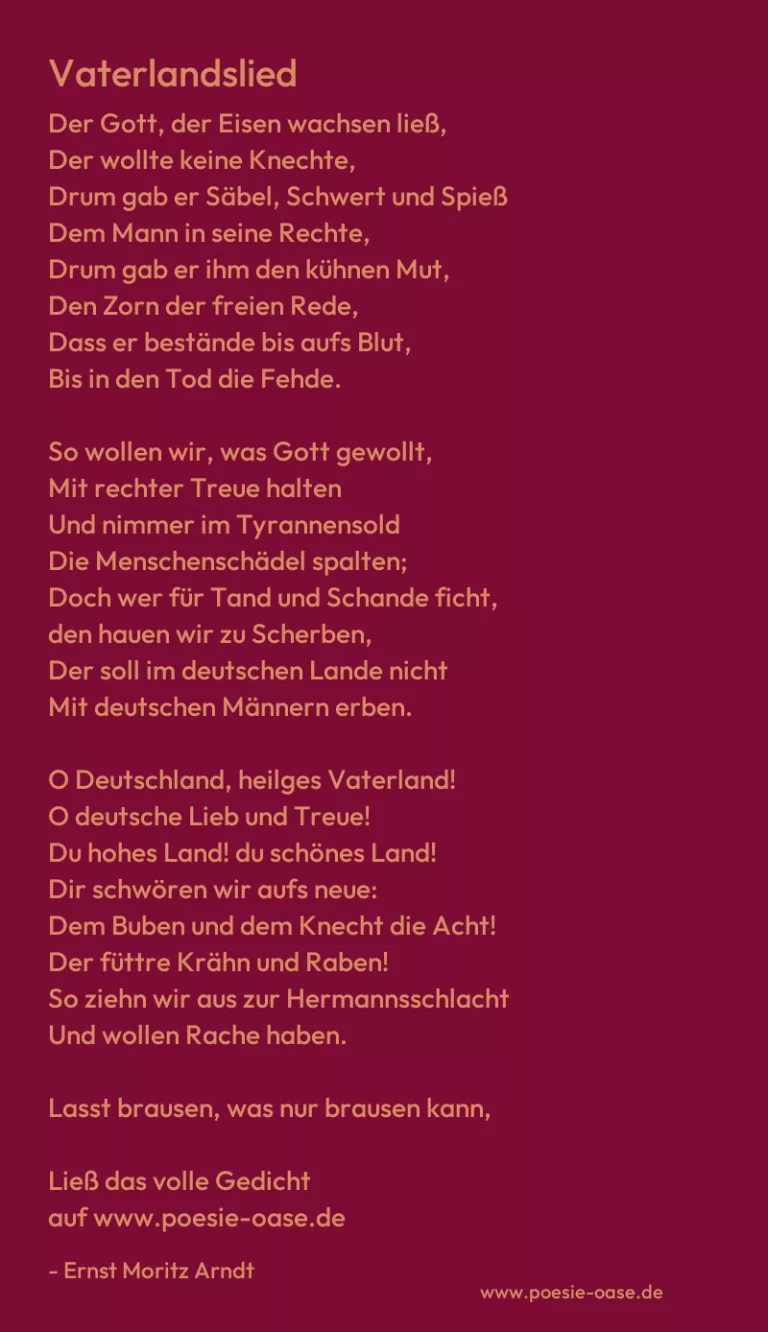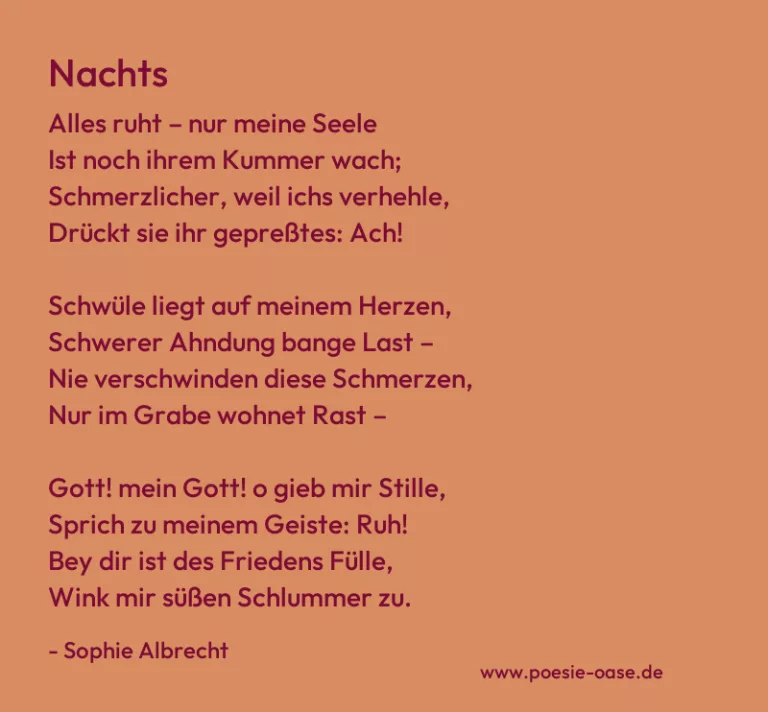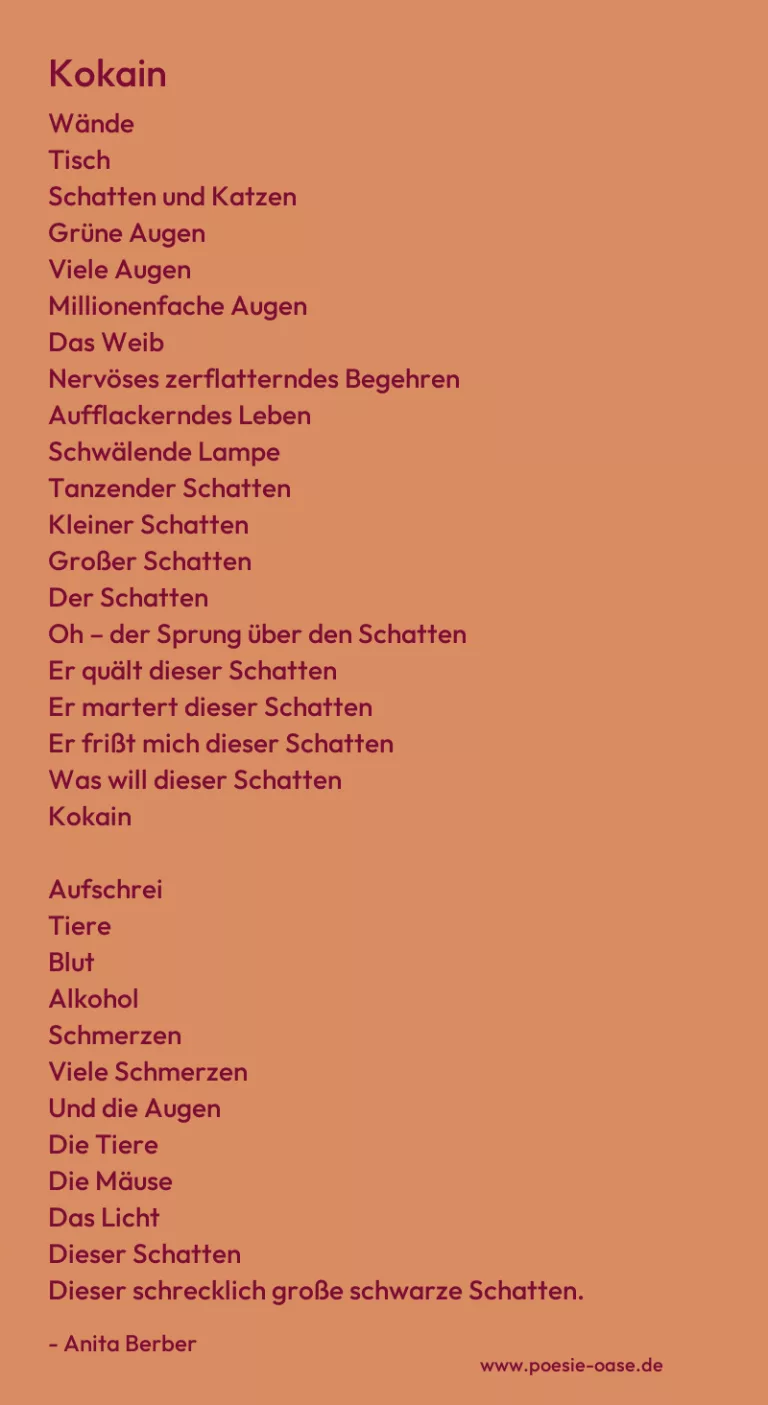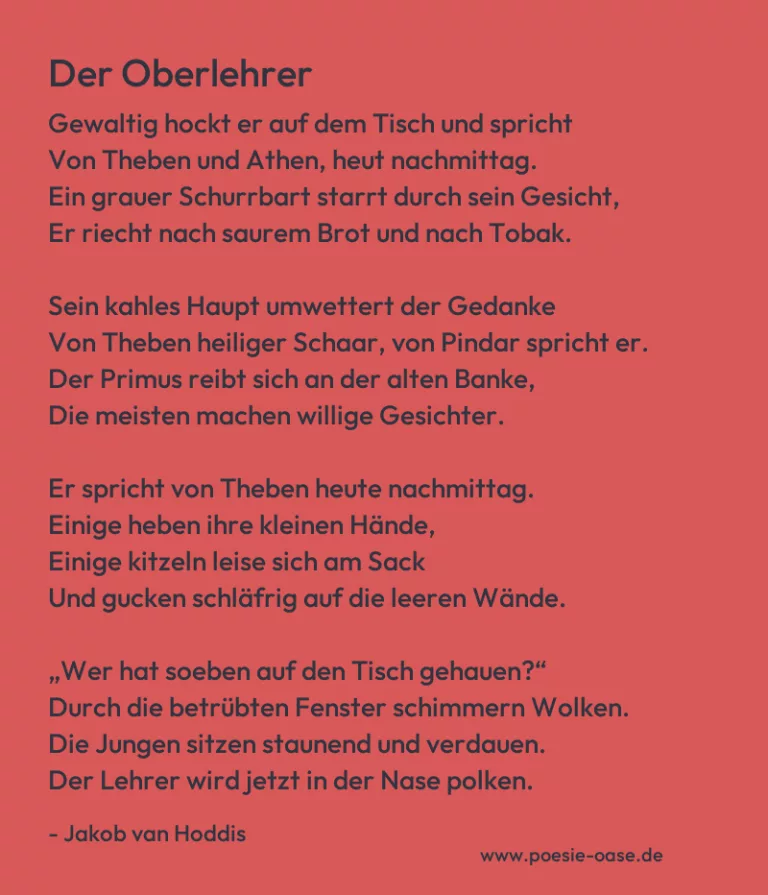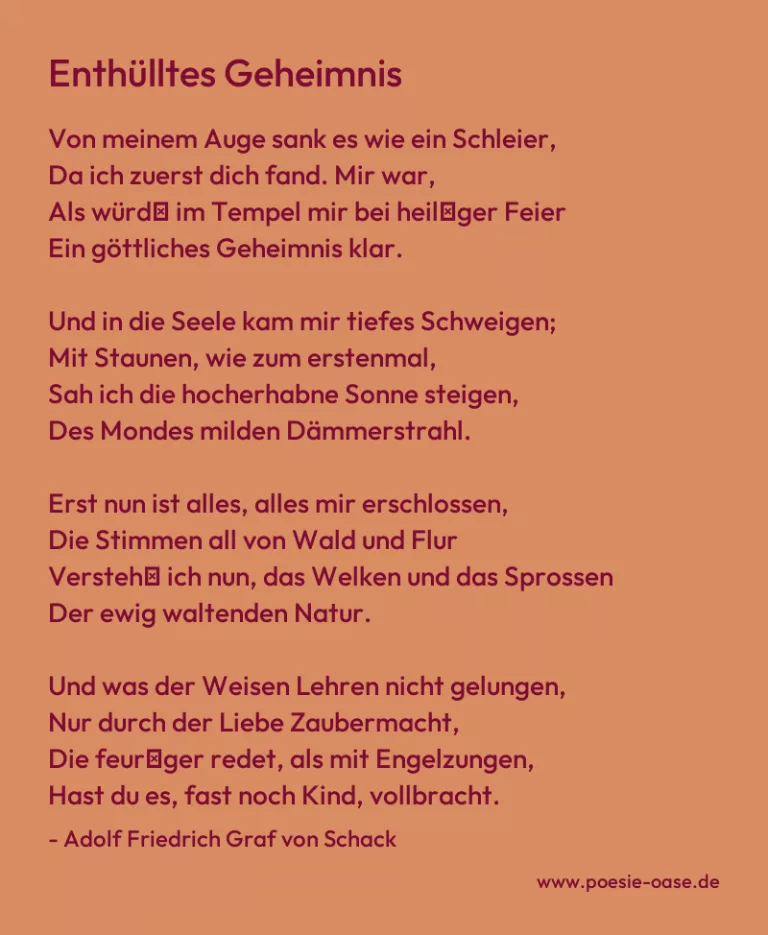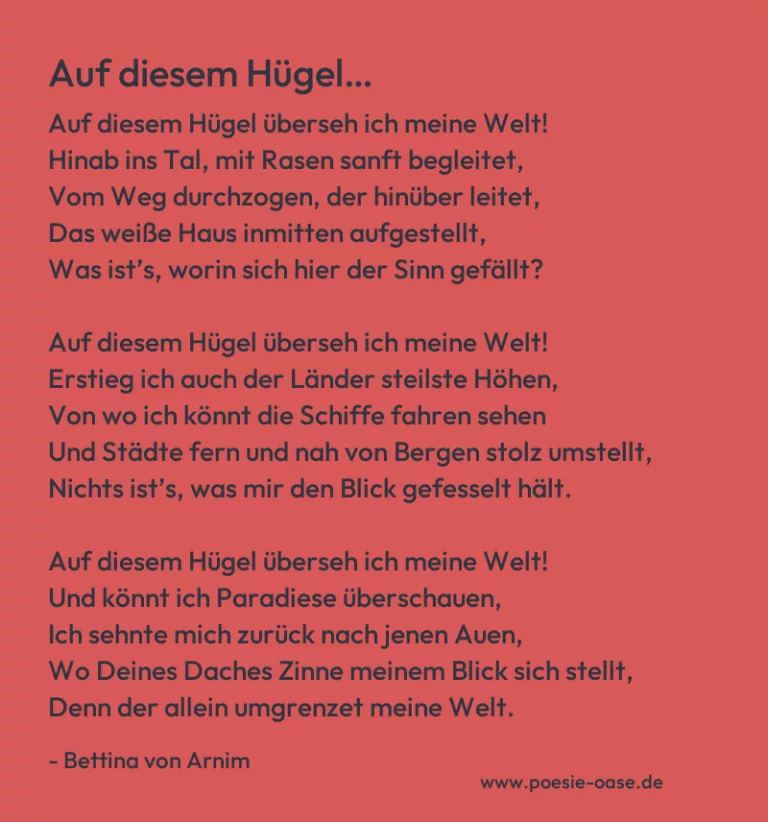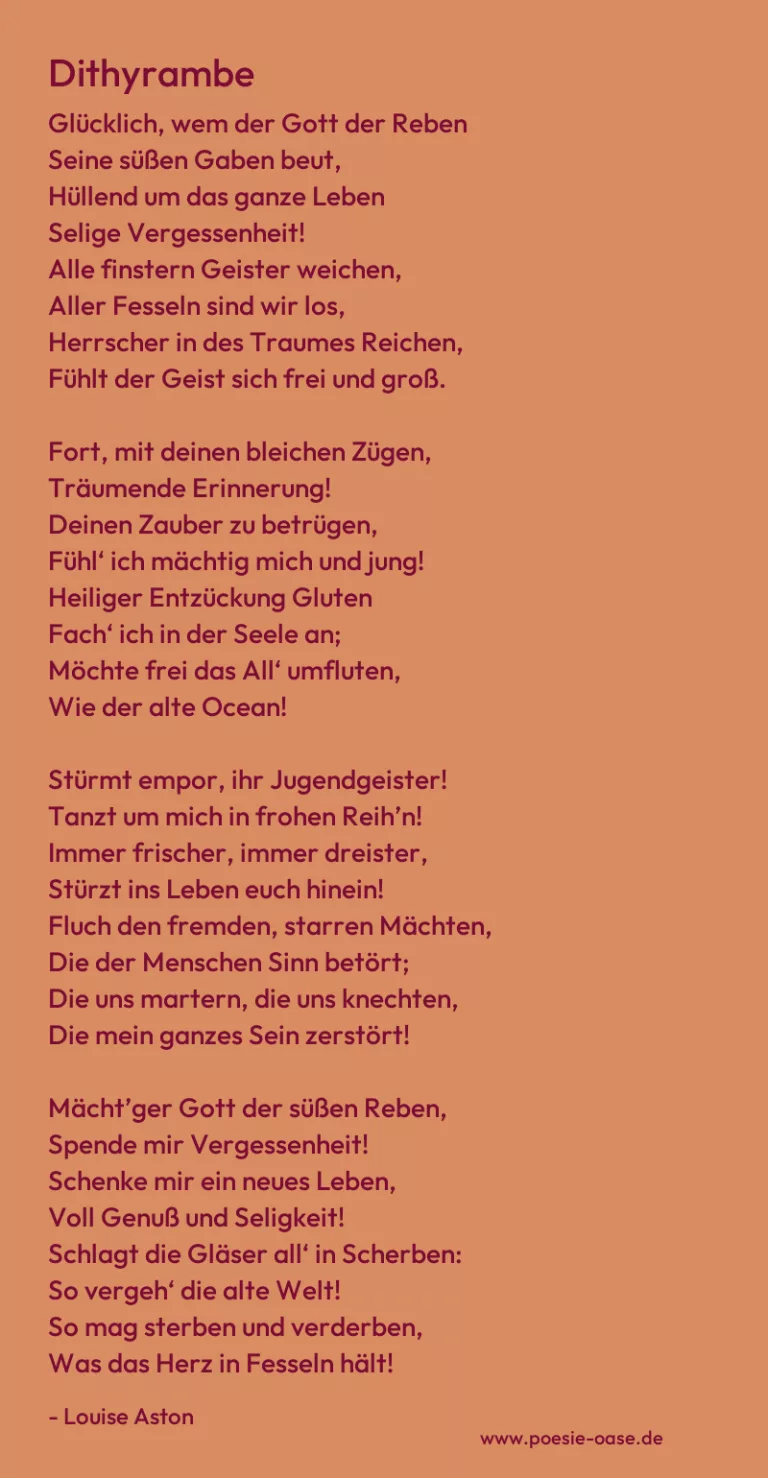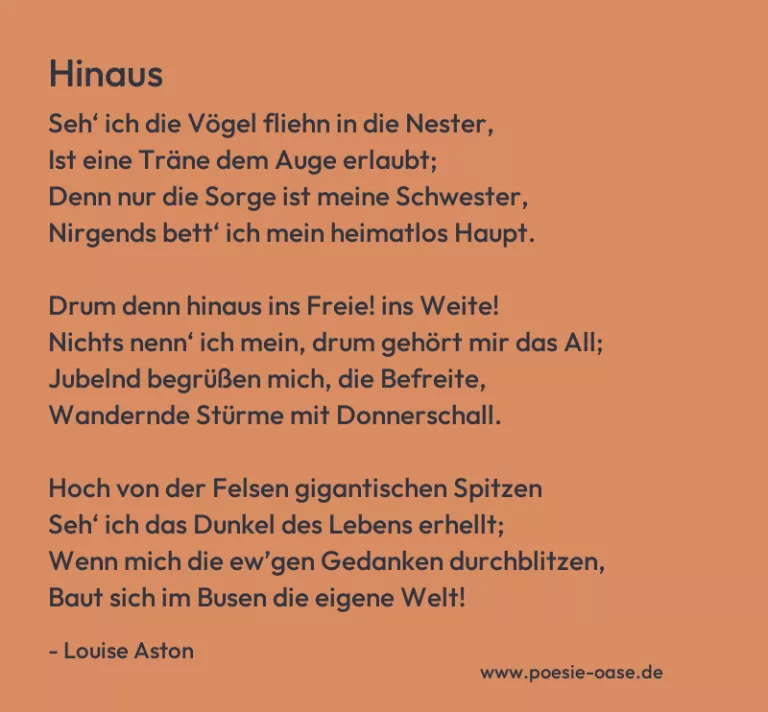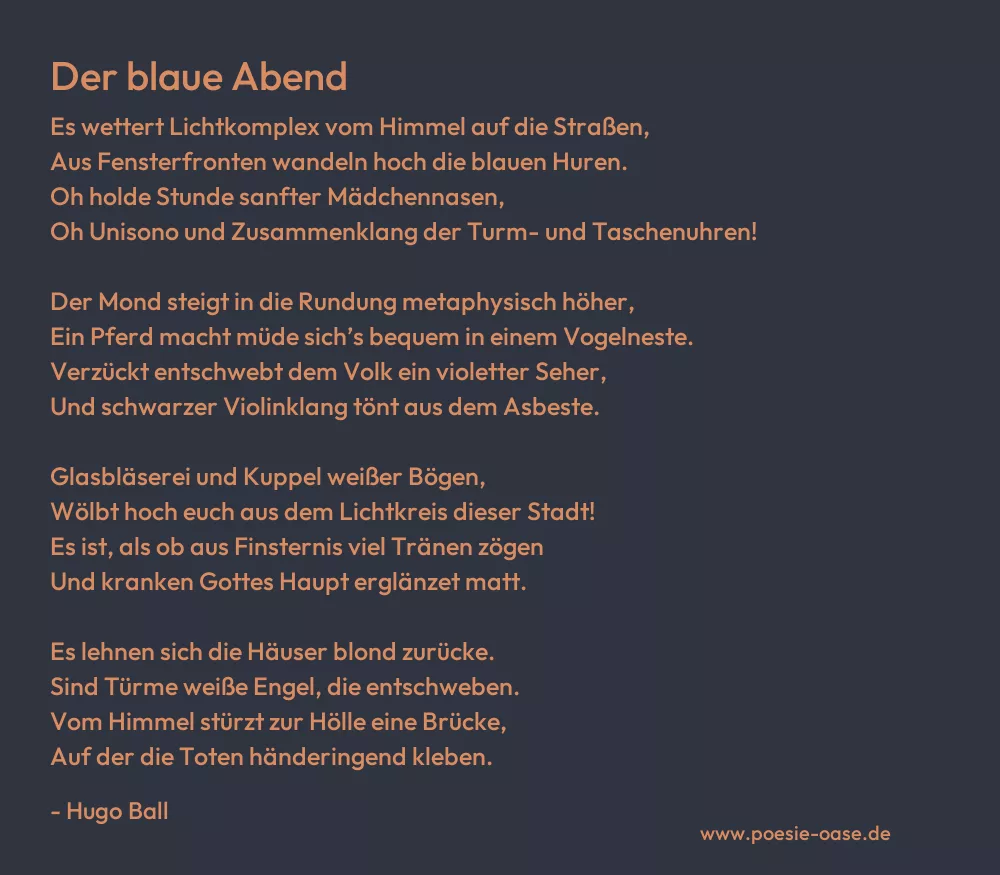Der blaue Abend
Es wettert Lichtkomplex vom Himmel auf die Straßen,
Aus Fensterfronten wandeln hoch die blauen Huren.
Oh holde Stunde sanfter Mädchennasen,
Oh Unisono und Zusammenklang der Turm- und Taschenuhren!
Der Mond steigt in die Rundung metaphysisch höher,
Ein Pferd macht müde sich’s bequem in einem Vogelneste.
Verzückt entschwebt dem Volk ein violetter Seher,
Und schwarzer Violinklang tönt aus dem Asbeste.
Glasbläserei und Kuppel weißer Bögen,
Wölbt hoch euch aus dem Lichtkreis dieser Stadt!
Es ist, als ob aus Finsternis viel Tränen zögen
Und kranken Gottes Haupt erglänzet matt.
Es lehnen sich die Häuser blond zurücke.
Sind Türme weiße Engel, die entschweben.
Vom Himmel stürzt zur Hölle eine Brücke,
Auf der die Toten händeringend kleben.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
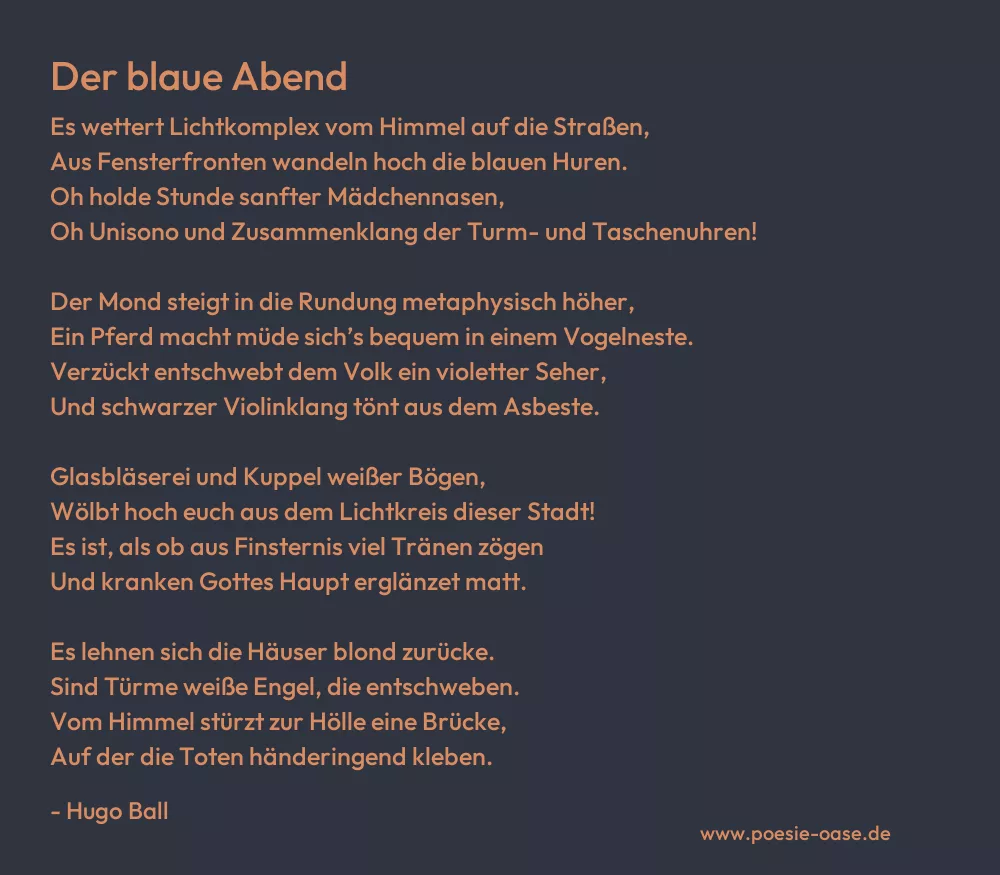
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der blaue Abend“ von Hugo Ball ist ein expressives Werk, das mit surrealen und symbolischen Bildern eine düstere, fast mystische Atmosphäre erschafft. Zu Beginn wird eine fast halluzinogene Szenerie beschrieben, in der Lichtkomplexe auf die Straßen regnen und Fensterfronten von „blauen Huren“ bewandert werden. Diese unklaren und verführerischen Bilder schaffen eine Welt der Zerrissenheit und des Zwielichts, die gleichzeitig Faszination und Gefahr ausstrahlt. Der Titel „blauer Abend“ verweist auf einen Zustand der Melancholie, der sich durch das ganze Gedicht zieht.
Die zweite Strophe intensifiziert diesen Eindruck, indem sie metaphysische und teils absurde Vorstellungen von der Natur und den Menschen vermittelt. Der Mond steigt „metaphysisch höher“ und ein „Pferd“ findet in einem „Vogelnest“ Ruhe. Der violette Seher, der „verzückt“ entschwebt, verweist auf eine mystische Einsicht oder Vision, die aus einer anderen Dimension zu stammen scheint. Der „schwarze Violinklang“ und der Bezug auf Asbest deuten auf ein Unbehagen und eine drohende Zerstörung hin. Hier werden die klanglichen und visuellen Eindrücke zu einer Art innere Zerrissenheit, die die Welt aus den Fugen geraten lässt.
In der dritten Strophe wird das Bild der Stadt als eine schimmernde, aber zugleich trügerische Konstruktion dargestellt. Die „Glasbläserei“ und die „Kuppel weißer Bögen“ erscheinen wie ein glänzendes, aber zerbrechliches Konstrukt, das sich aus dem Lichtkreis dieser Stadt erhebt. Diese architektonischen Bilder symbolisieren den Versuch, Schönheit und Ordnung zu schaffen, der jedoch von der Dunkelheit und dem Verfall begleitet wird. Der „kranke Gottes Kopf“ und das Bild von Tränen aus der Finsternis betonen das Leiden und die Unvollständigkeit dieser Welt.
Die letzte Strophe bringt die düstere Bildwelt des Gedichts auf einen Höhepunkt. Die Häuser, die sich „blond zurücklehnen“, und die „weißen Engel“, die entschweben, verweben sich zu einem Bild des Verfalls und der Entkörperlichung. Die „Brücke“ von Himmel zur Hölle, auf der „die Toten händeringend kleben“, deutet auf den unausweichlichen Übergang und das Ende der Welt hin. Diese letzte Vision verstärkt die Idee einer düsteren und verfallenden Welt, in der das Leben und der Tod in einem fragilen Gleichgewicht stehen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.