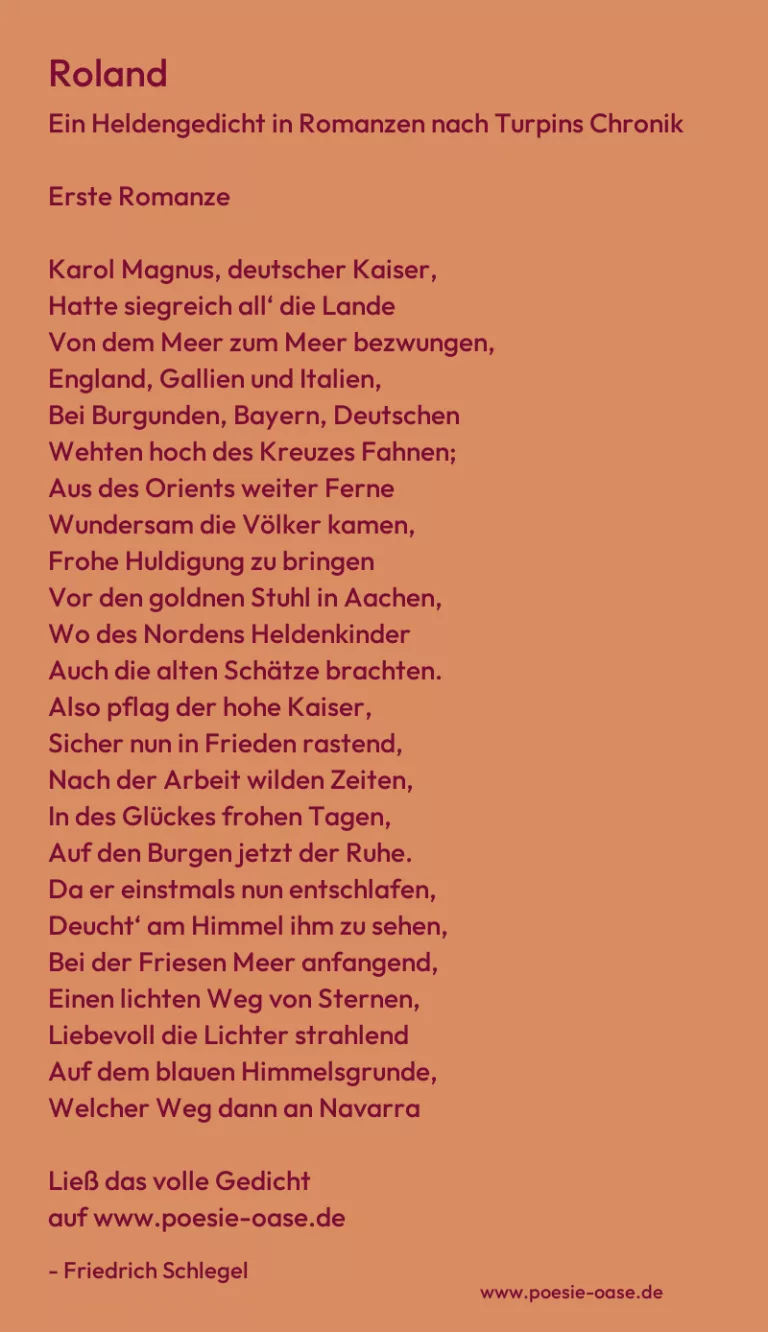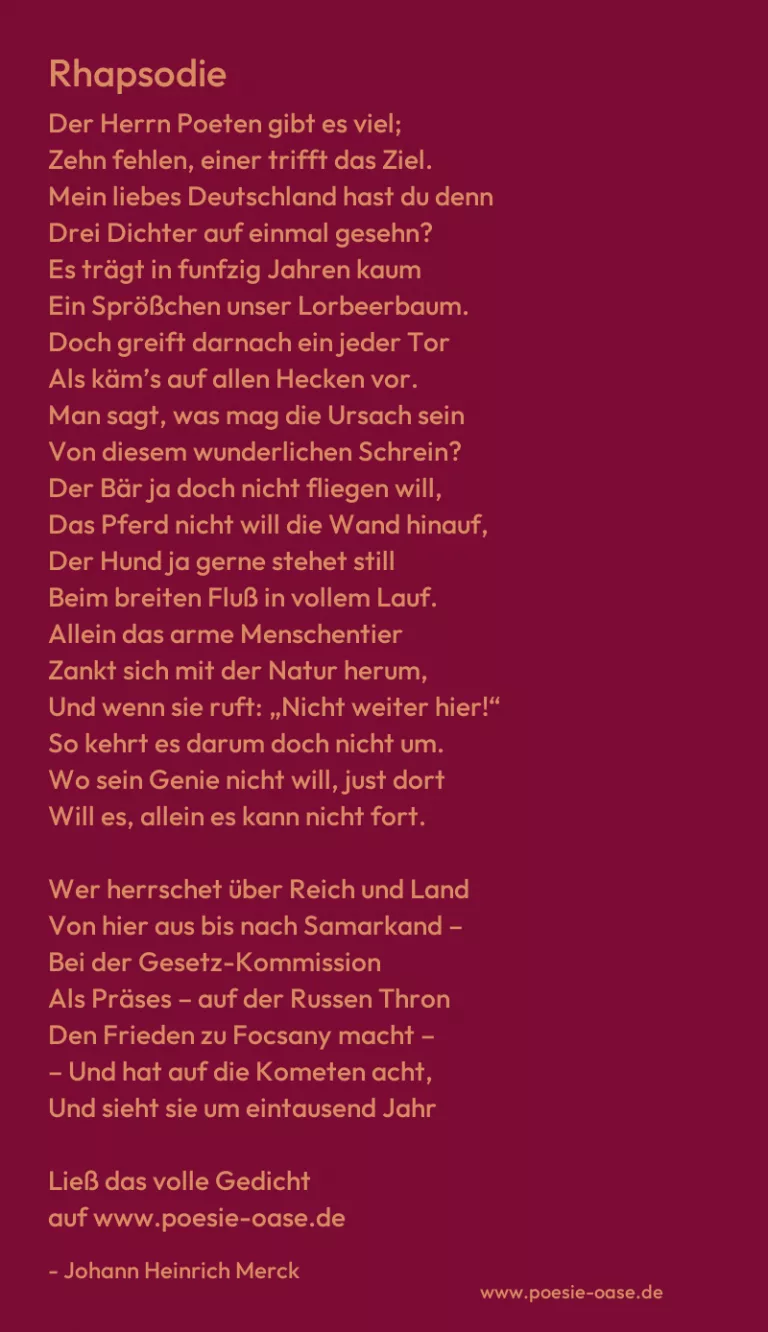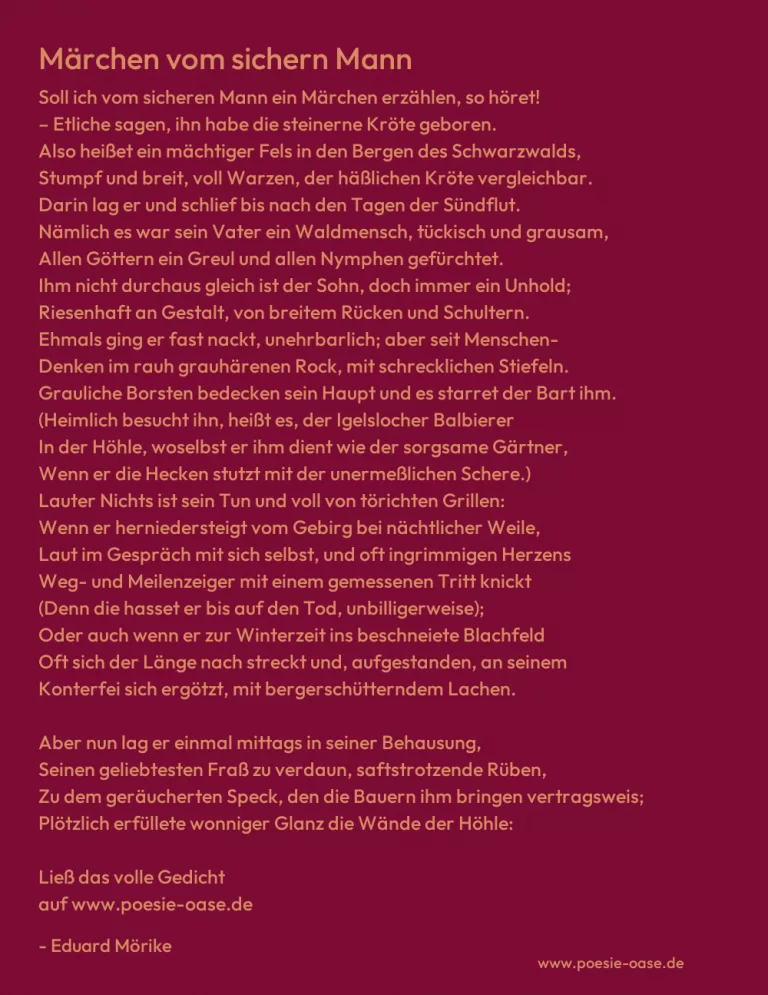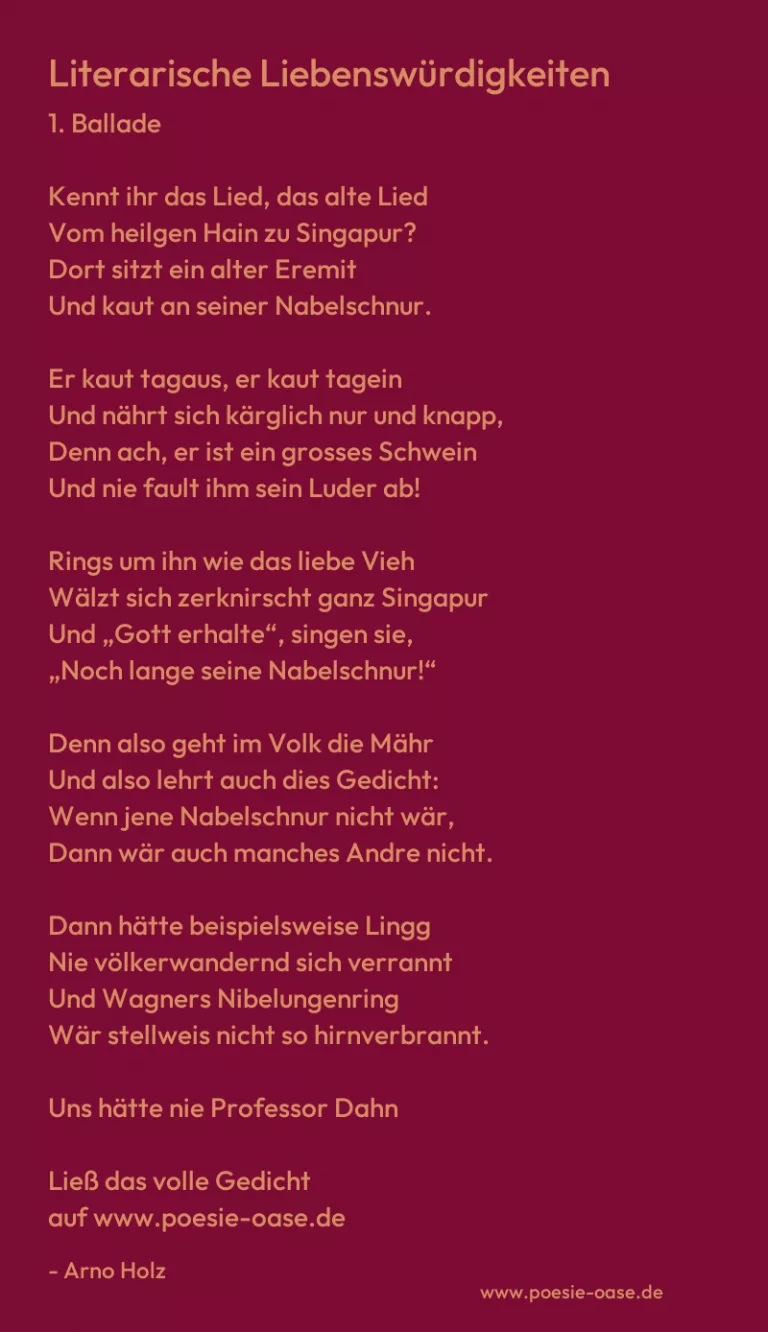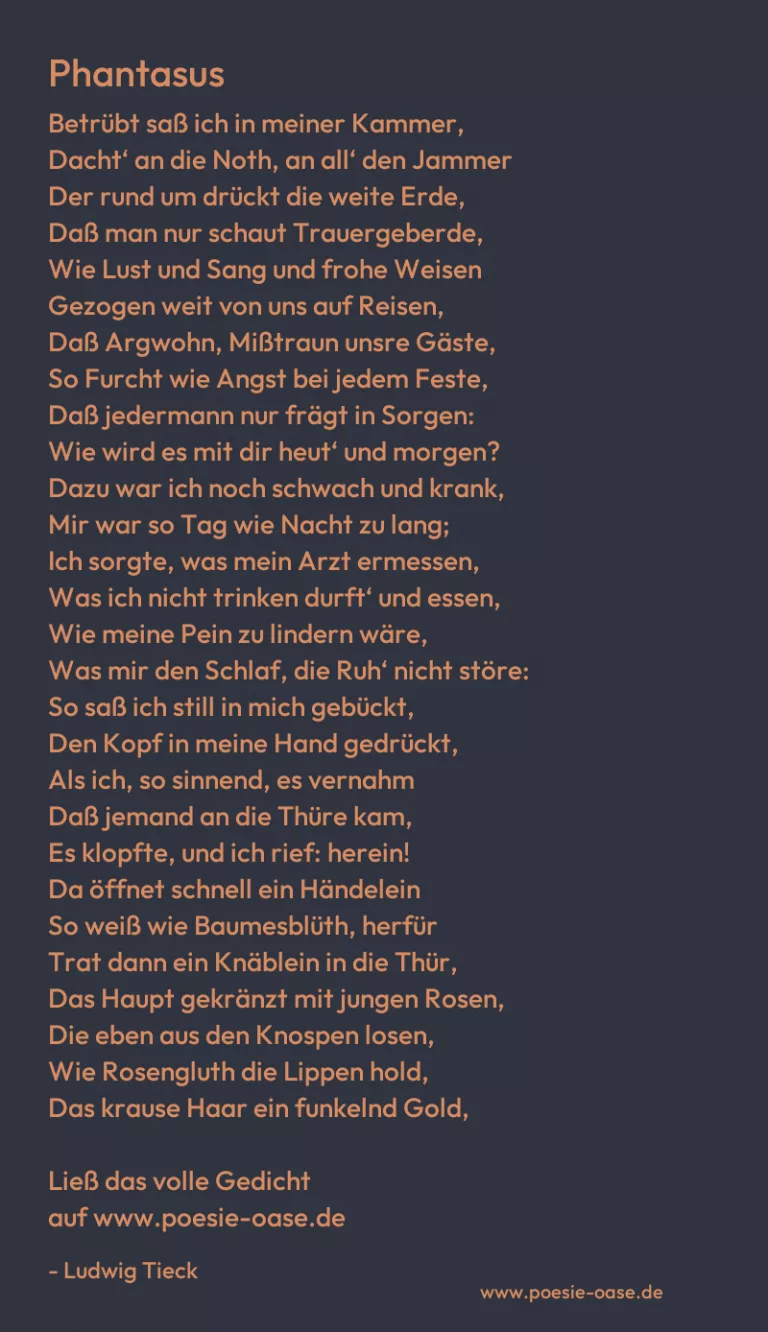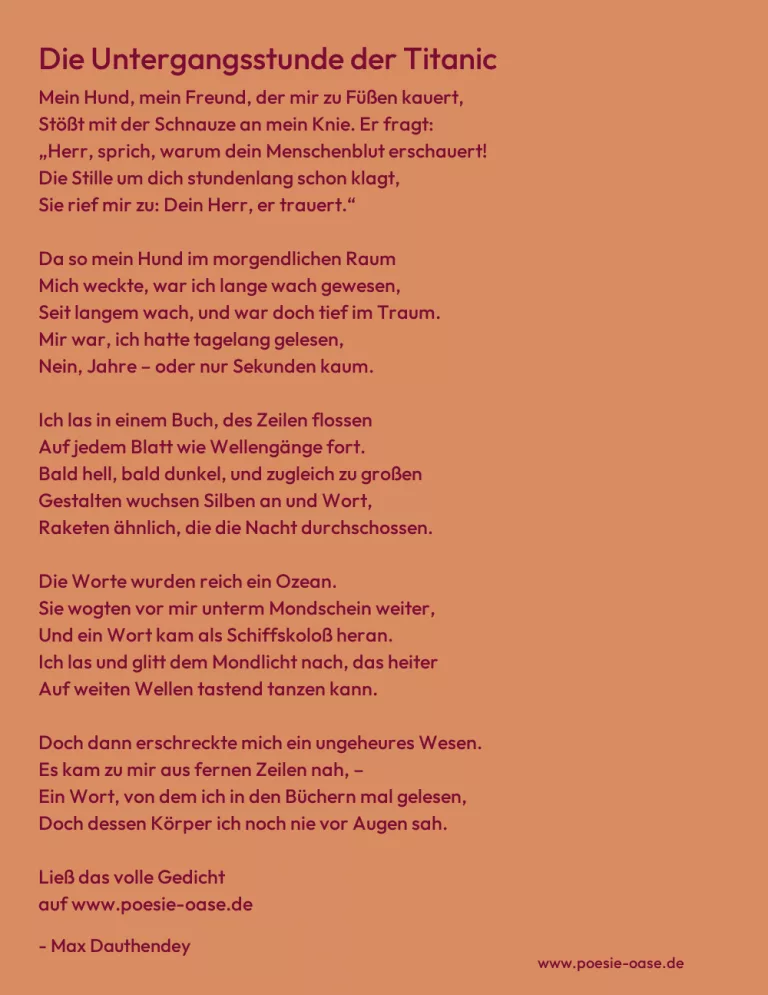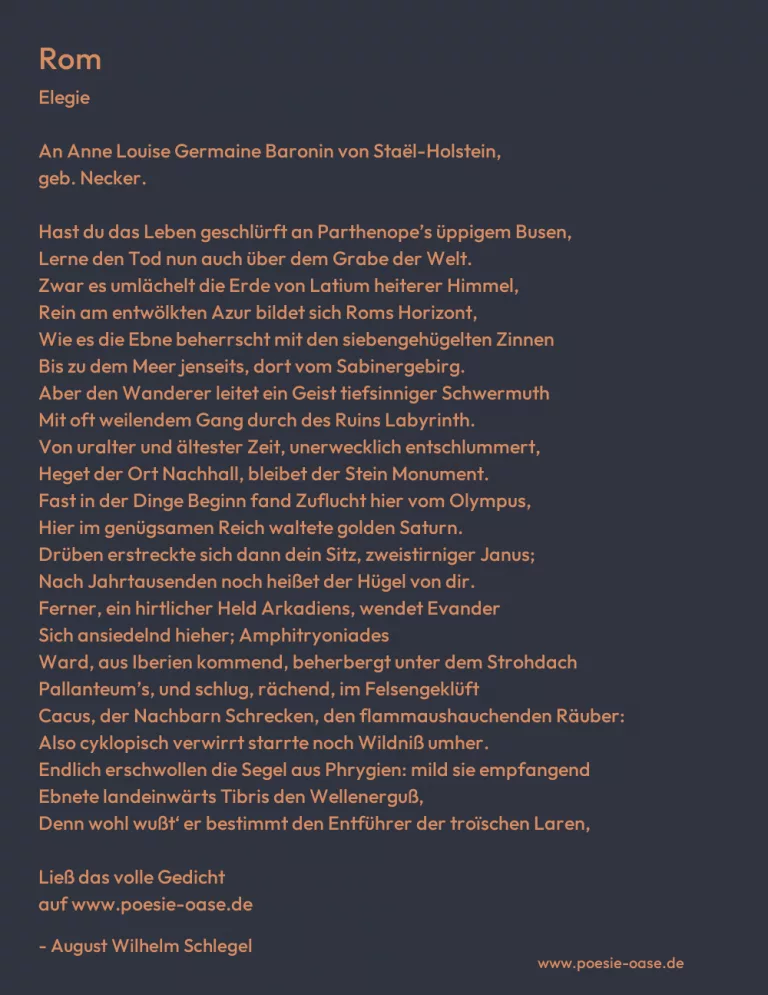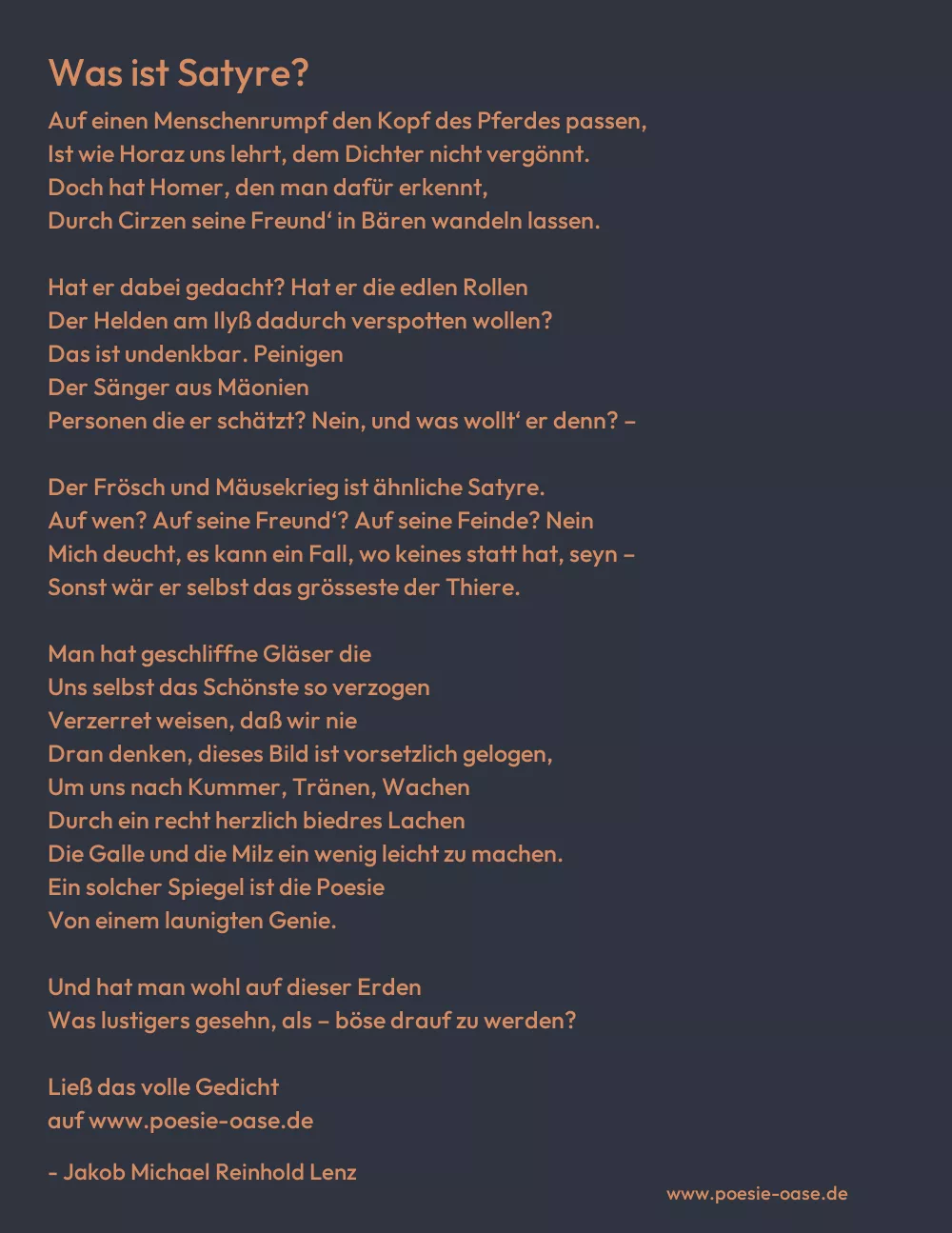Auf einen Menschenrumpf den Kopf des Pferdes passen,
Ist wie Horaz uns lehrt, dem Dichter nicht vergönnt.
Doch hat Homer, den man dafür erkennt,
Durch Cirzen seine Freund‘ in Bären wandeln lassen.
Hat er dabei gedacht? Hat er die edlen Rollen
Der Helden am Ilyß dadurch verspotten wollen?
Das ist undenkbar. Peinigen
Der Sänger aus Mäonien
Personen die er schätzt? Nein, und was wollt‘ er denn? –
Der Frösch und Mäusekrieg ist ähnliche Satyre.
Auf wen? Auf seine Freund‘? Auf seine Feinde? Nein
Mich deucht, es kann ein Fall, wo keines statt hat, seyn –
Sonst wär er selbst das grösseste der Thiere.
Man hat geschliffne Gläser die
Uns selbst das Schönste so verzogen
Verzerret weisen, daß wir nie
Dran denken, dieses Bild ist vorsetzlich gelogen,
Um uns nach Kummer, Tränen, Wachen
Durch ein recht herzlich biedres Lachen
Die Galle und die Milz ein wenig leicht zu machen.
Ein solcher Spiegel ist die Poesie
Von einem launigten Genie.
Und hat man wohl auf dieser Erden
Was lustigers gesehn, als – böse drauf zu werden?
Ja auf den Hetzer, der uns reizt
Und sagt, der Spiegel sey nicht konisch,
Er sey getreu, kurz der auf gut lacedemonisch
Mit Gassenbubenschnörkeln beizt.
Anwenden was ins große Blaue
Hineingeschrieben ward, sey’s Lust-, sey’s Trauerspiel,
Sey’n Laster vorgestellt, sey Thorheit, Schwachheit, Ziel
Der Uebertretungen, ist – daß ich dir’s vertraue
Bescheidner Philosoph! – des Ungeheurs am Nil
Das schreiet wie ein Kind und Menschen frisset – Sache.
Ist’s denn des Messers Schuld, wenn ich’s zum Mordschwerdt mache?
Wozu die Messer überhaupt?
Ruft Orgon, kann man nicht mit bloßen Händen essen?
Das steht den Herren frei. Doch uns erlaubt
Wird’s gleichfalls seyn, mit Tartarn nicht zu speisen,
Die gar gerittnes Fleisch vom Sattel fressen,
Mit Zähnen das Halbrohe wild zerreißen.
So geht’s, daß ich die Klinge nicht verliere,
Fast buchstäblich mit der Satyre.
Es giebt Gelegenheiten gnug,
Wo sich der Menschenwitz verwirrte,
Und weil noch nie ein Mensch erkannt hat, daß er irrte,
Den Edlen oft in schwere Fesseln schlug.
Bei den gehäuften Widersprüchen
Von Stellungen und Reibungen
Gab’s immer Uebertreibungen
Und tausend Stoff zum Lächerlichen.
Wär‘ da die Geißel nicht, mit der ein Götterarm
Der Hauptstadt Tempel selbst gereinigt,
Wohin die Wucherer gelaufen
Um zu verkaufen und zu kaufen:
Die edelste Natur, gepeinigt
Erläge dem verwünschten Schwarm
Vom Leiden und dem ewgen Harm,
Womit uns Eigensinn und Wuth der Thorheit steinigt.
Dergleichen Stimmungen zum voraus zu verhüten
Bleibt allemal auch Pflicht: denn wer kann sich gebieten,
Daß, wenn man Hand und Fuß ihm in die Folter schränkt,
Er, wie gewöhnlich spricht und denkt.
Verbrechen selbst kann diese Pflicht, die kränkt,
Doch nur zu kränken scheint, um Kränkung vorzubeugen,
Abwenden, und dem Thor der Weisheit Pfade zeigen.
Was ist beglückender als wahre Gottesfurcht?
Was tröstender im Sterben und im Leben?
Was kann der Stirn, die Sorge kränkt und furcht,
Das Siegel Götterhauchs und Abkunft wiedergeben?
Doch giebt’s erbärmlicher’s wohl was in der Natur
Als einen Menschen zu dem Affen
Von unsrer Neigungen Gewohnheit umzuschaffen?
Und die Bekehrungssucht hat, um die Welt zu strafen
Doch Länder – Welten schon mit Menschenblut beschwemmt,
Weil sie der kalte Ernst der Weisheit nie gedämmt,
Und seit der ersten Sonnenuhr
Ein Mensch der Gott zu seyn vom andern stets begehrte
Und allen seinen Zorn stets auf den Bruder leerte,
Wenn ihm was Unrechts wo entfuhr.
Horaz nennt jedes Nachbild Vieh.
Mit Unrecht, scheint’s. Die Noth, die Sympathie
Zwingt hundert Selbstgenies auf Erden
Nachbilder fremden Werths zu werden.
Wer einen gleichen Weg zu gleicher Tagszeit macht,
Ein ähnliches Geschäft zu treiben hat, und Freunde
So wie der andre findt, der hat auf keine Feinde
Die ihn den Affen nennen, Acht.
Doch seine Neigungen nach fremden Modeln wandeln,
Heißt, meiner Meinung nach, zu eignem Schaden handeln,
Denn man verliert dadurch das was uns unterscheidt,
All‘ unsern Menschenwerth und unsre Freudigkeit.
Der Eifrer aber will uns in Copey verwandeln
Oft bey Verlust der Seligkeit.
Er nimmt uns dann das Bild, so Gott uns anerschaffen
Und stempelt’s um zum Bilde eines Affen. –
Das heiß‘ ich Afterfrömmigkeit!
Die Mäurer und die Moralisten
Und viele selbstgenannte Christen
Schreyn wider Leidenschaft. Ihr Schreyn
Soll einer Jugend, die noch außer kleinen Ränken,
Verräthereyn und Knabenschwänken
Nicht weiß, was für ein Ding die Leidenschaft doch ist,
Erziehung, Bildung, Schöpfung seyn.
Der Tisch, die Speise selbst wird nach Sophistereyn
Der hochgelehrten Herrn zu einem Probestein
Verborgner Neigungen der Seele:
Als ob es uns an andern Proben fehle?
O stilles Lied der Philomele,
Schmilz doch die Augenblendereyn
Einmal zur Wahrheit um. Allein die Herrn sind Stein!
Und wenn man ihnen sagt, ihr großen Raphaele
Habt die Natur noch nie belauscht, ihr saht vorbey
Durch Nebel eurer Träumerey
Durch Bücher, die nur eine Seite
Des Herzens höchstens aufgedeckt
Und hundert Seiten Dunst gefleckt –
Ihr nennet Eitelkeit, was Wohlthun, Göttertugend –
Gefühl hervorgebracht, ihr nennet toller Jugend
Vergehungen mit Namen, daß Verfolgung sich bereite,
Und Menschen, werth belohnt zu werden, Sünder,
So hat Thorheit gespielt, und Männer werden Kinder.
Theater – o behüte Gott!
Ein großer Rousseau – zwar gelesen hab‘ ich’s nie,
Allein er schrieb dagegen, mein‘ ich,
Kurz die Gelehrten all sind einig
Theater ist Pedanterie.
Ein Edler stirbt. Man tanzt und lacht.
Ein Glas zerbricht! Es wird ein Kriegsverhör gehalten
Und alle Stirnen stehn in Falten,
Als wäre dies des Erdballs letzte Nacht.
Der Knabe soll im Takt und nach der Trommel lernen
Und tanzen und verdaun. Die Mentore entfernen
Was mit dem Leben ihn bekannt zu machen schien.
Er sieht nur Kutschen-Complimenten,
Hört das Geschrei schulmäßiger Studenten,
Die über Activ und Passiv
Oft räsonniren krumm und schief,
Und dieses Drehewerk, der Mischmasch von Genien
Und Gassenhauerwitz, der Unsinn heißt – erziehn!
So schlage doch Merkur darein, den Wust zu enden.
Ich bitte denn doch mir zu sagen,
Ob die Moral, so vorgetragen
Wie Shakespeare sie sinnlich macht:
Ob Väter, die durch ihre frommen
Herzlieben Söhnchen in der Nacht
Des Alters und der Noth, zuletzt um alles kommen,
Ob Ehrgeiz, der mit Menschenblut geschmiert
Von einer Klippe zu der andern
Und endlich zum Schaffot durch Zaubereyen führt,
Durch welche wir erziehn – ob Regeln ohne Zahl
Auf Pult und Kanzeln hergeschrien,
Ein junges Herz zu feinerer Moral
Und bessern Entschlüssen erziehen:
Als auf der hohen See von wirklichem Geschick
Nicht bloßen Träumereyn – von Shakespeare ein Stück. –
Man lernt den Krieg, man lernet sich
Das Halsband und die Degenkuppel schnallen.
Man greift auch ans Gewehr und – ohne Noth laß ich
Auf einen Burschen ders weit besser führt, um mich
Vor Kutschen sehn zu lassen, Hiebe fallen,
Fünfhundert wen’ger eins mit einem Modschen Stock –
Das alles macht – mein feinrer Rock.
Allein ihr Herrn seyd nie gelegen
Nackt und blessiert wie Vater Kleist.
Ein feindlicher Soldat hat nie den großen Geist
Ins Zeit gebracht – und stürbet ihr, so reißt
Kein Hauptmann von den Feinden sich den Degen
Von seiner Seit‘ – und fleht um euren Geist.
Der Krieg ist keine Uhr, und dennoch ist er eine;
Bewegungen, so wir von Jugend auf gelernt,
Die werden uns Natur und fallen oft ins Kleine.
Nur keiner sieht, daß man davon entfernt,
Und so sind blind die Führer ganzer Heerden.