Sie halten Siegesfest, sie ziehn die Stadt entlang;
Sie meinen, Schleswig-Holstein zu begraben.
Brich nicht, mein Herz! Noch sollst du Freude haben;
Wir haben Kinder noch, wir haben Knaben,
Und auch wir selber leben, Gott sei Dank!
1. Januar 1851
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
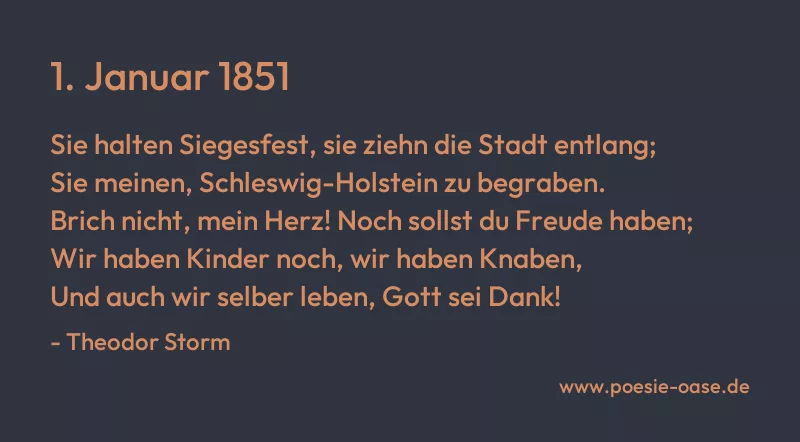
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „1. Januar 1851“ von Theodor Storm ist ein eindringliches Gedicht über die Hoffnung angesichts politischer Unterdrückung und persönlicher Verluste. Es ist eine Reaktion auf die politische Situation im Jahr 1851, als die dänischen Truppen Schleswig-Holstein besetzten. Das Gedicht drückt die Gefühle der Hoffnung, des Widerstands und der Liebe zur Familie aus, die Storm in dieser dunklen Zeit empfand.
Das Gedicht beginnt mit dem Bild der triumphal marschierenden Besatzer, die Storm als „Sie“ bezeichnet und die „Siegesfest“ feiern und „die Stadt entlang ziehn“ und „Schleswig-Holstein zu begraben meinen“. Diese Zeilen vermitteln ein Gefühl der Ohnmacht und des Verlustes angesichts der scheinbaren Niederlage. Doch anstatt sich der Verzweiflung hinzugeben, richtet sich der Dichter direkt an sein Herz mit den Worten „Brich nicht, mein Herz!“. Diese direkte Ansprache verdeutlicht die innere Stärke und den Willen, der Hoffnung trotz der äußeren Umstände festzuhalten.
Der zweite Teil des Gedichts bietet eine Antwort auf die Bedrohung durch die Besatzer. Die Antwort ist die Familie und die Liebe, die Storm zum Ausdruck bringt, indem er sagt: „Wir haben Kinder noch, wir haben Knaben, / Und auch wir selber leben, Gott sei Dank!“. Diese Zeilen zeigen, dass die Familie und das Leben selbst Quelle der Freude und der Widerstandsfähigkeit sind. Sie bieten Trost und Hoffnung inmitten des politischen Chaos und der drohenden Dunkelheit. Durch die Betonung der Kinder und des eigenen Lebens erzeugt Storm ein Gefühl der Dankbarkeit und der Hoffnung auf eine bessere Zukunft.
Die Verwendung von einfachen Worten und einem direkten Ton, der nicht von komplexen Bildern oder Symbolen ablenkt, verstärkt die emotionale Wirkung des Gedichts. Die Kürze des Gedichts unterstreicht die Dringlichkeit und die Intensität der Gefühle. Die Wiederholung von „wir“ im letzten Teil verbindet den Dichter mit der Familie und drückt ein Gefühl der Verbundenheit und des gemeinsamen Überlebens aus. Das Gedicht ist ein kraftvolles Zeugnis des menschlichen Geistes, der sich trotz widriger Umstände der Hoffnung und der Liebe zuwendet. Es ist ein Aufruf, nicht aufzugeben und die Freuden des Lebens zu schätzen, selbst wenn die Welt um einen herum in Aufruhr ist.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
