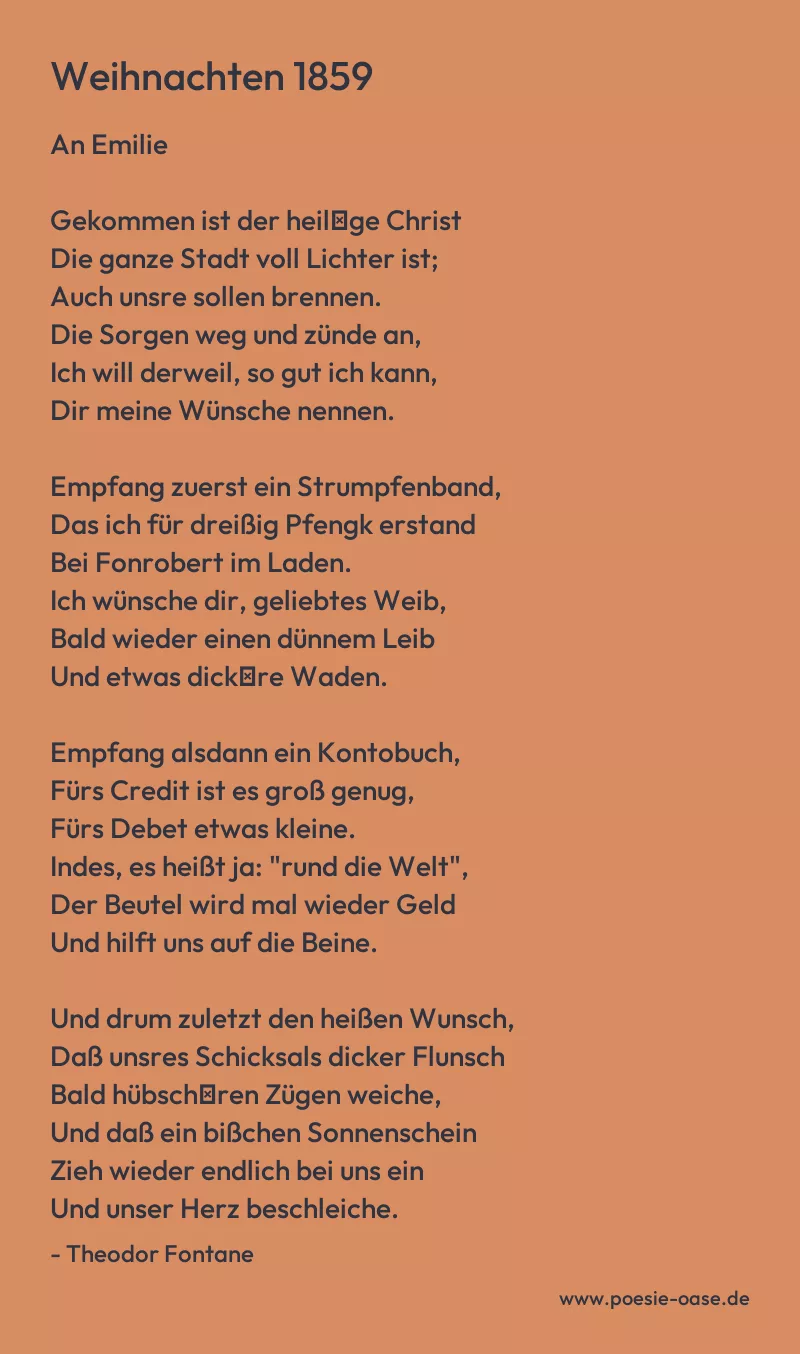Weihnachten 1859
An Emilie
Gekommen ist der heil′ge Christ
Die ganze Stadt voll Lichter ist;
Auch unsre sollen brennen.
Die Sorgen weg und zünde an,
Ich will derweil, so gut ich kann,
Dir meine Wünsche nennen.
Empfang zuerst ein Strumpfenband,
Das ich für dreißig Pfengk erstand
Bei Fonrobert im Laden.
Ich wünsche dir, geliebtes Weib,
Bald wieder einen dünnem Leib
Und etwas dick′re Waden.
Empfang alsdann ein Kontobuch,
Fürs Credit ist es groß genug,
Fürs Debet etwas kleine.
Indes, es heißt ja: „rund die Welt“,
Der Beutel wird mal wieder Geld
Und hilft uns auf die Beine.
Und drum zuletzt den heißen Wunsch,
Daß unsres Schicksals dicker Flunsch
Bald hübsch′ren Zügen weiche,
Und daß ein bißchen Sonnenschein
Zieh wieder endlich bei uns ein
Und unser Herz beschleiche.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
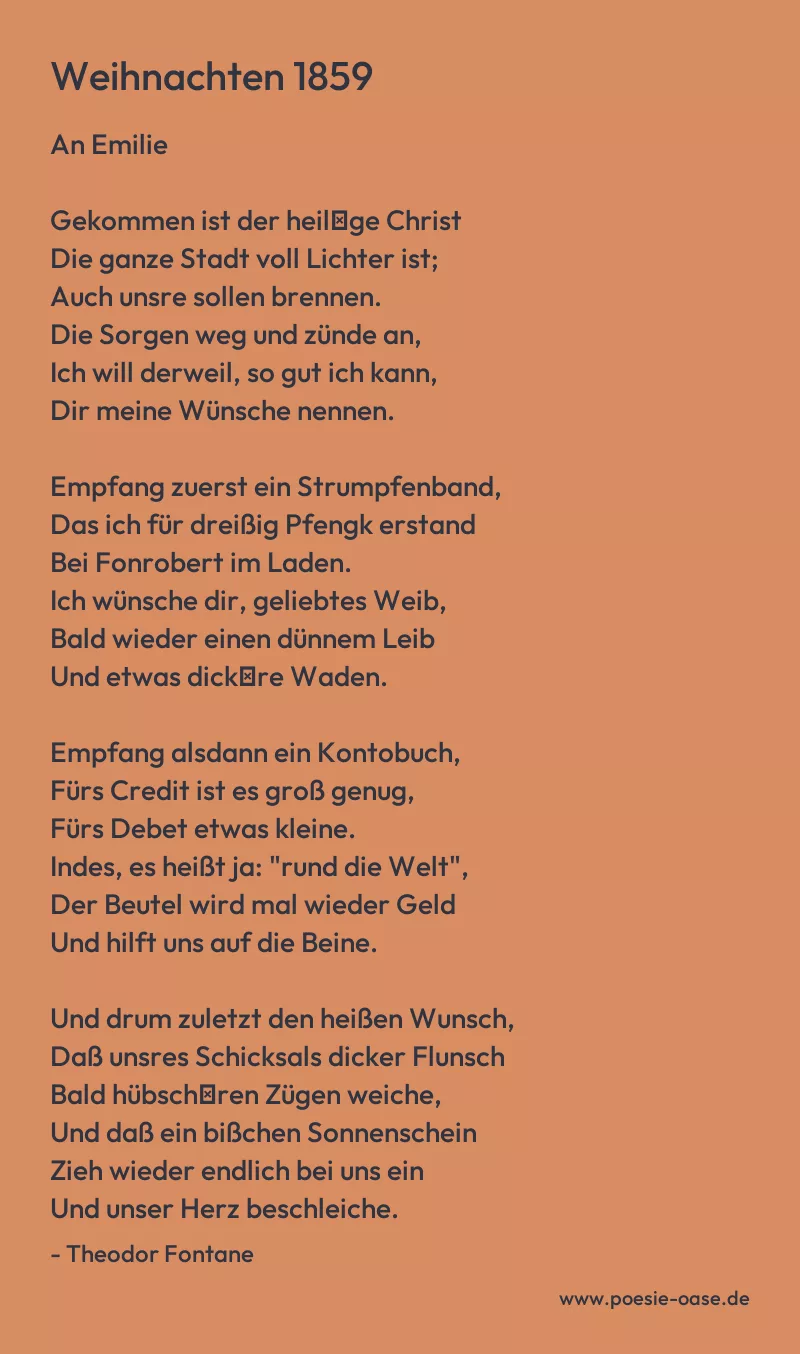
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Weihnachten 1859“ von Theodor Fontane ist eine humorvolle und liebevolle Liebeserklärung, die in Form eines Weihnachtsgedichts an seine Frau Emilie verfasst wurde. Es zeichnet sich durch eine Mischung aus Alltagsbeobachtungen, pragmatischen Wünschen und tief empfundener Zuneigung aus. Die Wahl der Weihnachtszeit unterstreicht die Intimität und den Wunsch nach Geborgenheit in der Beziehung.
In den Strophen werden zunächst materielle Geschenke wie ein Strumpfband und ein Kontobuch angekündigt, die mit einem Augenzwinkern betrachtet werden. Die Beschreibung des Strumpfbandes, das für 30 Pfennige erstanden wurde, spiegelt die damaligen finanziellen Umstände wider und verankert das Gedicht in der Realität des bürgerlichen Lebens. Der Wunsch nach einem „dünnen Leib“ und „dick’ren Waden“ ist ein charmantes Beispiel für die humorvolle und zugleich ehrliche Zuneigung des Dichters zu seiner Frau, die nicht nur körperliche Aspekte mit einbezieht. Die Erwähnung des Kontobuchs, das für Kredite groß, aber für Debit klein ist, deutet auf finanzielle Sorgen hin, die jedoch mit einem optimistischen Ausblick versehen werden.
Der Höhepunkt des Gedichts ist der „heiße Wunsch“ nach einer Verbesserung der Lebensumstände. Hier wird die tiefe Sehnsucht nach Glück und Sonnenschein ausgedrückt, die über die rein materiellen Wünsche hinausgeht. Der „dicker Flunsch“ des Schicksals symbolisiert die Herausforderungen und Schwierigkeiten, mit denen das Paar konfrontiert ist. Der Wunsch, dass diese verschwinden und durch „hübsch’re Züge“ ersetzt werden, zeigt den Wunsch nach einer positiven Veränderung und einem besseren Leben. Die Bitte, dass „Sonnenschein“ wieder in ihr Leben einkehren soll, unterstreicht den Wunsch nach Freude, Leichtigkeit und einer positiven Grundstimmung.
Fontanes Sprache ist unprätentiös und volksnah, was die Echtheit und Aufrichtigkeit seiner Gefühle unterstreicht. Die Verwendung von Reimen und einem einfachen Metrum macht das Gedicht leicht zugänglich und unterstreicht seinen privaten, vertrauten Charakter. Die humorvollen Elemente, wie die Beschreibung der Geschenke und die Erwähnung finanzieller Sorgen, lockern das Gedicht auf und machen es zu einem erfrischenden Beispiel für Liebeslyrik, das sich von den idealisierten Darstellungen der Romantik abhebt. Es ist ein intimes Porträt einer Ehe, das von Liebe, Pragmatismus und der Hoffnung auf eine bessere Zukunft geprägt ist.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.