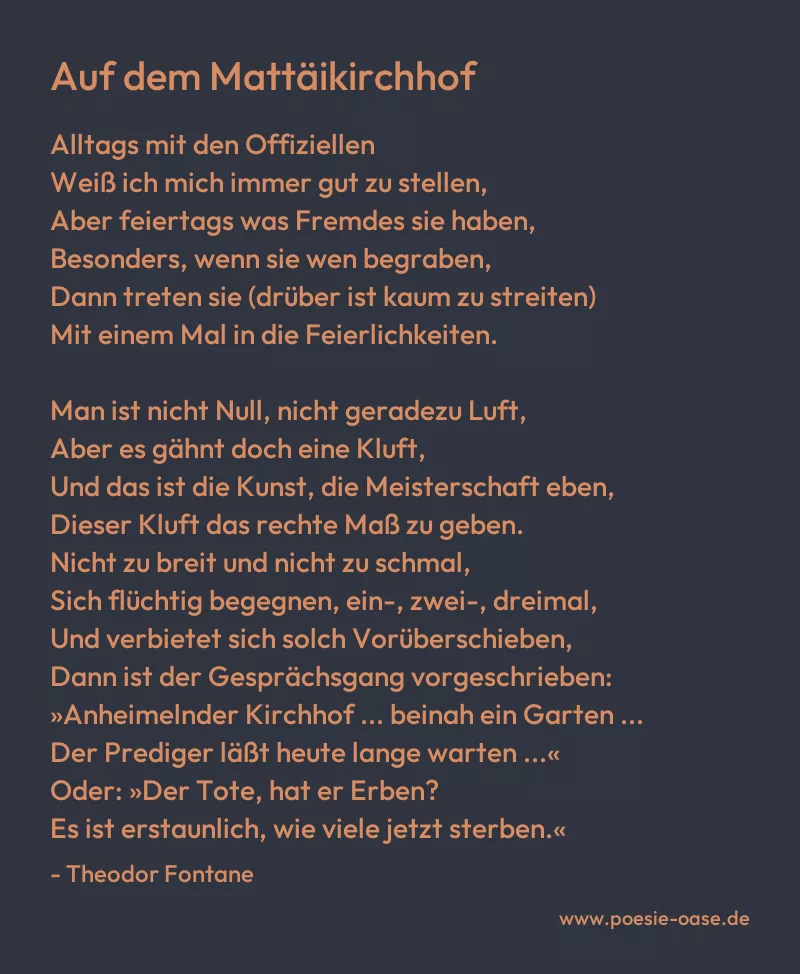Auf dem Mattäikirchhof
Alltags mit den Offiziellen
Weiß ich mich immer gut zu stellen,
Aber feiertags was Fremdes sie haben,
Besonders, wenn sie wen begraben,
Dann treten sie (drüber ist kaum zu streiten)
Mit einem Mal in die Feierlichkeiten.
Man ist nicht Null, nicht geradezu Luft,
Aber es gähnt doch eine Kluft,
Und das ist die Kunst, die Meisterschaft eben,
Dieser Kluft das rechte Maß zu geben.
Nicht zu breit und nicht zu schmal,
Sich flüchtig begegnen, ein-, zwei-, dreimal,
Und verbietet sich solch Vorüberschieben,
Dann ist der Gesprächsgang vorgeschrieben:
»Anheimelnder Kirchhof … beinah ein Garten …
Der Prediger läßt heute lange warten …«
Oder: »Der Tote, hat er Erben?
Es ist erstaunlich, wie viele jetzt sterben.«
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
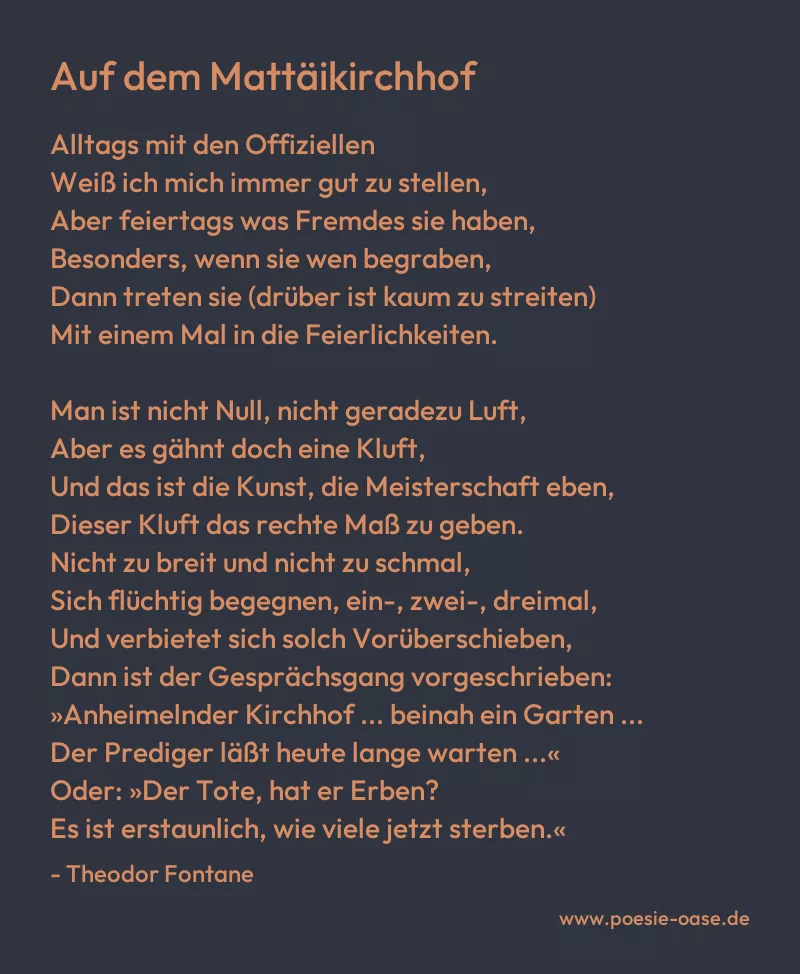
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Auf dem Mattäikirchhof“ von Theodor Fontane beschreibt auf ironische Weise die zwischenmenschlichen Beziehungen und das Verhalten der Menschen bei einer Beerdigung. Es offenbart die Diskrepanz zwischen der im Alltag aufrechterhaltenen Fassade und dem Gefühl der Entfremdung und Leere, das an einem Ort des Todes empfunden wird. Die scheinbare Leichtigkeit und der fast beiläufige Tonfall des Gedichts stehen im Kontrast zur tieferliegenden Thematik, die das menschliche Bedürfnis nach Distanz und Konformität beleuchtet.
Der Dichter, der hier als Beobachter auftritt, beschreibt zunächst sein geschicktes Agieren im Alltag, in dem er sich „immer gut zu stellen“ weiß. Der Kontrast zu den „Feiertagen“, besonders bei einer Beerdigung, verdeutlicht eine Art von Verwandlung, in der die Fassade brüchig wird. Die Menschen treten „mit einem Mal in die Feierlichkeiten“, was andeutet, dass sie sich gezwungen fühlen, an diesen Riten teilzunehmen, obwohl sie sich innerlich distanziert fühlen. Die Formulierung „drüber ist kaum zu streiten“ verstärkt den Eindruck der unausweichlichen Natur dieser Teilnahme.
Der Kern des Gedichts liegt in der „Kluft“, die zwischen den Menschen gähnt. Trotz der gemeinsamen Anwesenheit bei einem so bedeutungsschweren Ereignis wie einer Beerdigung herrscht eine Distanz, die der Dichter mit der „Kunst“ des „rechten Maßes“ zu überbrücken versucht. Diese Kunst besteht darin, sich flüchtig zu begegnen und vorgegebene Gesprächsfloskeln zu verwenden. Die trivialen Gesprächsinhalte, wie die Bemerkung über den „anheimelnden Kirchhof“ oder die Frage nach den Erben des Toten, dienen als Eisbrecher, die jedoch die tatsächliche Leere und das Unbehagen überdecken.
Fontane kritisiert hier subtil die gesellschaftliche Konvention, die es den Menschen erschwert, in Momenten der Trauer und des Verlustes echte Nähe und Anteilnahme zu zeigen. Stattdessen wird eine oberflächliche Höflichkeit gepflegt, die die tieferen Emotionen verdeckt. Das Gedicht endet mit einer Art von Zynismus, der die Absurdität dieser Situation unterstreicht. Die Frage nach der Anzahl der Sterbefälle deutet auf eine zunehmende Abstumpfung gegenüber dem Tod hin und verweist auf die allgemeine Verlorenheit und die fehlende Fähigkeit, sich mit dem Verlust zu identifizieren. Fontane zeigt uns somit, wie wir versuchen, mit dem Tod und der Trauer zu interagieren, aber letztendlich eine distanzierte und manchmal sogar zynische Haltung einnehmen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.