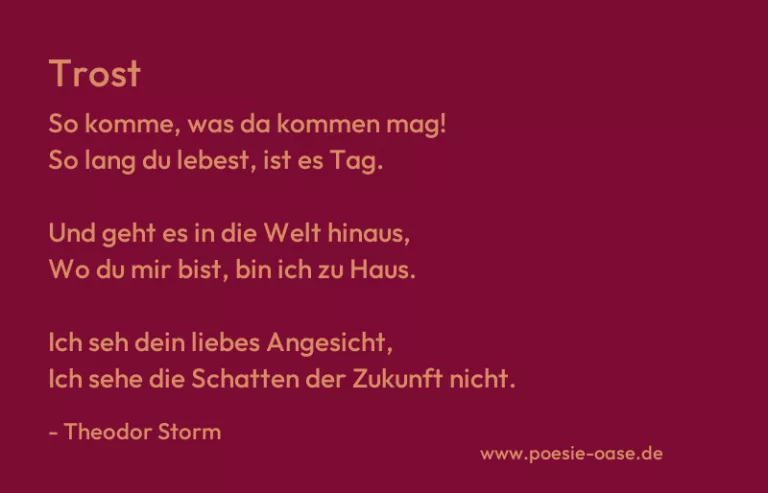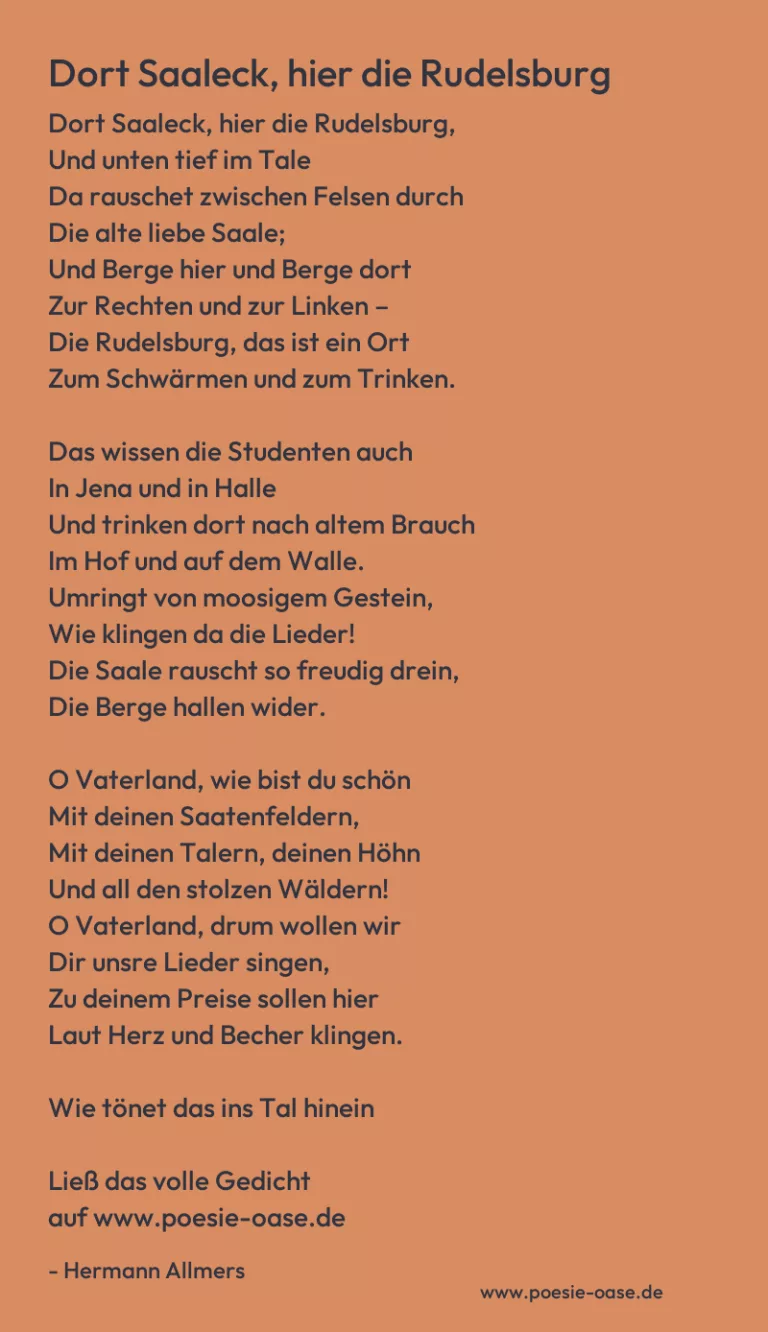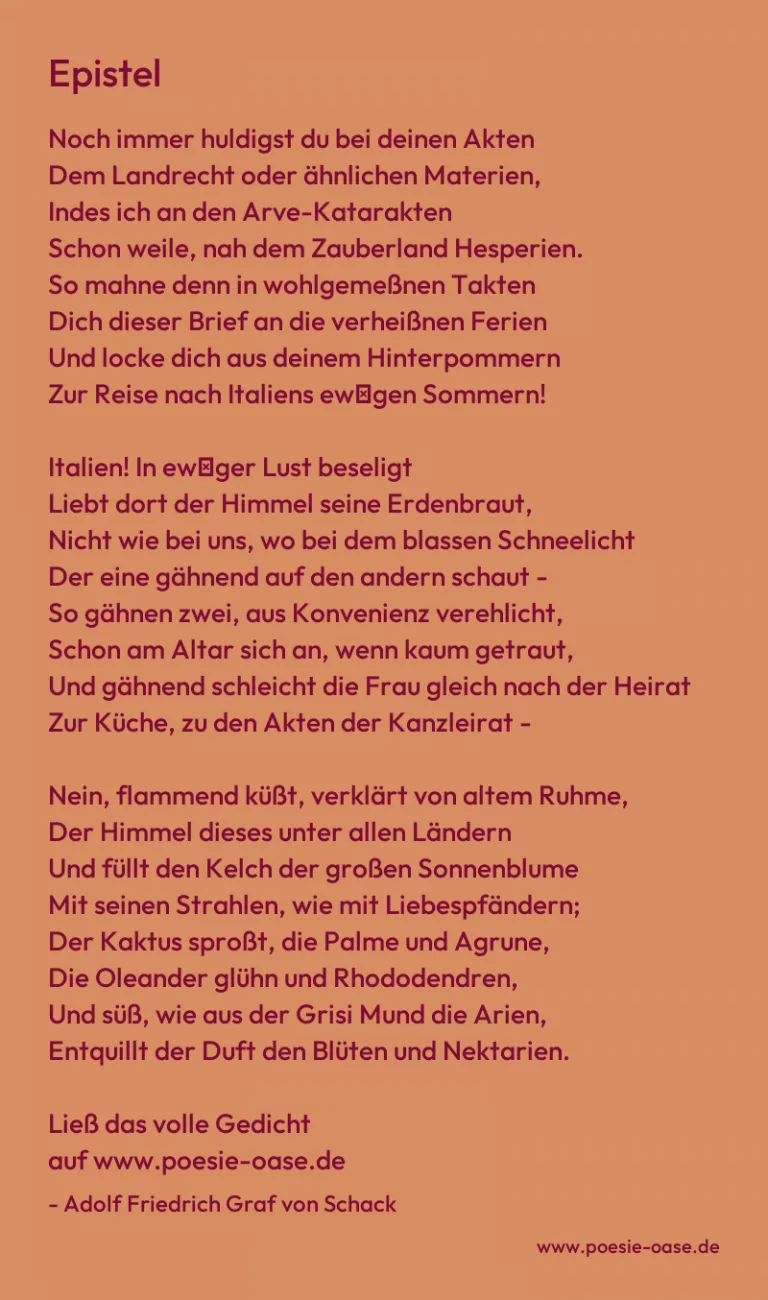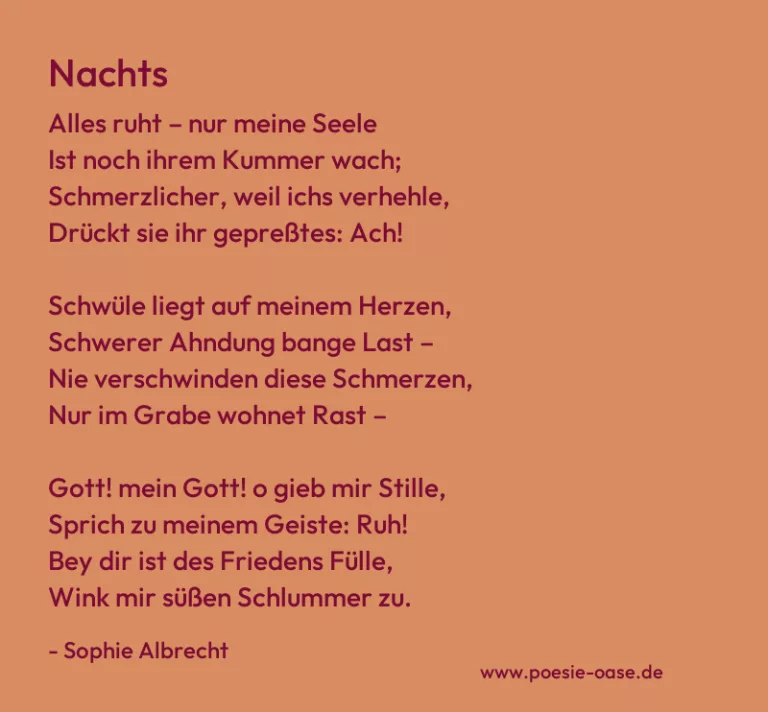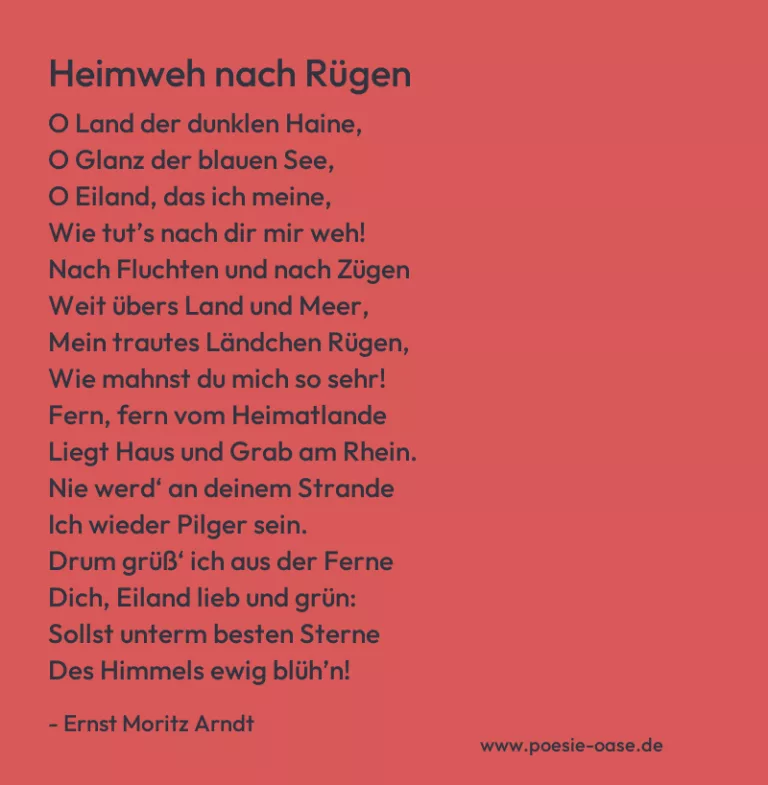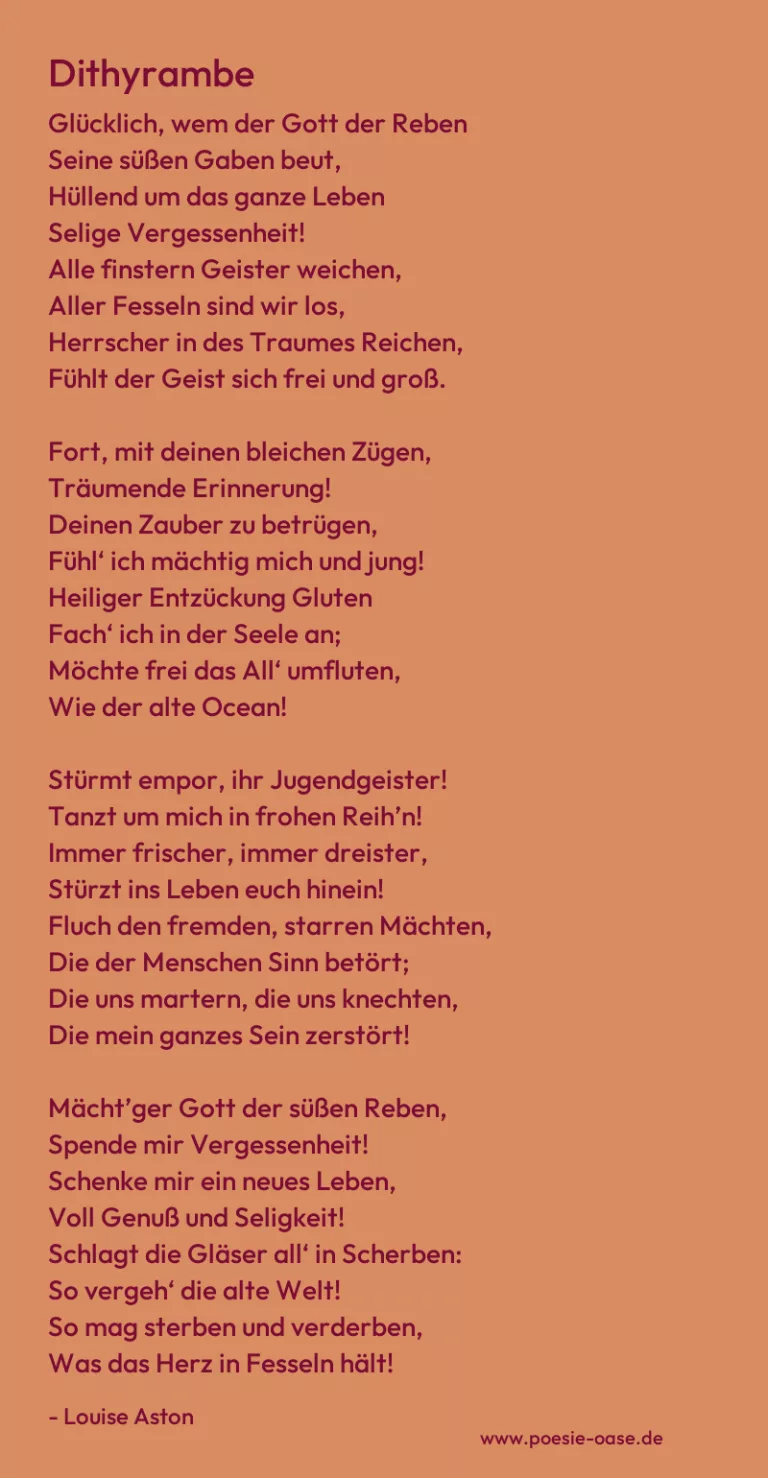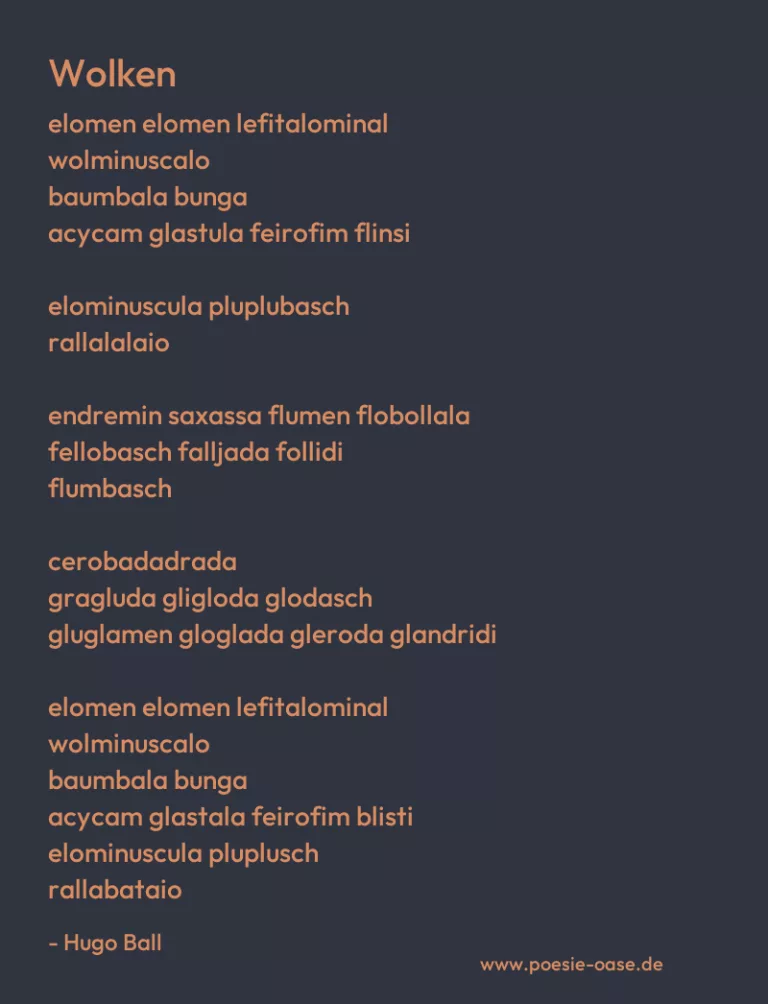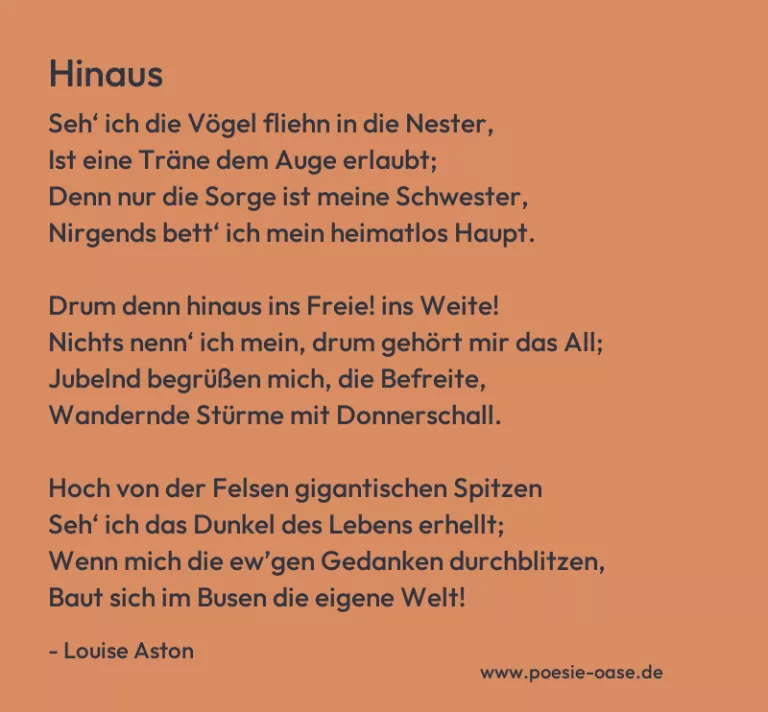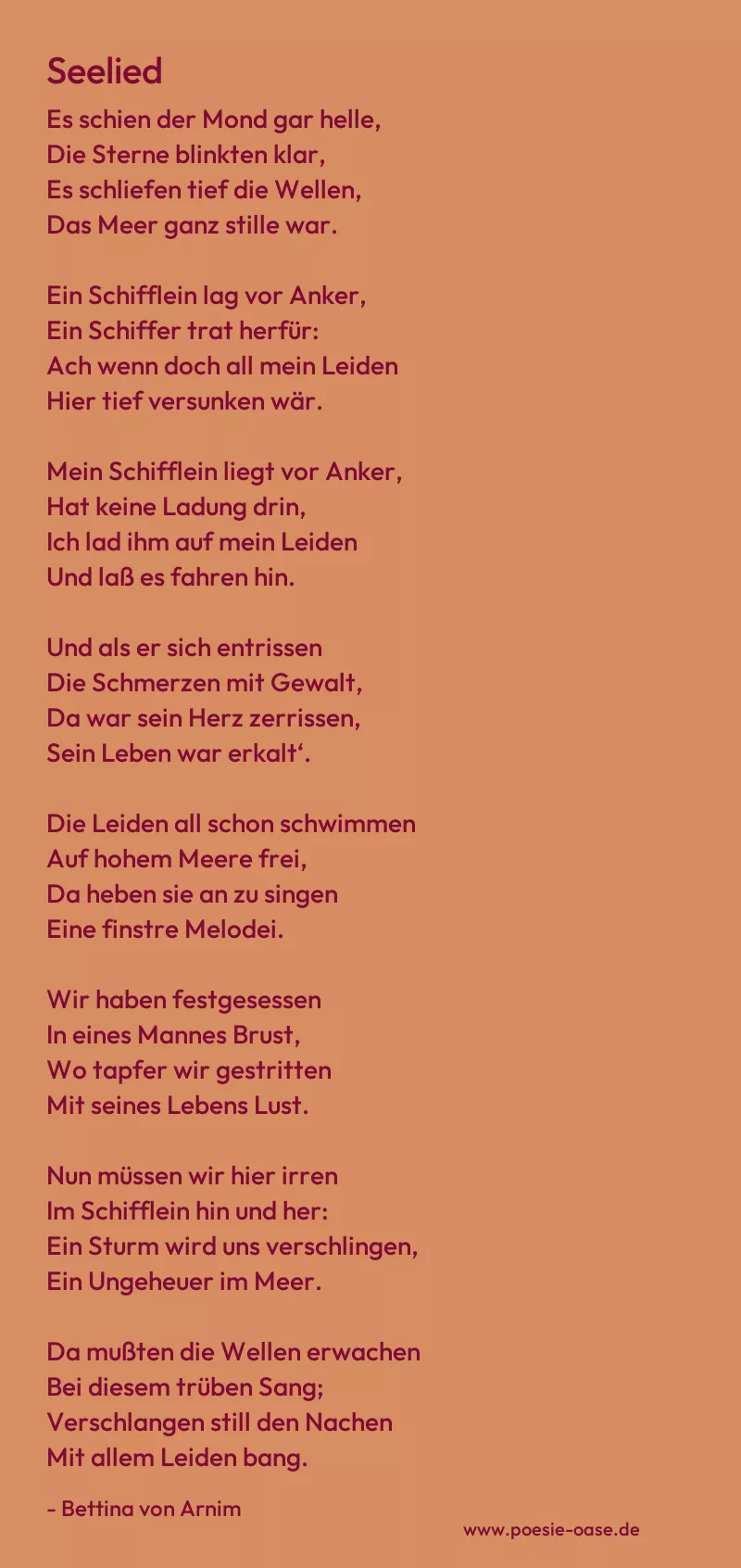Alltag, Chaos, Frieden, Gegenwart, Gemeinfrei, Harmonie, Helden & Prinzessinnen, Himmel & Wolken, Krieg, Leidenschaft, Natur, Weihnachten
Seelied
Es schien der Mond gar helle,
Die Sterne blinkten klar,
Es schliefen tief die Wellen,
Das Meer ganz stille war.
Ein Schifflein lag vor Anker,
Ein Schiffer trat herfür:
Ach wenn doch all mein Leiden
Hier tief versunken wär.
Mein Schifflein liegt vor Anker,
Hat keine Ladung drin,
Ich lad ihm auf mein Leiden
Und laß es fahren hin.
Und als er sich entrissen
Die Schmerzen mit Gewalt,
Da war sein Herz zerrissen,
Sein Leben war erkalt‘.
Die Leiden all schon schwimmen
Auf hohem Meere frei,
Da heben sie an zu singen
Eine finstre Melodei.
Wir haben festgesessen
In eines Mannes Brust,
Wo tapfer wir gestritten
Mit seines Lebens Lust.
Nun müssen wir hier irren
Im Schifflein hin und her:
Ein Sturm wird uns verschlingen,
Ein Ungeheuer im Meer.
Da mußten die Wellen erwachen
Bei diesem trüben Sang;
Verschlangen still den Nachen
Mit allem Leiden bang.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
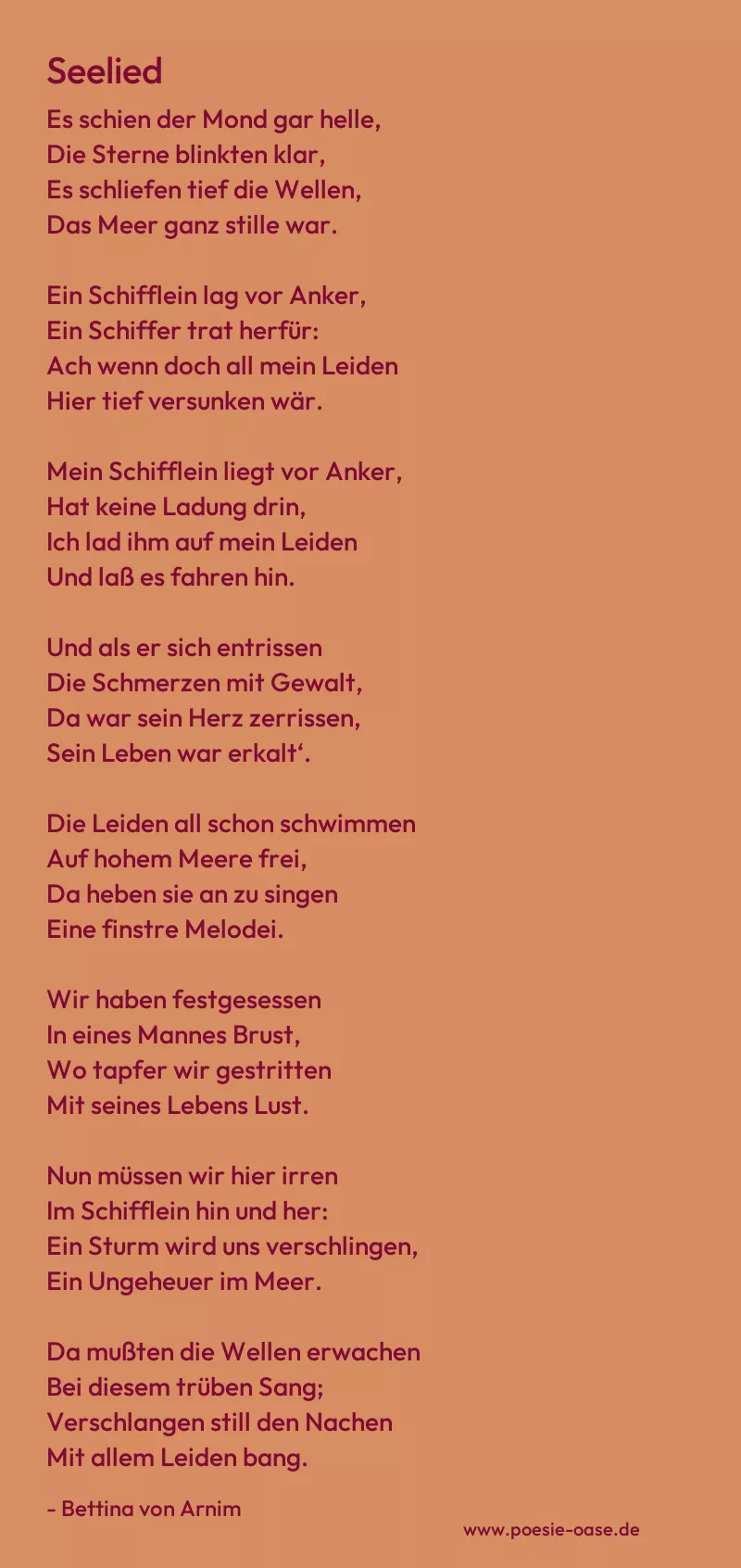
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Seelied“ von Bettina von Arnim ist eine düstere Allegorie auf seelisches Leid, innere Zerrissenheit und das Verlangen nach Befreiung durch Loslösung oder Tod. Es vereint Naturbilder mit psychischen Zuständen und stellt das Meer als Spiegel der menschlichen Seele dar – tief, ruhig, aber zugleich bedrohlich und aufnahmebereit für das, was der Mensch aus sich herauswerfen will.
Eingeleitet wird das Gedicht durch eine fast friedliche Szene: Mondlicht, klare Sterne, stille Wellen. Diese äußere Ruhe kontrastiert stark mit der inneren Unruhe des Sprechers. Das Schiff, das vor Anker liegt, dient als zentrales Symbol: Es ist leer und wartet darauf, mit dem persönlichen Leid beladen zu werden. Das „Leiden“ wird dabei nicht abstrakt, sondern beinahe wie ein physischer Ballast behandelt, den der Sprecher auf das Schiff lädt, um ihn loszuwerden.
Die dramatische Wendung folgt mit der gewaltsamen Trennung von diesem Leid: Der Versuch, das Leid aus dem Herzen zu reißen, führt nicht zur Erlösung, sondern zum Tod – „sein Herz zerrissen, sein Leben war erkalt‘“. Der Schmerz war so tief verwurzelt, dass seine Entfernung den Menschen selbst zerstört. Doch das Leid lebt weiter: Im Bild der klagenden, heimatlosen Leiden, die nun auf dem Meer umherirren, wird es personifiziert und erhält eine eigene Stimme.
Diese Leiden erzählen von ihrem früheren Ort – der Brust des Mannes – wo sie einen ständigen Kampf mit dessen Lebensfreude geführt haben. Nun, aus dem Inneren verbannt, treiben sie ziellos umher, ohne Ruhe zu finden. Das Schiff, das sie trägt, wird zu einem Geisterschiff, das in Gefahr ist, von Sturm und Seeungeheuer vernichtet zu werden – eine eindrucksvolle Metapher für das Unverarbeitete, das droht, sich in neue Zerstörung zu verwandeln.
Das Gedicht endet mit einem unheilvollen Bild: Die trauernde Melodie der Leiden ruft die Wellen aus ihrer Ruhe, und diese verschlingen das Schiff mitsamt dem Leid. Es ist ein Schluss, der keine Erlösung bietet, sondern vielmehr den Eindruck verstärkt, dass Leid, einmal entfesselt, eine zerstörerische Kraft entfaltet. So wird das „Seelied“ zu einer Ballade über psychischen Schmerz, die Einsamkeit des Leidenden und die vergebliche Hoffnung, sich davon befreien zu können.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.