In meinen Adern brennt der stramme Grog;
Pompöser Kohl durchrast mein Eingeweide.
Die kalte Nase steckt im Weltgehirn;
Die heißen Hengste führ ich auf die Weide.
Jetzt, Erdenbürger: Leide! Leide! Leide!
Groglied
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
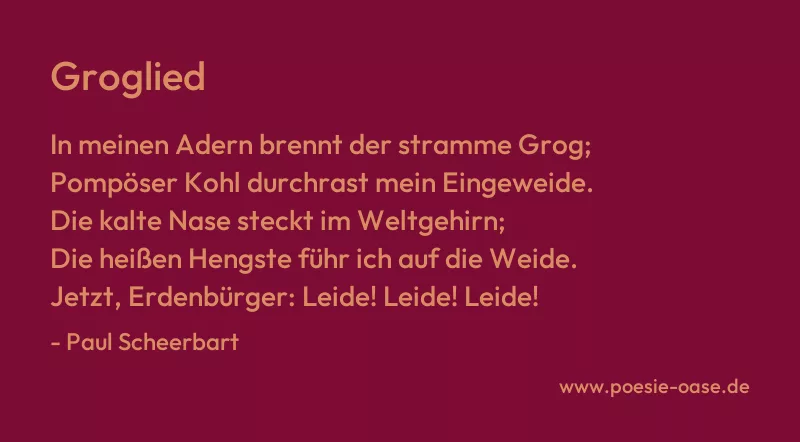
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Groglied“ von Paul Scheerbart ist ein kurzes, expressionistisches Gedicht, das in seiner Kürze eine Fülle von Eindrücken und Stimmungen vermittelt. Es zeichnet sich durch eine bizarre Bildsprache und eine deutliche Ablehnung konventioneller Poesie aus. Der Titel deutet bereits auf eine Verbindung zum Genussmittel Grog hin, was als Ausgangspunkt für eine kritische Auseinandersetzung mit dem Ich-Gefühl und der Welt dienen könnte.
Das Gedicht beginnt mit einer körperlichen Empfindung: „In meinen Adern brennt der stramme Grog“. Hier wird der Grog als ein brennendes Element im Inneren des Sprechers dargestellt, was auf eine unmittelbare und starke physische Reaktion hindeutet. Die Erwähnung von „pompöser Kohl“ im zweiten Vers, der die „Eingeweide“ durchrast, setzt die bizarre Bildsprache fort. Der Kohl, oft als einfaches, vielleicht sogar unfeines Gericht betrachtet, wird hier mit der Adjektiv „pompös“ versehen und erzeugt so einen humorvollen, leicht absurden Kontrast. Dieser Kontrast könnte die Widersprüchlichkeiten im Inneren des Sprechers symbolisieren oder auf eine Übersteigerung von körperlichen Empfindungen verweisen.
Die Zeilen „Die kalte Nase steckt im Weltgehirn; / Die heißen Hengste führ ich auf die Weide“ sind besonders rätselhaft. Die „kalte Nase“ scheint hier eine Art von distanziertem Beobachter zu sein, der in die Welt eindringt. Das „Weltgehirn“ könnte als Metapher für die Gesamtheit der Welt, vielleicht sogar für das Weltgeschehen, gedeutet werden. Der zweite Teil dieses Verses, in dem „heiße Hengste“ auf die „Weide“ geführt werden, deutet auf eine kontrollierte Bewegung von etwas Kraftvollem und Triebhaftem hin. Dieser Wechsel könnte eine Auseinandersetzung zwischen dem Individuum und der Welt, zwischen Gefühl und Verstand, darstellen.
Das Gedicht endet mit dem Imperativ „Jetzt, Erdenbürger: Leide! Leide! Leide!“. Diese wiederholte Aufforderung zum Leiden wirkt wie ein Aufschrei, eine Anklage oder eine ironische Schlussfolgerung. Sie könnte als eine Reaktion auf die vorhergehenden, oft absurden Bilder verstanden werden und das Leiden als unvermeidlichen Teil der menschlichen Existenz betonen. Die Verwendung von „Erdenbürger“ adressiert das Publikum direkt und verallgemeinert das Gefühl des Leidens, was das Gedicht zu einer eindringlichen Reflexion über die menschliche Conditio macht.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
