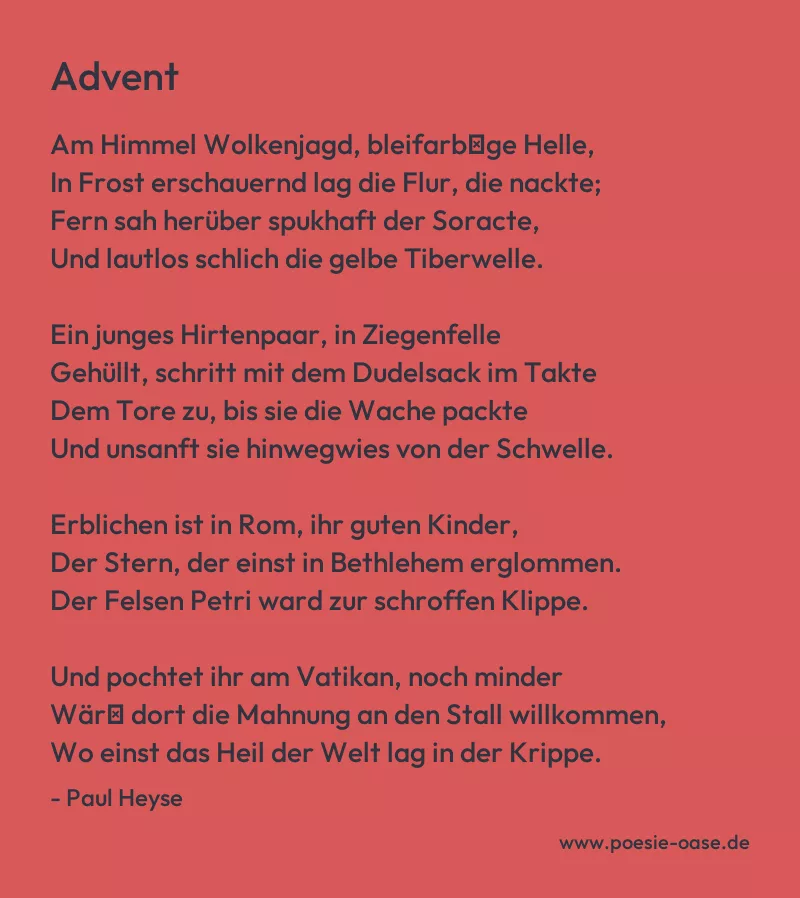Advent
Am Himmel Wolkenjagd, bleifarb′ge Helle,
In Frost erschauernd lag die Flur, die nackte;
Fern sah herüber spukhaft der Soracte,
Und lautlos schlich die gelbe Tiberwelle.
Ein junges Hirtenpaar, in Ziegenfelle
Gehüllt, schritt mit dem Dudelsack im Takte
Dem Tore zu, bis sie die Wache packte
Und unsanft sie hinwegwies von der Schwelle.
Erblichen ist in Rom, ihr guten Kinder,
Der Stern, der einst in Bethlehem erglommen.
Der Felsen Petri ward zur schroffen Klippe.
Und pochtet ihr am Vatikan, noch minder
Wär′ dort die Mahnung an den Stall willkommen,
Wo einst das Heil der Welt lag in der Krippe.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
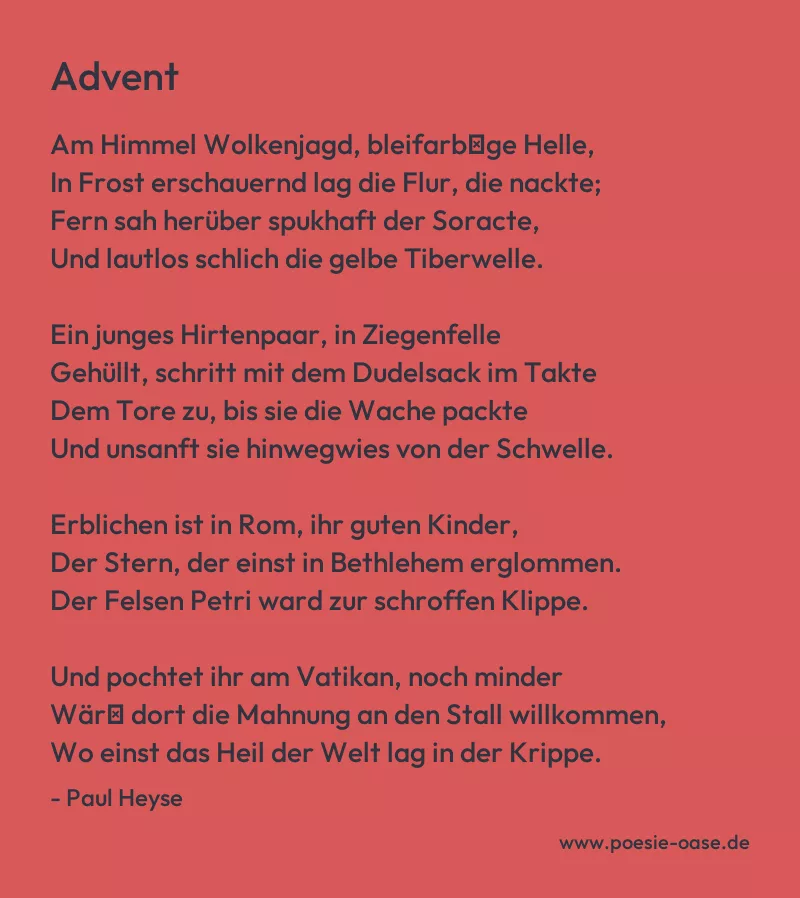
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Advent“ von Paul Heyse ist eine melancholische Betrachtung über das Erlöschen des adventlichen Geistes in einer entchristlichten römischen Welt. Das Gedicht beginnt mit einer Beschreibung der trostlosen Natur, die durch die „bleifarb′ge Helle“ am Himmel, die „nackte“ Flur und den „Frost“ eine Atmosphäre der Kälte und Leere vermittelt. Die Erwähnung des Berges Soracte und der Tiber, die „lautlos“ dahinzieht, verstärkt das Gefühl der Einsamkeit und des Verfalls. Die Landschaft spiegelt die innere Leere der Zeit wider, in der das Gedicht angesiedelt ist.
Die zweite Strophe führt die menschliche Perspektive ein. Ein junges Hirtenpaar, gekleidet in Ziegenfelle und mit einem Dudelsack, bewegt sich auf ein Tor zu, wird jedoch von der Wache abgewiesen. Dieser Vorfall ist ein Symbol für die Ablehnung und das Ausgestoßensein von den heiligen Stätten. Das Hirtenpaar, das traditionell mit der Geburt Jesu in Verbindung gebracht wird, findet keinen Zutritt. Dies unterstreicht den Verlust des Glaubens und der weihnachtlichen Freude, da die „guten Kinder“ des Gedichts keinen Zugang zum Ort der Hoffnung und des Heils erhalten.
Die dritte Strophe, der sogenannte „Schluss“, bringt die zentrale Aussage des Gedichts hervor. Sie greift die Thematik des Verfalls und der Entfremdung vom Glauben auf, indem sie feststellt, dass der Stern von Bethlehem in Rom erblichen ist, und der Felsen Petri zur „schroffen Klippe“ geworden ist. Die letzten Verse zeigen eine weitere Dimension der Abweisung: Selbst wenn die Hirten am Vatikan klopfen würden, fänden sie keine Akzeptanz mehr. Die „Mahnung an den Stall“, die Krippe, in der einst das Heil der Welt lag, wäre in dieser Zeit unerwünscht.
Insgesamt zeichnet Heyse ein Bild einer Welt, in der die christlichen Werte und die adventliche Hoffnung verblasst sind. Die winterliche Natur, die abgewiesenen Hirten und die entweihten heiligen Stätten sind Metaphern für den Verlust des Glaubens und die spirituelle Leere der Zeit. Das Gedicht ist eine bittere Klage über den Verfall religiöser Ideale und eine Mahnung an die Notwendigkeit, die ursprünglichen Werte des christlichen Glaubens wiederzuentdecken und zu bewahren.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.