Kühl herbstlicher Abend, es weht der Wind,
Am Grabe der Mutter weint das Kind,
Die Freunde, Verwandten umdrängen dicht
Den Prediger, der so rührend spricht.
Er gedenkt, wie fromm die Tote war,
Wie freundlich und liebvoll immerdar,
Und wie sie das Kind so treu und wach
Stets hielt am Herzen; wie schwer dies brach.
Daß grausam es ist, in solcher Stund
Die Toten zu loben, ist ihm nicht kund;
Der eifrige Priester nicht ahnt und fühlt,
Wie er im Herzen des Kindes wühlt.
Es regnet, immer dichter, herab,
Als weinte der Himmel mit aufs Grab,
Doch stört es nicht den Leichensermon,
Auch schleicht kein Hörer sich still davon.
Die Tote hört der Rede Laut
So wenig, als wie der Regen taut,
So wenig als das Rauschen des Winds,
Als die Klagen ihres verwaisten Kinds.
Der Priester am Grabe doch meint es gut,
Er predigt dem Volk mit Kraft und Glut,
Verwehender Staub dem Staube,
Daß er ans Verwehen nicht glaube.
An einem Grabe
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
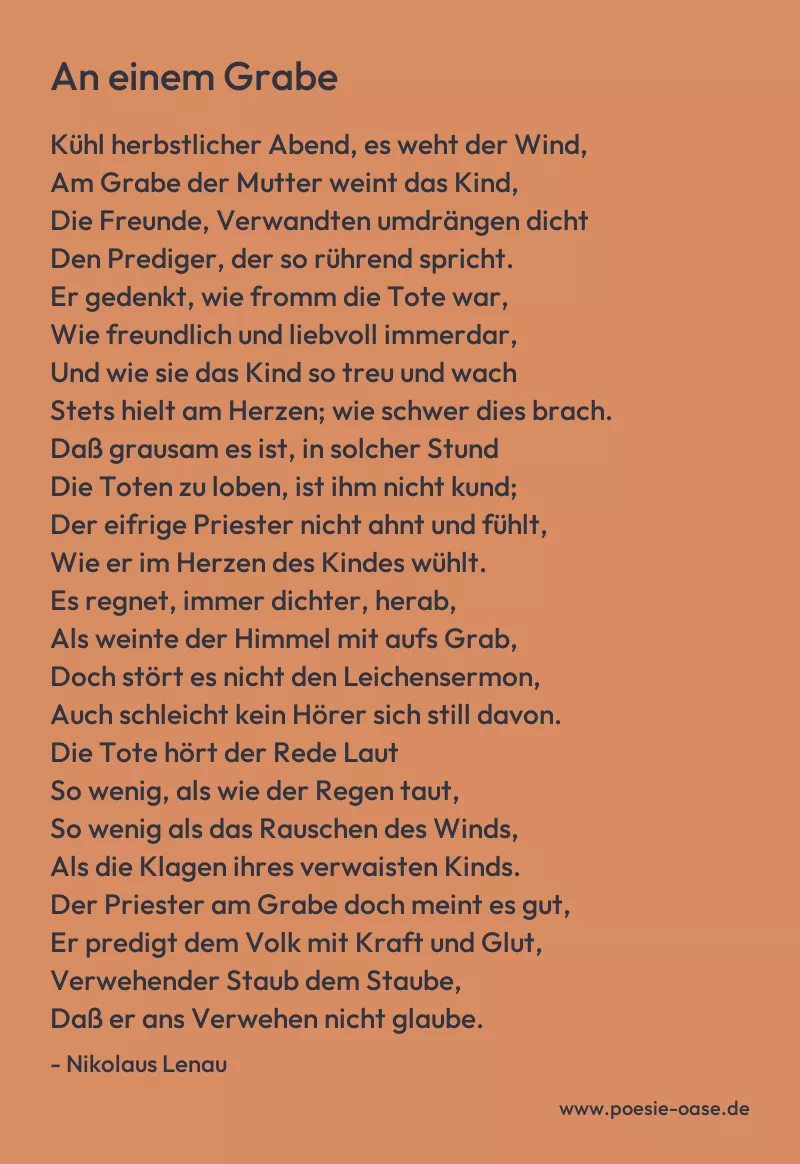
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An einem Grabe“ von Nikolaus Lenau zeichnet ein eindringliches Bild der Trauer und des Verlustes am Grab einer Mutter. Es beginnt mit der Beschreibung einer kühlen, herbstlichen Abendstimmung, die durch den wehenden Wind und die Tränen des Kindes eine melancholische Atmosphäre schafft. Diese äußeren Umstände spiegeln die innere Gefühlswelt der Anwesenden wider, insbesondere des Kindes, das im Mittelpunkt der Szene steht. Die detaillierte Schilderung des Predigers und seiner Worte kontrastiert dabei auf subtile Weise mit der stummen Trauer des Kindes und der Distanz zur eigentlichen Toten.
Der zweite Teil des Gedichts rückt die Diskrepanz zwischen der frommen Rede des Predigers und der tatsächlichen Erfahrung des Kindes in den Vordergrund. Während der Prediger die Tugenden der Verstorbenen hervorhebt, verfehlt er die wahre Tiefe des Schmerzes des Kindes, das durch seine Worte zusätzlich aufgewühlt wird. Die wiederholte Betonung, dass die Tote die Worte des Predigers ebenso wenig hört wie den Regen oder den Wind, unterstreicht die Sinnlosigkeit der Predigt im Angesicht des Todes und des tiefen Verlustes. Die Natur selbst scheint mit den Tränen des Himmels zu reagieren, doch selbst dies vermag die andauernde Zeremonie nicht zu unterbrechen.
Lenau nutzt poetische Bilder, um die Entfremdung von der Realität der Trauer darzustellen. Die Metapher vom „verwehenden Staub“ am Ende des Gedichts deutet auf eine Distanzierung des Predigers von der Erfahrung des Todes hin, da er die Realität der Vergänglichkeit leugnet. Während die Anwesenden in der Zeremonie verharren, fokussiert das Gedicht die tatsächliche Erfahrung der Trauer, die sich in der Stille des Kindes verdichtet. Die Verwendung einfacher, aber aussagekräftiger Worte verstärkt die emotionale Wirkung und lässt den Leser an der tiefen Verzweiflung und dem Verlust teilhaben.
Das Gedicht ist somit eine Meditation über die Unfähigkeit der Worte, den Schmerz des Verlustes zu erfassen und die Leere zu füllen, die durch den Tod eines geliebten Menschen entsteht. Es kritisiert die Formalität und das ritualisierte Verhalten in solchen Momenten und konzentriert sich stattdessen auf die rohe, unverfälschte Erfahrung der Trauer, die im Herzen des Kindes ihren Ausdruck findet. Lenau gelingt es, durch die Beschreibung der äußeren und inneren Landschaften einen universellen Ausdruck der Trauer zu schaffen.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
