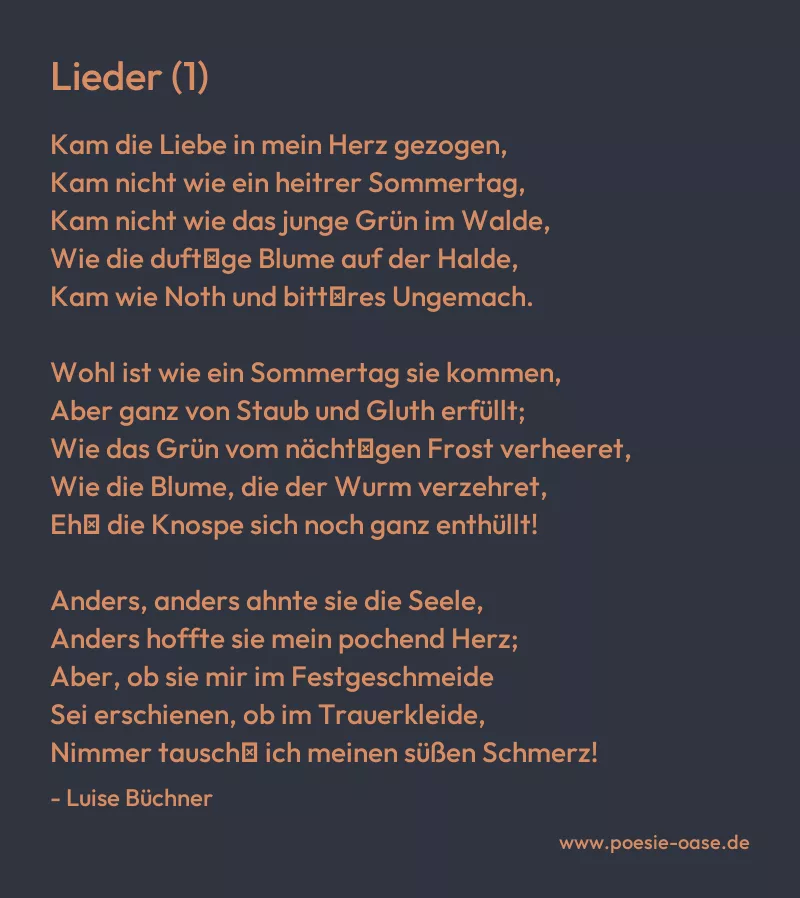Lieder (1)
Kam die Liebe in mein Herz gezogen,
Kam nicht wie ein heitrer Sommertag,
Kam nicht wie das junge Grün im Walde,
Wie die duft′ge Blume auf der Halde,
Kam wie Noth und bitt′res Ungemach.
Wohl ist wie ein Sommertag sie kommen,
Aber ganz von Staub und Gluth erfüllt;
Wie das Grün vom nächt′gen Frost verheeret,
Wie die Blume, die der Wurm verzehret,
Eh′ die Knospe sich noch ganz enthüllt!
Anders, anders ahnte sie die Seele,
Anders hoffte sie mein pochend Herz;
Aber, ob sie mir im Festgeschmeide
Sei erschienen, ob im Trauerkleide,
Nimmer tausch′ ich meinen süßen Schmerz!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
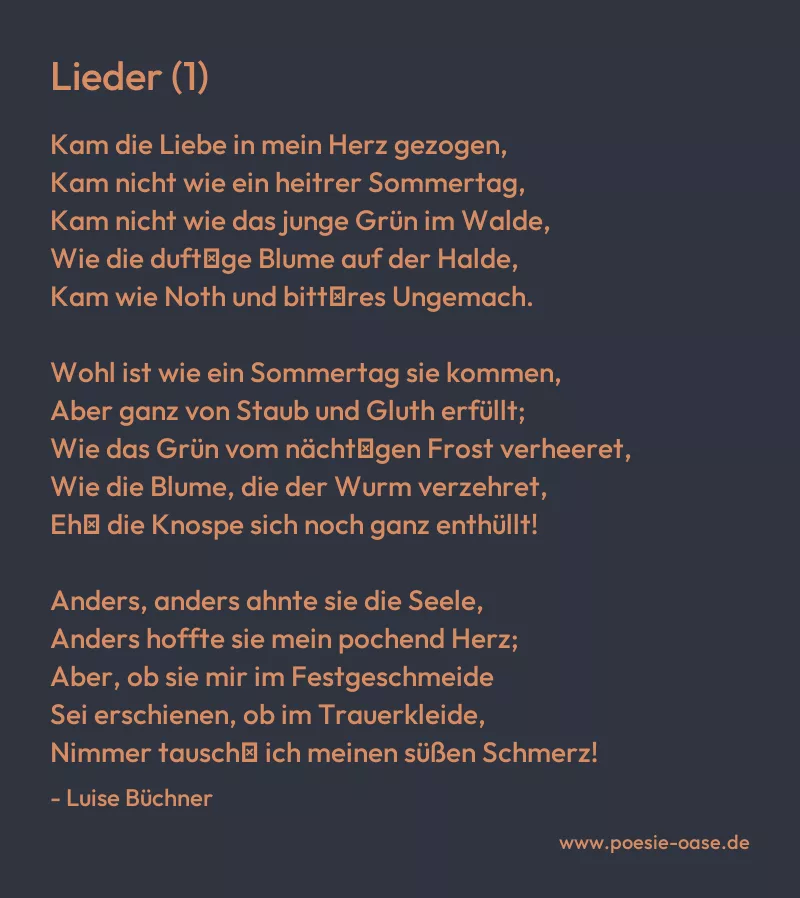
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Lieder (1)“ von Luise Büchner zeichnet ein Bild der Liebe, das sich deutlich von romantischen Erwartungen unterscheidet. Es beginnt mit einer Feststellung: Die Liebe kam nicht mit den üblichen Attributen des Glücks und der Freude. Stattdessen wird sie mit „Noth und bitt′res Ungemach“ assoziiert, was eine düstere Stimmung und eine Erwartung von Leid erzeugt. Diese Eröffnung etabliert einen Kontrast zwischen den konventionellen Vorstellungen von Liebe und der Realität, wie sie die sprechende Figur erlebt.
Der zweite Abschnitt verstärkt diese anfängliche Disillusionierung. Die Liebe wird zwar kurzzeitig mit Elementen der Freude assoziiert – „wie ein Sommertag“, „wie das junge Grün“ und „wie die duft′ge Blume“ – aber diese Assoziationen werden sogleich relativiert. Das „Sommertag“ ist „ganz von Staub und Gluth erfüllt“, das Grün wird vom Frost zerstört und die Blume vom Wurm zerfressen, noch bevor sie sich entfalten kann. Diese Bilder unterstreichen die Vergänglichkeit und die zerstörerische Kraft der Liebe. Sie suggerieren, dass selbst die vermeintlich schönen Aspekte der Liebe durch Schmerz und Zerstörung getrübt werden.
Im letzten Teil des Gedichts wird der emotionale Kern der Aussage deutlich. Die Seele hatte andere Erwartungen, das Herz andere Hoffnungen. Die sprechende Figur räumt ein, dass sie die Liebe anders erwartet hatte. Der zentrale Punkt ist jedoch die Akzeptanz des Schmerzes. Unabhängig davon, ob die Liebe in „Festgeschmeide“ oder „Trauerkleide“ erscheint, wird der Schmerz nicht als etwas Negatives wahrgenommen, sondern als „süß“. Diese Ambivalenz deutet auf eine tiefe emotionale Verbundenheit und die Erkenntnis, dass der Schmerz untrennbar mit der Erfahrung der Liebe verbunden ist.
Die Stärke des Gedichts liegt in der Ehrlichkeit und der Tiefe der Gefühle. Büchner entwirft ein komplexes Bild der Liebe, das weit über die klischeehaften Darstellungen hinausgeht. Die Verwendung von Naturmetaphern, die sowohl Schönheit als auch Zerstörung umfassen, verstärkt die Vielschichtigkeit der Erfahrung. Die abschließende Aussage der Akzeptanz des Schmerzes ist ein Bekenntnis zur Authentizität der eigenen Gefühle und zur Erkenntnis, dass die wahre Intensität der Liebe oft mit Leid verbunden ist.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.