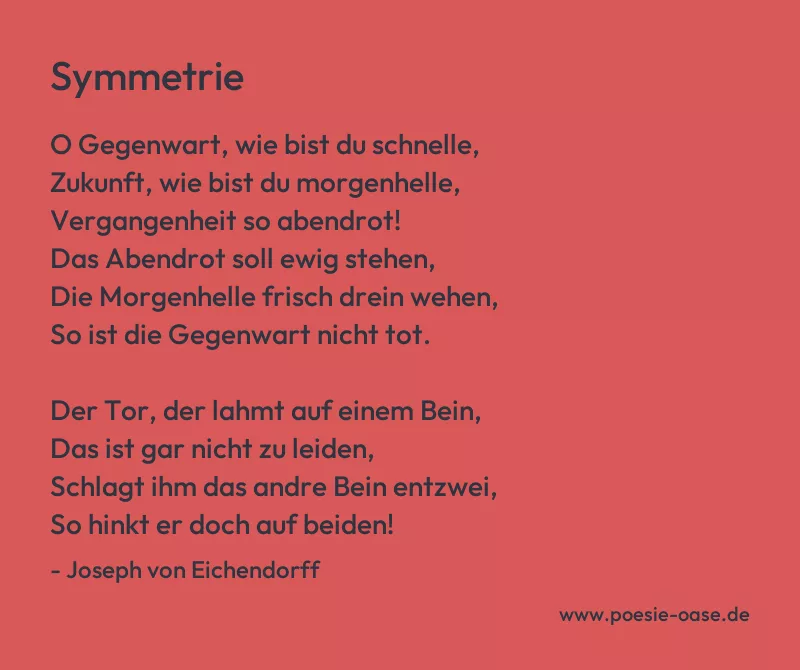Symmetrie
O Gegenwart, wie bist du schnelle,
Zukunft, wie bist du morgenhelle,
Vergangenheit so abendrot!
Das Abendrot soll ewig stehen,
Die Morgenhelle frisch drein wehen,
So ist die Gegenwart nicht tot.
Der Tor, der lahmt auf einem Bein,
Das ist gar nicht zu leiden,
Schlagt ihm das andre Bein entzwei,
So hinkt er doch auf beiden!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
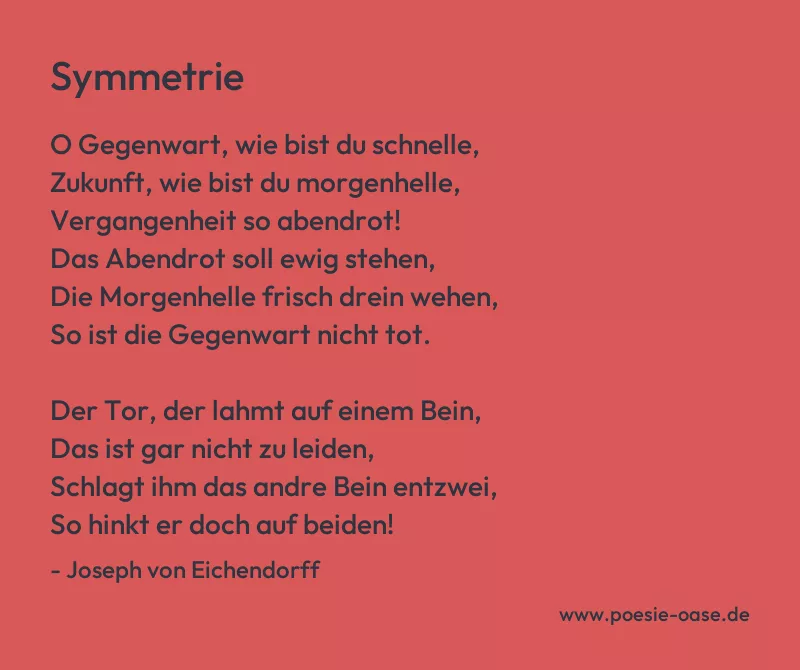
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Symmetrie“ von Joseph von Eichendorff zeichnet sich durch einen formalen Aufbau und eine überraschende inhaltliche Wendung aus, die Fragen nach der Natur von Zeit und Gleichgewicht aufwirft. Der erste Teil des Gedichts, der die ersten vier Verse umfasst, zielt darauf ab, die unterschiedlichen Zeitebenen – Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit – in Bezug zueinander zu setzen. Die Verwendung von metaphorischen Bildern wie „schnelle“, „morgenhelle“ und „abendrot“ verleiht jeder Zeitdimension eine spezifische Atmosphäre und suggeriert eine gewisse Wertigkeit: Die Gegenwart ist flüchtig, die Zukunft strahlt Hoffnung aus, und die Vergangenheit wird durch das Abendrot romantisiert. Die Wiederholung der Aufforderung im fünften Vers deutet auf einen Wunsch nach Ewigkeit für die Schönheit des Abendrots hin, was die Gegenwart vor dem Tod bewahren würde.
Der zweite Teil des Gedichts vollzieht jedoch einen radikalen Bruch mit der romantischen Betrachtung von Zeit und Raum und präsentiert eine groteske Szene: einen Lahmen, der auf einem Bein humpelnd dargestellt wird. Die sprachliche Wahl, insbesondere die Formulierung „Das ist gar nicht zu leiden,“ zeigt eine zunehmende Aggression und eine Ungeduld mit dem Ungleichgewicht. Der abschließende Vers schlägt eine grausame „Lösung“ vor, die Symmetrie durch Gewalt erzwingen soll: Das zweite Bein soll gebrochen werden, um beide Beine unbrauchbar zu machen, das heißt, die Hinkerei auf beiden Beinen. Diese gewaltsame Handlung dient als makaberes Gleichnis für die Erlangung von Gleichgewicht, wobei die Zerstörung als Mittel zur Erreichung eines vermeintlichen Ideals dient.
Die eigentliche Ironie des Gedichts liegt in der Gegenüberstellung der ästhetischen, romantischen Betrachtung der Zeit im ersten Teil und der brutalen, absurden Lösung im zweiten Teil. Eichendorff suggeriert, dass der Drang nach Symmetrie und Ausgleich bis zur Gewalttätigkeit führen kann, wenn er als Selbstzweck verstanden wird. Die scheinbare Logik hinter der Aktion – die vollständige Lahmheit als „Gleichgewicht“ – ist in Wirklichkeit absurd und zeugt von einer perversen Logik. Diese Paradoxie hinterfragt die Natur von Schönheit, Vollkommenheit und die menschliche Neigung, Ordnung in einer oft chaotischen Welt zu suchen.
Die Symmetrie des Gedichts selbst – der Wechsel von der Betrachtung der Zeit zur Darstellung der physischen Zerstörung – spiegelt die thematische Auseinandersetzung wider. Es entsteht eine Spannung zwischen dem Wunsch nach ästhetischer Harmonie, die im ersten Teil angedeutet wird, und der gewaltsamen Umsetzung dieses Wunsches im zweiten. Eichendorff nutzt somit die Form, um die inhärente Fragilität und die Gefahren eines übersteigerten Strebens nach Ausgleich aufzuzeigen. Das Gedicht ist somit eine subtile Kritik an der Fixierung auf Perfektion und ein Appell zur Vorsicht vor den Extremen, die aus dem Wunsch nach Ordnung und Symmetrie erwachsen können.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.