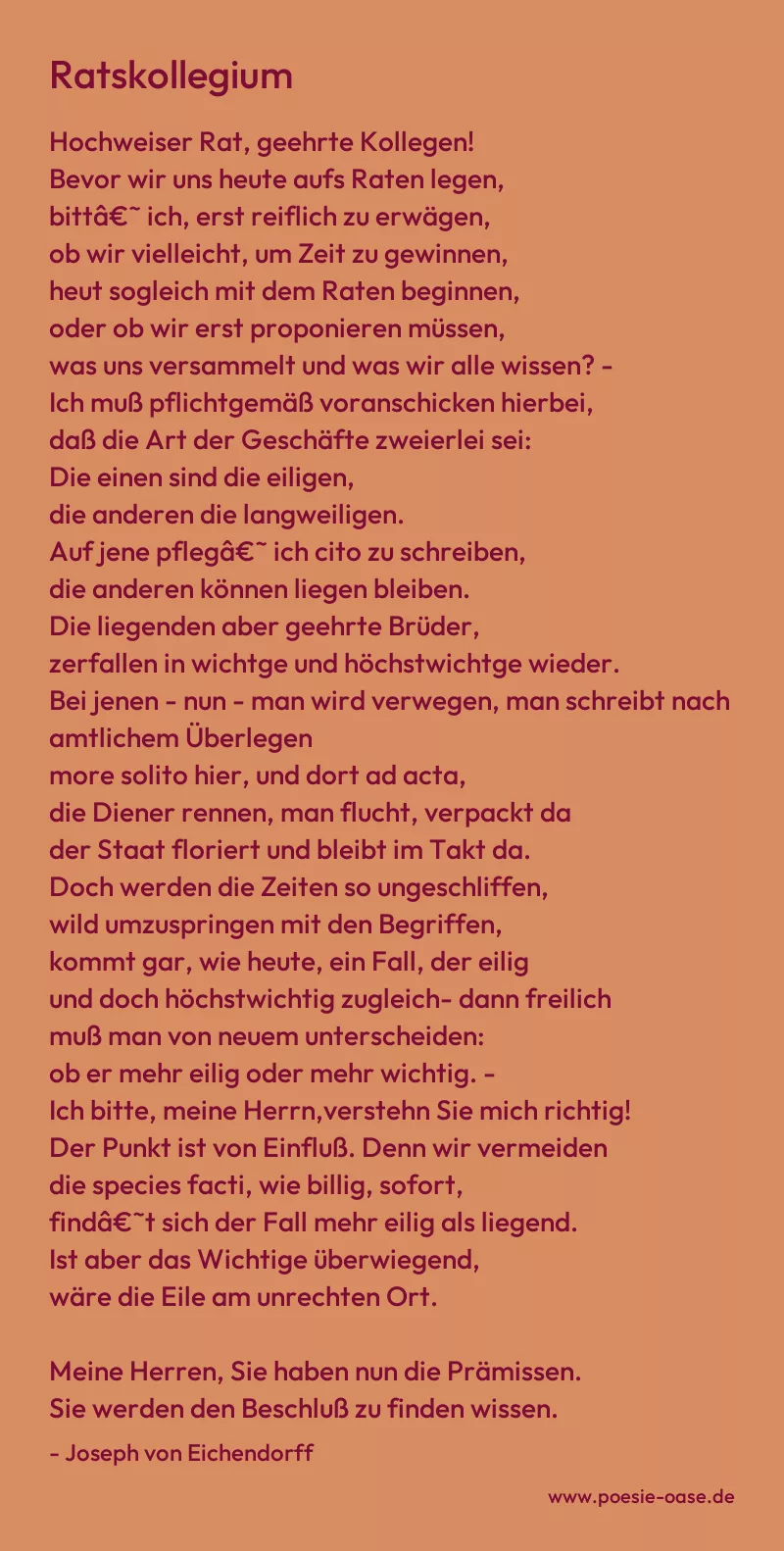Ratskollegium
Hochweiser Rat, geehrte Kollegen!
Bevor wir uns heute aufs Raten legen,
bitt‘ ich, erst reiflich zu erwägen,
ob wir vielleicht, um Zeit zu gewinnen,
heut sogleich mit dem Raten beginnen,
oder ob wir erst proponieren müssen,
was uns versammelt und was wir alle wissen? –
Ich muß pflichtgemäß voranschicken hierbei,
daß die Art der Geschäfte zweierlei sei:
Die einen sind die eiligen,
die anderen die langweiligen.
Auf jene pfleg‘ ich cito zu schreiben,
die anderen können liegen bleiben.
Die liegenden aber geehrte Brüder,
zerfallen in wichtge und höchstwichtge wieder.
Bei jenen – nun – man wird verwegen, man schreibt nach amtlichem Überlegen
more solito hier, und dort ad acta,
die Diener rennen, man flucht, verpackt da
der Staat floriert und bleibt im Takt da.
Doch werden die Zeiten so ungeschliffen,
wild umzuspringen mit den Begriffen,
kommt gar, wie heute, ein Fall, der eilig
und doch höchstwichtig zugleich- dann freilich
muß man von neuem unterscheiden:
ob er mehr eilig oder mehr wichtig. –
Ich bitte, meine Herrn,verstehn Sie mich richtig!
Der Punkt ist von Einfluß. Denn wir vermeiden
die species facti, wie billig, sofort,
find‘t sich der Fall mehr eilig als liegend.
Ist aber das Wichtige überwiegend,
wäre die Eile am unrechten Ort.
Meine Herren, Sie haben nun die Prämissen.
Sie werden den Beschluß zu finden wissen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
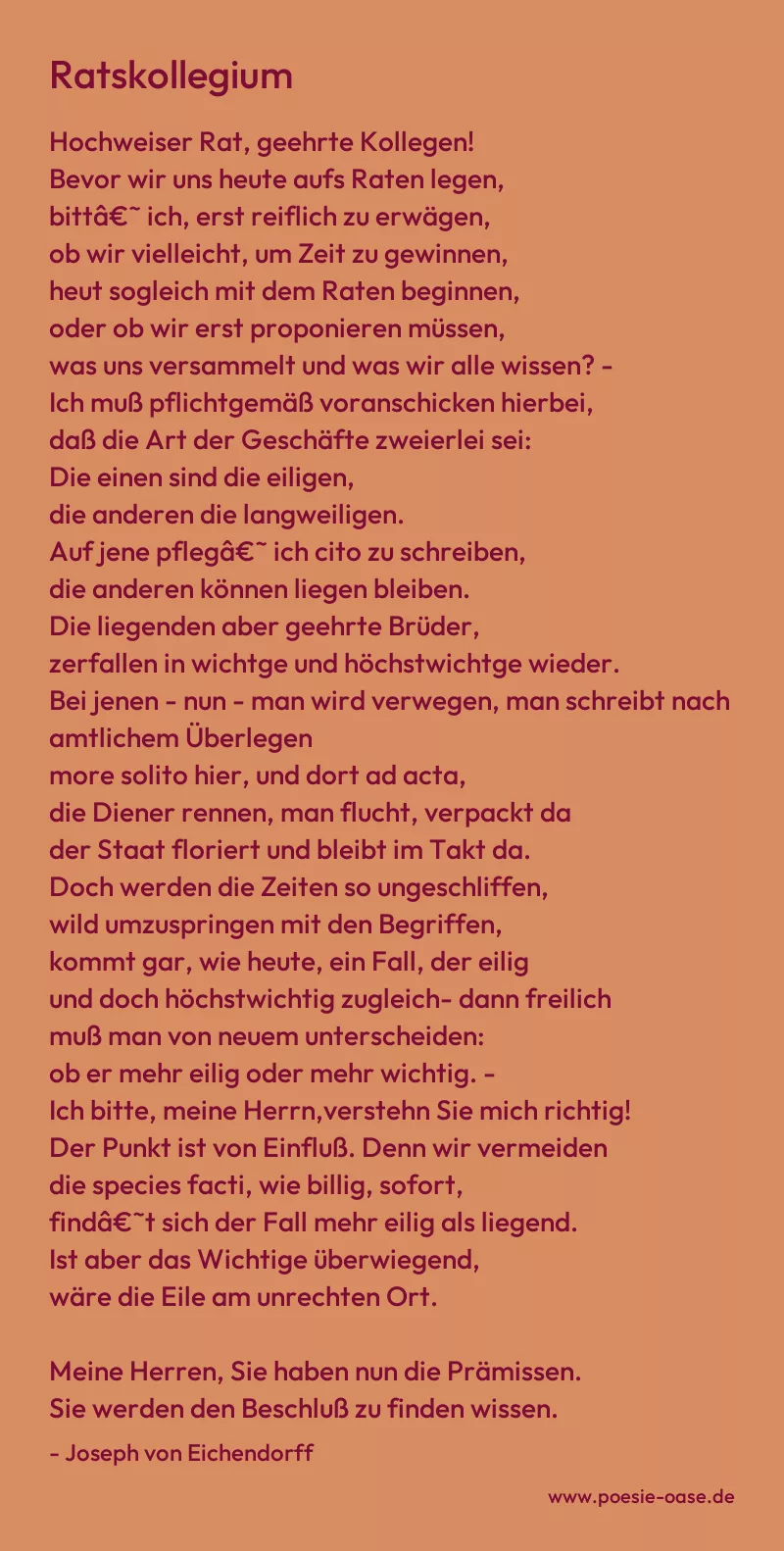
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ratskollegium“ von Joseph von Eichendorff ist eine humorvolle Satire auf die Bürokratie und das scheinbar endlose Hin und Her in den Entscheidungsprozessen staatlicher Institutionen. Der Autor präsentiert in ironischer Weise die komplizierten und zeitraubenden Überlegungen, die vor einer scheinbar einfachen Entscheidung angestellt werden müssen. Das Gedicht beginnt mit einer förmlichen Ansprache an die „hochweisen“ Ratskollegen und etabliert somit sofort den Ton einer offiziellen Sitzung.
Der Redner stellt eine Vielzahl von Fragen und Erwägungen an, bevor überhaupt mit der eigentlichen Beratung begonnen wird. Er differenziert zwischen eiligen und langweiligen Geschäften, wobei die Unterscheidung zwischen „wichtigen“ und „höchstwichtigen“ Angelegenheiten die Absurdität des bürokratischen Prozesses weiter unterstreicht. Die Beschreibung des Umgangs mit den Akten und die daraus resultierenden Reaktionen, wie das „Fluchen“ und das „Verpacken“, zeichnen ein lebendiges Bild des Chaos und der Ineffizienz, das in der Bürokratie herrscht.
Besonders satirisch ist der Abschnitt, in dem der Redner die komplizierte Situation eines „eiligen und doch höchstwichtigen“ Falls analysiert. Hier wird die Entscheidung, ob die „Eile“ oder die „Wichtigkeit“ überwiegen soll, zu einer fast philosophischen Frage erhoben. Eichendorff kritisiert die Neigung der Bürokratie, sich in Details zu verlieren und unnötige Unterscheidungen zu treffen, anstatt sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Der abschließende Appell an die Kollegen, die „Prämissen“ zu verstehen und den „Beschluß zu finden“, verdeutlicht die Überzeugung, dass die eigentliche Arbeit oft hinter den vielen formalen Schritten und überflüssigen Erwägungen verschwindet.
Die Sprache des Gedichts ist geprägt von juristischen und bürokratischen Begriffen, was den satirischen Effekt noch verstärkt. Eichendorff parodiert den förmlichen Stil und die umständliche Ausdrucksweise, die in staatlichen Institutionen üblich sind. Indem er die Komplexität der Entscheidungsprozesse überzeichnet, enthüllt er die Ineffizienz und die Tendenz zur Selbstbeschäftigung in der Bürokratie. Das Gedicht ist ein humorvoller, aber auch scharfer Kommentar zu den Schwächen und Absurditäten des staatlichen Apparats.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.