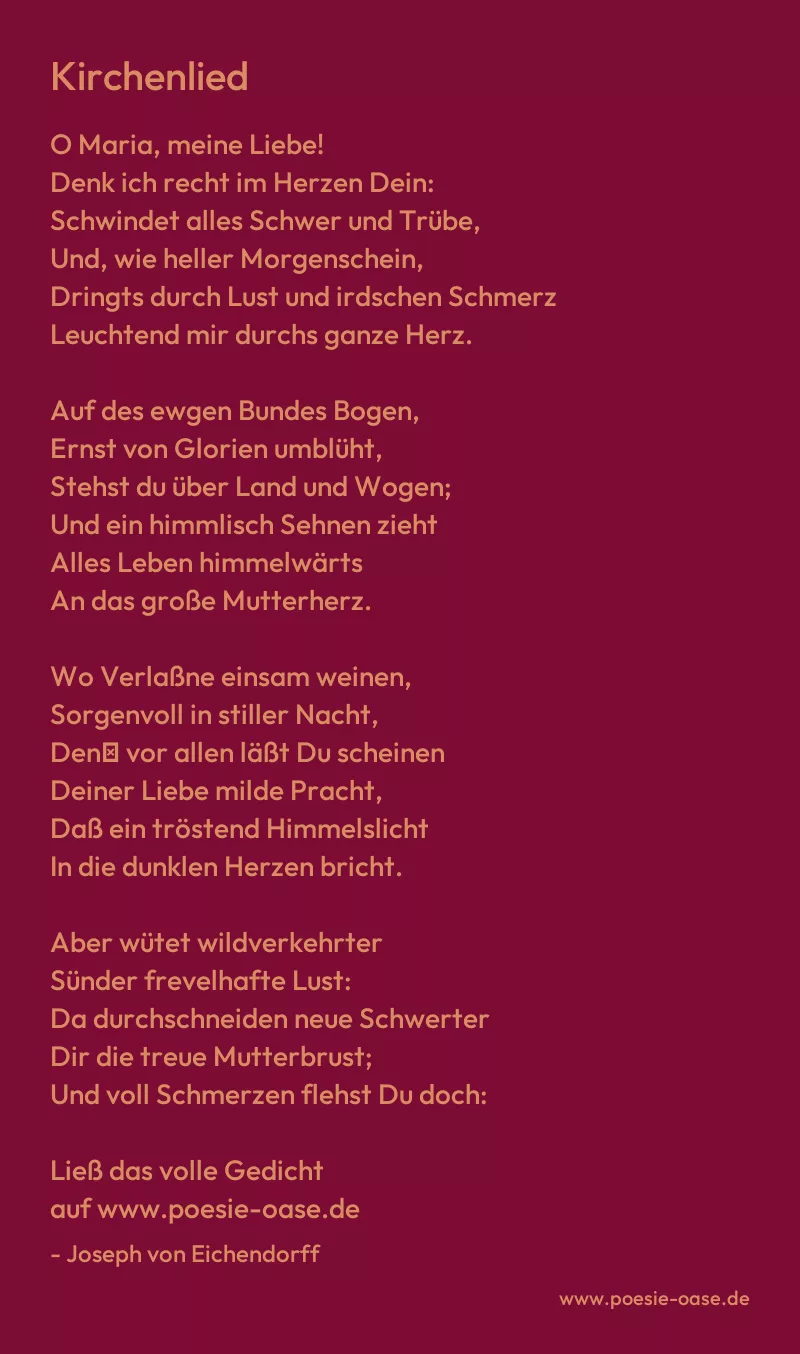Kirchenlied
O Maria, meine Liebe!
Denk ich recht im Herzen Dein:
Schwindet alles Schwer und Trübe,
Und, wie heller Morgenschein,
Dringts durch Lust und irdschen Schmerz
Leuchtend mir durchs ganze Herz.
Auf des ewgen Bundes Bogen,
Ernst von Glorien umblüht,
Stehst du über Land und Wogen;
Und ein himmlisch Sehnen zieht
Alles Leben himmelwärts
An das große Mutterherz.
Wo Verlaßne einsam weinen,
Sorgenvoll in stiller Nacht,
Den′ vor allen läßt Du scheinen
Deiner Liebe milde Pracht,
Daß ein tröstend Himmelslicht
In die dunklen Herzen bricht.
Aber wütet wildverkehrter
Sünder frevelhafte Lust:
Da durchschneiden neue Schwerter
Dir die treue Mutterbrust;
Und voll Schmerzen flehst Du doch:
Herr! Vergib, o schone noch!
Deinen Jesus in den Armen,
Übern Strom der Zeit gestellt,
Als das himmlische Erbarmen
Hütest Du getreu die Welt,
Daß im Sturm, der trübe weht,
Dir kein Kind verloren geht.
Wenn die Menschen mich verlassen
In der letzten stillen Stund,
Laß mich fest das Kreuz umfassen.
Aus dem dunklen Erdengrund
Leite liebreich mich hinaus,
Mutter, in des Vaters Haus!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
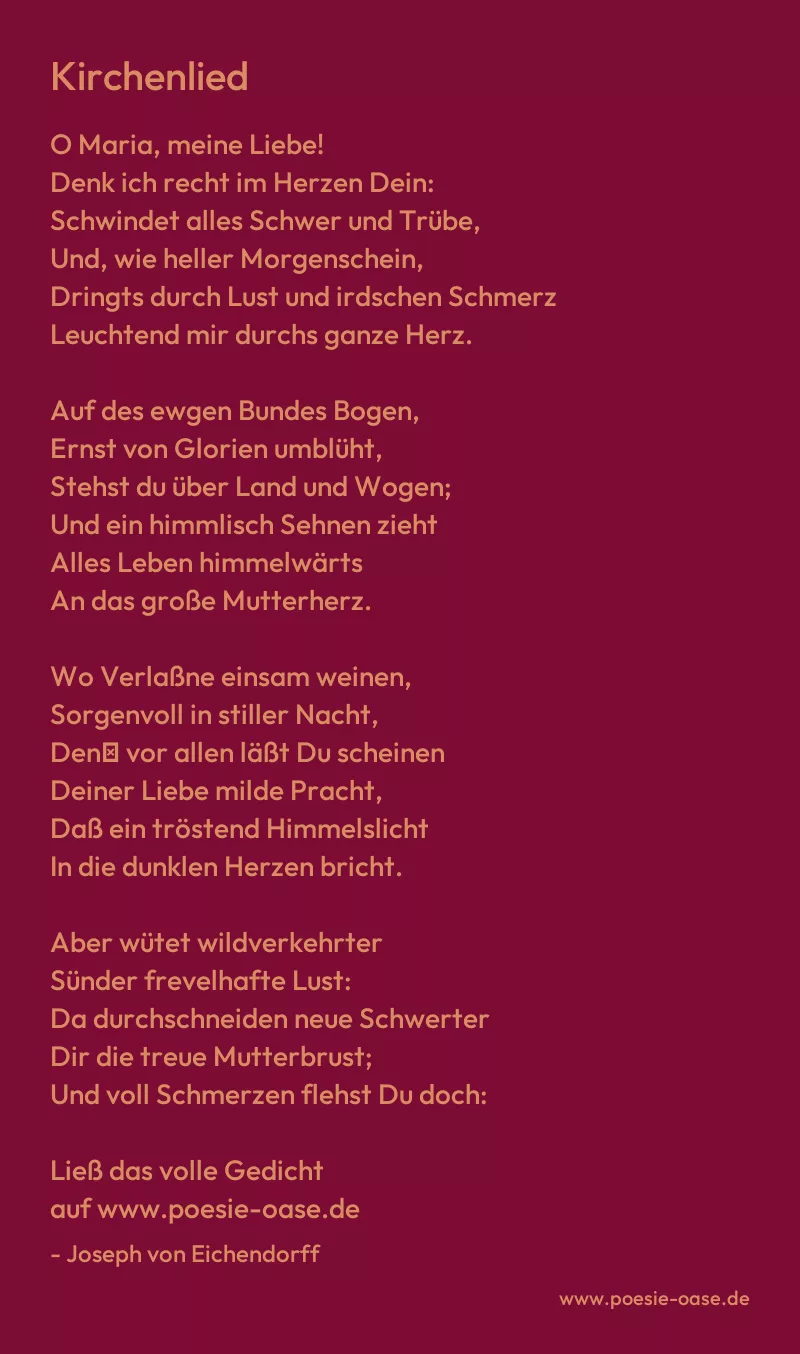
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Kirchenlied“ von Joseph von Eichendorff ist eine innige Anrufung an Maria, die Mutter Jesu, und zeugt von tiefer Gläubigkeit und Vertrauen. Es zeichnet das Bild einer liebevollen, allgegenwärtigen Mutterfigur, die Trost, Hoffnung und Schutz in einer oft von Leid und Sünde geprägten Welt bietet. Das Gedicht ist in fünf Strophen unterteilt, die verschiedene Aspekte der mütterlichen Fürsorge Marias beleuchten, und schließt mit einem Gebet um Beistand im Sterben.
Die erste Strophe beginnt mit einem Ausruf der Verehrung: „O Maria, meine Liebe!“. Hier wird die persönliche Beziehung des lyrischen Ichs zu Maria betont. Die Erwähnung des Namens Marias im Herzen des Sprechers, bewirkt das Schwinden von Leid und Traurigkeit. Der Einfluss Marias auf das lyrische Ich wird mit dem hellen Morgenschein verglichen, was das Licht und die Wärme, die von Maria ausgehen, hervorhebt. Die nächste Strophe beschreibt Maria als eine alles überblickende Gestalt, die über allem steht und ein himmlisches Sehnen nach Erlösung in den Menschen weckt.
In den folgenden Strophen wird die Rolle Marias als Trösterin der Leidenden und als Beschützerin der Welt hervorgehoben. Sie wird als diejenige dargestellt, die Trost in der Nacht bringt, wo Verlassene weinen und durch die dunklen Herzen ein tröstendes Himmelslicht brechen lässt. Doch Maria leidet auch mit, wenn die Menschen sündigen. Die vierte Strophe beschreibt, wie die Sünde die Mutterbrust durchschneidet und Maria in Schmerz versetzt, aber dennoch um Vergebung fleht.
Die fünfte Strophe zeigt Maria als Hüterin der Welt, die ihren Sohn Jesus in den Armen hält und die Menschen vor dem Sturm der Zeit beschützt. Diese Rolle wird in der letzten Strophe durch ein Gebet um Beistand im Sterben ergänzt. Das lyrische Ich bittet Maria, es in der Todesstunde nicht zu verlassen und ihm den Weg zum Vater, also zu Gott, zu weisen. Das Gedicht schließt mit einer Bitte um Erlösung und Ewigkeit im Angesicht des Todes.
Insgesamt ist das „Kirchenlied“ ein Ausdruck tiefen Glaubens und Vertrauens in die Muttergottes. Es vermittelt die tröstliche Botschaft, dass Maria in allen Lebenslagen eine schützende und liebende Präsenz ist. Die sprachliche Gestaltung, geprägt von einfachen Bildern und einer gefühlvollen Sprache, unterstützt die innige Atmosphäre und macht das Gedicht zu einem berührenden Zeugnis christlicher Frömmigkeit.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.