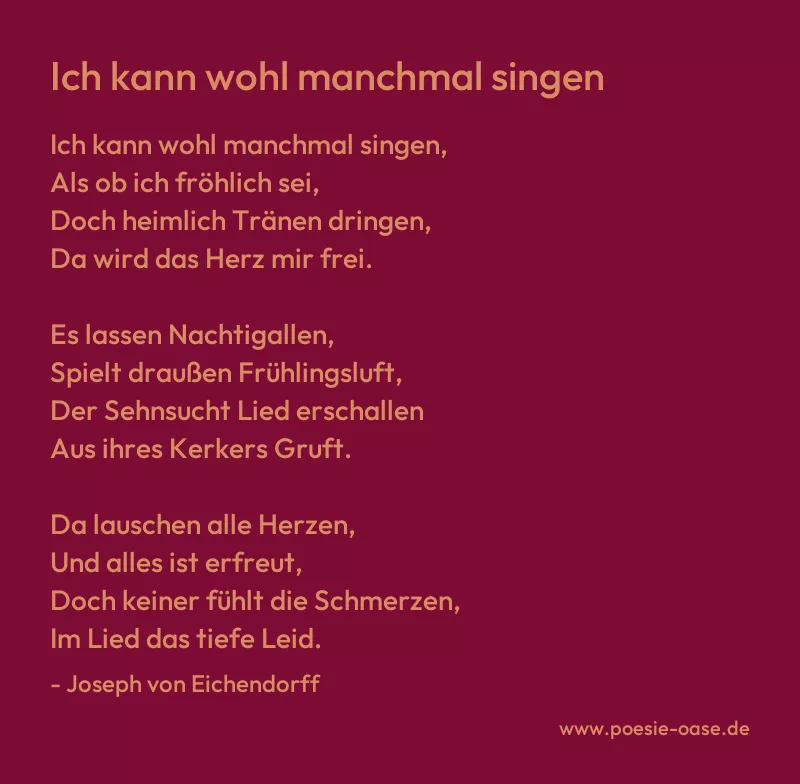Ich kann wohl manchmal singen
Ich kann wohl manchmal singen,
Als ob ich fröhlich sei,
Doch heimlich Tränen dringen,
Da wird das Herz mir frei.
Es lassen Nachtigallen,
Spielt draußen Frühlingsluft,
Der Sehnsucht Lied erschallen
Aus ihres Kerkers Gruft.
Da lauschen alle Herzen,
Und alles ist erfreut,
Doch keiner fühlt die Schmerzen,
Im Lied das tiefe Leid.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
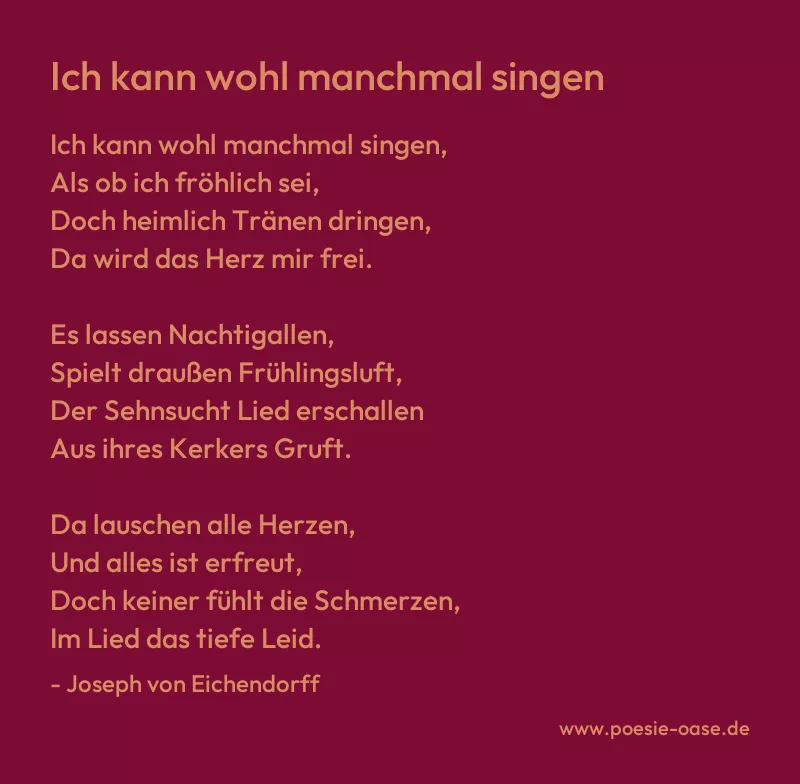
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ich kann wohl manchmal singen“ von Joseph von Eichendorff ist eine tiefgründige Reflexion über die Natur der menschlichen Emotionen und die Diskrepanz zwischen äußerer Erscheinung und innerer Gefühlswelt. Es thematisiert das Phänomen, Freude vorzutäuschen, während im Verborgenen Trauer und Sehnsucht wüten. Die ersten vier Verse etablieren diese Ambivalenz, indem sie die scheinbare Fröhlichkeit des Sängers der versteckten Tränen gegenüberstellen, die das Herz befreien. Hier wird ein Kontrast geschaffen, der das zentrale Thema des Gedichts vorbereitet: die Maske der Freude und die Wirklichkeit des Schmerzes.
Die zweite Strophe erweitert das Bild, indem sie eine Parallele zur Nachtigall zieht, die im Frühling ihr Lied aus der „Kerkers Gruft“ erklingen lässt. Dieses Bild ist von besonderer Bedeutung, da es die Verbindung von Schönheit und Leid verdeutlicht. Die Nachtigall, Symbol für Gesang und Freude, singt ihr Lied, obwohl sie sich in einer Gefangenschaft befindet, die ihr Leid symbolisiert. Dies spiegelt die Erfahrung des Dichters wider, der trotz seiner Gesänge, die nach außen hin Freude vermitteln, im Inneren von Trauer und Sehnsucht geplagt wird. Die Verwendung des Wortes „Gruft“ verstärkt das Gefühl der Einsamkeit und des Verlustes.
In der abschließenden Strophe wird die Thematik auf die Rezeption des Liedes ausgedehnt. Während „alle Herzen“ dem Gesang der Nachtigall und der scheinbaren Freude des Sängers lauschen und „erfreut“ sind, ist sich niemand der zugrundeliegenden Schmerzen bewusst. Dies unterstreicht die Isolation des Künstlers und die Schwierigkeit, tiefe Emotionen zu teilen und zu verstehen. Die letzten beiden Zeilen verdeutlichen die tragische Ironie des Gedichts: Die Schönheit des Liedes dient als Maske für das „tiefe Leid“, das der Sänger empfindet, wodurch die Kluft zwischen Schein und Sein noch verstärkt wird.
Insgesamt ist das Gedicht eine melancholische Betrachtung über die Komplexität der menschlichen Gefühlswelt. Es offenbart die oft unvereinbaren Aspekte von Freude und Trauer, Schönheit und Schmerz, und die damit verbundene Erfahrung von Einsamkeit und Unverständnis. Eichendorffs Werk lädt den Leser ein, über die Oberfläche der Erscheinungen hinauszuschauen und die verborgenen Emotionen zu erkennen, die das menschliche Dasein prägen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.