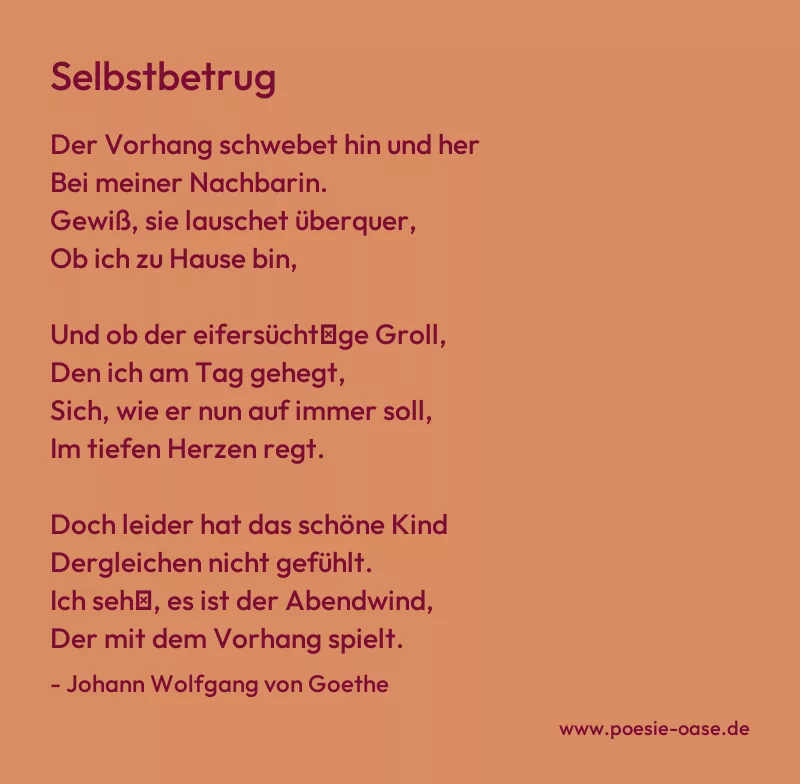Selbstbetrug
Der Vorhang schwebet hin und her
Bei meiner Nachbarin.
Gewiß, sie lauschet überquer,
Ob ich zu Hause bin,
Und ob der eifersücht′ge Groll,
Den ich am Tag gehegt,
Sich, wie er nun auf immer soll,
Im tiefen Herzen regt.
Doch leider hat das schöne Kind
Dergleichen nicht gefühlt.
Ich seh′, es ist der Abendwind,
Der mit dem Vorhang spielt.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
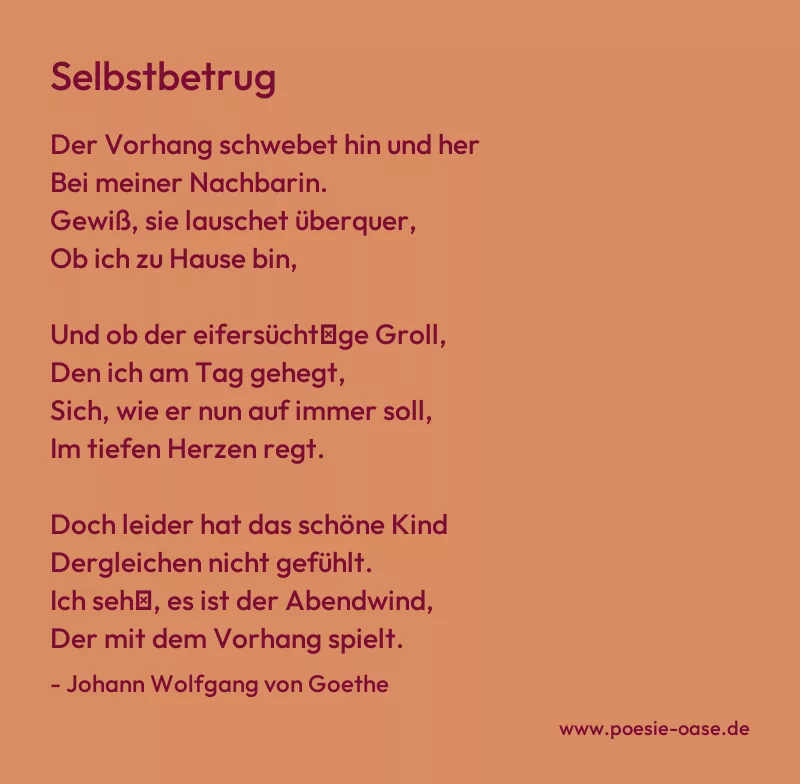
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Selbstbetrug“ von Johann Wolfgang von Goethe zeichnet sich durch seine subtile Ironie und die Darstellung einer Selbsttäuschung aus. Es beginnt mit der scheinbaren Gewissheit des lyrischen Ichs, dass die Nachbarin heimlich ihr Verhalten beobachtet, um Eifersucht zu provozieren. Die Verwendung des Wortes „gewiss“ und die direkte Ansprache lassen den Leser an der anfänglichen Überzeugung des Sprechers teilhaben. Der erste Teil des Gedichts etabliert eine Szene der Misstrauen und der vermeintlichen emotionalen Auseinandersetzung.
Der zweite Teil des Gedichts nimmt diese Annahmen auf und verstärkt sie, indem er die tiefe emotionale Unruhe des lyrischen Ichs beschreibt, die sich im „eifersüchtigen Groll“ des Tages äußert. Die Zeilen „Und ob der eifersücht′ge Groll, / Den ich am Tag gehegt, / Sich, wie er nun auf immer soll, / Im tiefen Herzen regt“ verdeutlichen das Bedürfnis nach Bestätigung und die Hoffnung, dass die eigenen Gefühle auch von der anderen Person erwidert werden. Die Struktur des Gedichts verstärkt die Dramatik, da die Erwartungshaltung des lyrischen Ichs bis zum Höhepunkt aufgebaut wird.
Die Pointe des Gedichts liegt im letzten Teil, wo die gesamte Annahme entlarvt wird. Die Realität ist weit weniger dramatisch als angenommen: Es ist nicht die Nachbarin, sondern der „Abendwind“, der den Vorhang bewegt. Diese Wendung zeigt die Selbsttäuschung des lyrischen Ichs auf, das seine eigenen Emotionen und Ängste auf die Situation projiziert und sich in eine Illusion verstrickt hat. Die Ironie entsteht aus dem Kontrast zwischen der intensiven emotionalen Erwartung und der banalen Wirklichkeit.
Goethe meistert hier die Kunst, menschliche Schwächen wie Eifersucht, Stolz und die Neigung zur Selbsttäuschung auf humorvolle und doch tiefgründige Weise darzustellen. Das Gedicht ist ein feines Beispiel für seine Fähigkeit, Alltagsbeobachtungen in poetische Form zu gießen und dem Leser einen Spiegel vorzuhalten. Die scheinbare Einfachheit des Gedichts täuscht über die Komplexität der menschlichen Psyche hinweg, die Goethe hier so meisterhaft einfängt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.