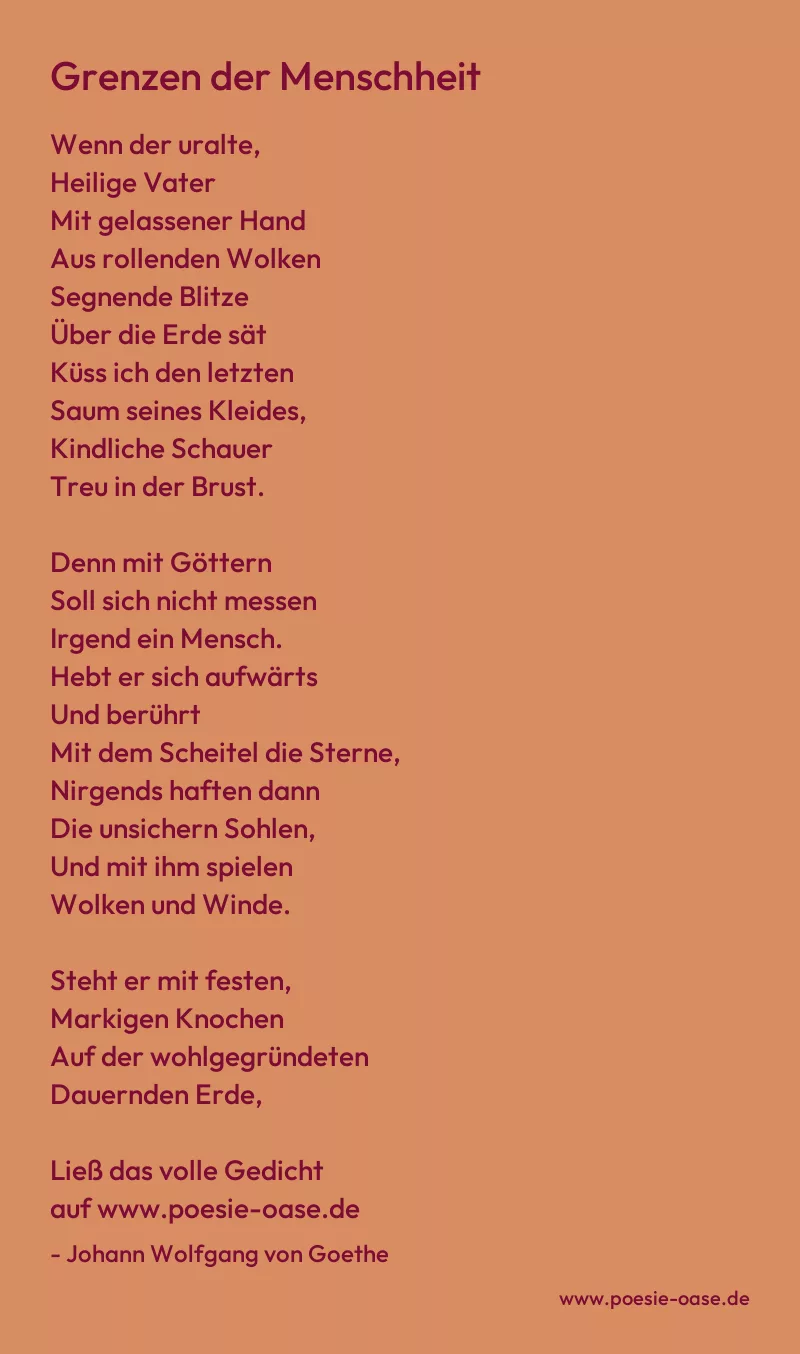Grenzen der Menschheit
Wenn der uralte,
Heilige Vater
Mit gelassener Hand
Aus rollenden Wolken
Segnende Blitze
Über die Erde sät
Küss ich den letzten
Saum seines Kleides,
Kindliche Schauer
Treu in der Brust.
Denn mit Göttern
Soll sich nicht messen
Irgend ein Mensch.
Hebt er sich aufwärts
Und berührt
Mit dem Scheitel die Sterne,
Nirgends haften dann
Die unsichern Sohlen,
Und mit ihm spielen
Wolken und Winde.
Steht er mit festen,
Markigen Knochen
Auf der wohlgegründeten
Dauernden Erde,
Reicht er nicht auf,
Nur mit der Eiche
Oder der Rebe
Sich zu vergleichen.
Was underscheidet
Götter von Menschen?
Daß viele Wellen
Vor jenen wandeln,
Ein ewiger Strom:
Uns hebt die Welle,
Verschlingt die Welle,
Und wir versinken.
Ein kleiner Ring
Begrenzt unser Leben,
Und viele Geschlechter
Reihen sie dauernd,
An ihres Daseins
Unendliche Kette.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
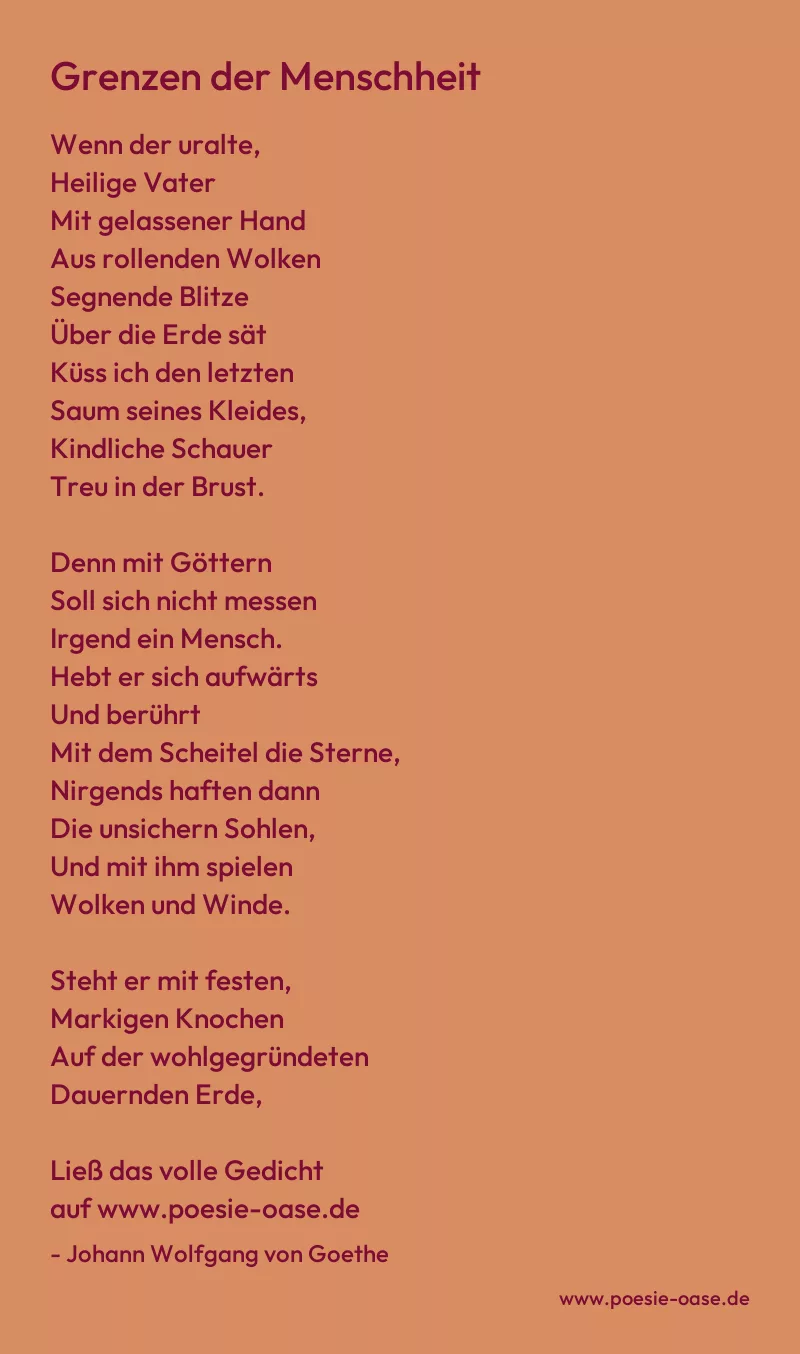
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Grenzen der Menschheit“ von Johann Wolfgang von Goethe thematisiert in eindrucksvoller Weise die Begrenztheit und die Sterblichkeit des Menschen im Vergleich zur unendlichen Macht und ewigen Natur der Götter und des Universums. Das Gedicht gliedert sich in vier Hauptabschnitte, die jeweils unterschiedliche Aspekte dieser Thematik beleuchten. Der erste Abschnitt beschreibt die Ehrfurcht und kindliche Ergriffenheit des Menschen angesichts der Allmacht des „uralten, Heiligen Vaters“, der mit seinen Blitzen die Erde segnet. Hier wird eine klare Hierarchie etabliert, in der der Mensch demütig die Größe der göttlichen Ordnung anerkennt.
Im zweiten Abschnitt wird die menschliche Anmaßung kritisiert. Der Mensch, der sich überhebt und versucht, die Grenzen seiner Existenz zu überschreiten, indem er nach den Sternen greift, verliert seinen Halt. Er wird zum Spielball der Elemente, was die Flüchtigkeit und Instabilität des menschlichen Daseins unterstreicht. Die Metaphern von „Wolken und Winden“ als Spielkameraden des Menschen verdeutlichen die fehlende Verankerung und die Ohnmacht gegenüber den Naturgewalten. Der dritte Abschnitt, in dem der Mensch mit Bäumen wie der Eiche verglichen wird, unterstreicht die Notwendigkeit der Bescheidenheit und die Begrenztheit der menschlichen Möglichkeiten.
Der vierte und letzte Abschnitt stellt den fundamentalen Unterschied zwischen Göttern und Menschen heraus: die Ewigkeit. Während die Götter in einem ewigen, unaufhörlichen Fluss wandeln, ist das menschliche Leben durch einen „kleinen Ring“ begrenzt. Die Metapher von der Welle, die den Menschen hebt und verschlingt, verdeutlicht die Vergänglichkeit und das ständige Auf und Ab des menschlichen Schicksals. Das Bild der unendlichen Kette von Geschlechtern, die sich aneinanderreihen, setzt das individuelle, begrenzte Leben in einen größeren, zeitlosen Kontext.
Goethes Gedicht ist von einer tiefen Melancholie geprägt, aber auch von einer Würde, die der Akzeptanz der menschlichen Grenzen entspringt. Es ist eine Reflexion über die menschliche Existenz, die sowohl die Ehrfurcht vor der göttlichen Ordnung als auch die Schönheit und Tragik des menschlichen Lebens feiert. Die klaren Bilder und die einfache, aber eindringliche Sprache machen das Gedicht zu einem zeitlosen Zeugnis der menschlichen Erfahrung.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.