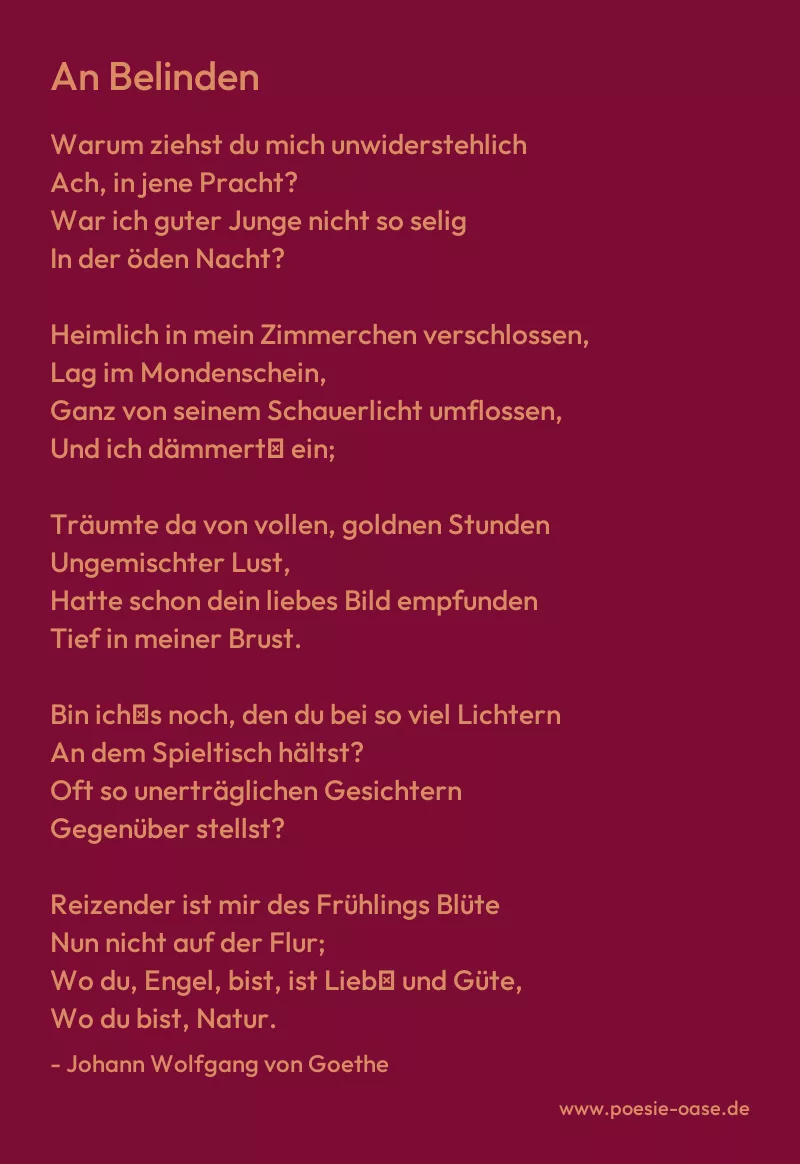An Belinden
Warum ziehst du mich unwiderstehlich
Ach, in jene Pracht?
War ich guter Junge nicht so selig
In der öden Nacht?
Heimlich in mein Zimmerchen verschlossen,
Lag im Mondenschein,
Ganz von seinem Schauerlicht umflossen,
Und ich dämmert′ ein;
Träumte da von vollen, goldnen Stunden
Ungemischter Lust,
Hatte schon dein liebes Bild empfunden
Tief in meiner Brust.
Bin ich′s noch, den du bei so viel Lichtern
An dem Spieltisch hältst?
Oft so unerträglichen Gesichtern
Gegenüber stellst?
Reizender ist mir des Frühlings Blüte
Nun nicht auf der Flur;
Wo du, Engel, bist, ist Lieb′ und Güte,
Wo du bist, Natur.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
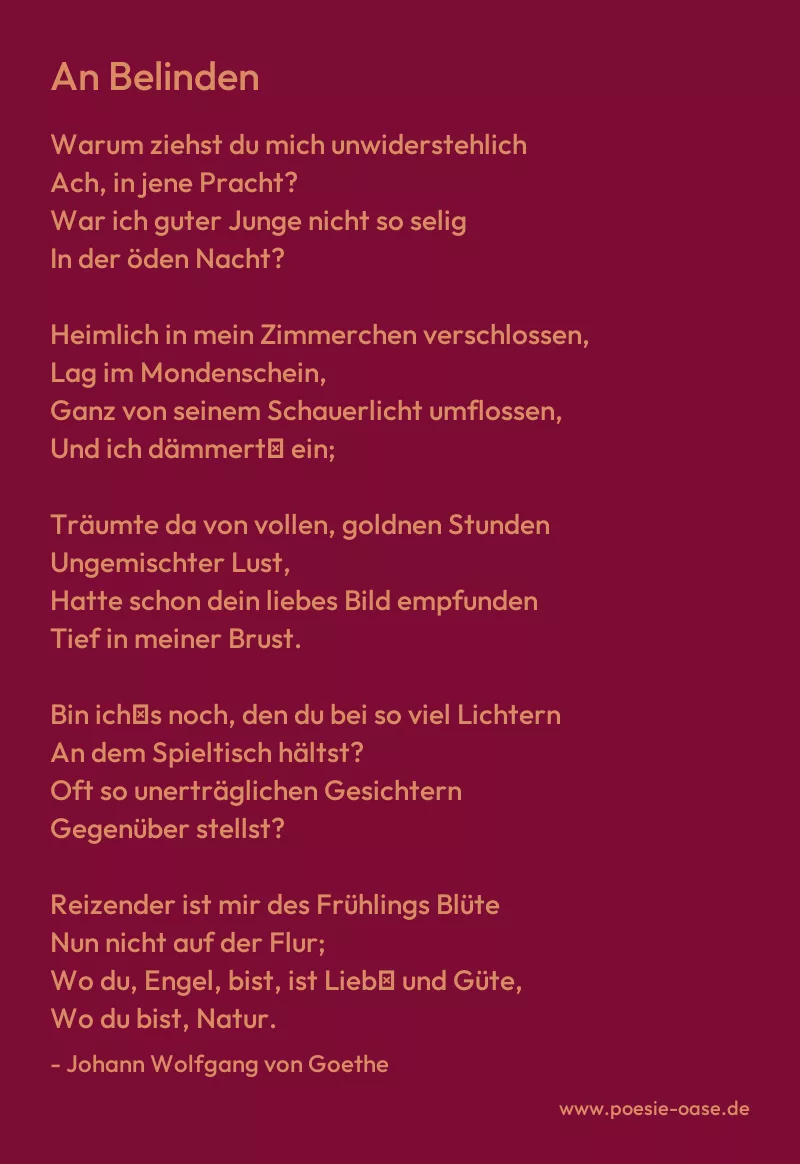
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An Belinden“ von Johann Wolfgang von Goethe ist ein Liebesgedicht, das die Entwicklung des lyrischen Ichs von einer beschaulichen, introvertierten Existenz zu einer von Leidenschaft und Verlangen geprägten Existenz beschreibt. Der Titel deutet auf die Anrede einer geliebten Person namens Belinden hin, die als Ursache für die Veränderung des Ichs dargestellt wird. Die ersten Strophen etablieren einen Kontrast zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart, wobei die Vergangenheit durch Bilder der Einsamkeit und des Mondscheins gekennzeichnet ist.
In den ersten beiden Strophen wird die Sehnsucht des Ichs nach der Verlockung durch Belinden thematisiert. Die Frage „Warum ziehst du mich unwiderstehlich / Ach, in jene Pracht?“ offenbart die Ambivalenz des lyrischen Ichs, das sich von Belinden angezogen fühlt, aber gleichzeitig die Sicherheit der Vergangenheit vermisst. Die „Pracht“ steht dabei für die Welt, die Belinden repräsentiert – eine Welt des Glanzes, der gesellschaftlichen Aktivitäten und der emotionalen Intensität. Das Ich sehnt sich nach der einfachen Freude und dem Frieden der Nacht, in der es von Träumen und dem Gefühl ungetrübter Lust erfüllt war.
Die dritte Strophe deutet auf die aufkeimende Liebe und die Vorahnung des Ichs hin. Obwohl das Ich bereits im Mondschein träumte und das „liebe Bild“ Belindens in seiner Brust empfand, ist die Verwandlung vom ruhigen Träumer zum Spieler an einem „Spieltisch“ ein großer Schritt. Die letzte Strophe drückt eine Verlagerung der Werte aus. Der „Frühlings Blüte“ auf der Flur, also die natürliche Schönheit, verblasst im Vergleich zur Anwesenheit Belindens. Die Schlussfolgerung ist ein Bekenntnis zur Liebe und zur Natur, da das lyrische Ich in Belinden sowohl die Liebe als auch die Natur selbst vereint sieht. „Wo du, Engel, bist, ist Lieb‘ und Güte, / Wo du bist, Natur.“
Goethe vermittelt in diesem Gedicht ein tiefes Verständnis für die transformative Kraft der Liebe. Das Gedicht zeigt, wie die Anziehungskraft eines geliebten Menschen die Lebensweise und die Werte des Ichs grundlegend verändern kann. Es ist eine Ode an die Leidenschaft, die Freude und die Schönheit, die die Liebe mit sich bringt, aber auch an die Verlustangst und die Ambivalenz, die mit dieser Intensität einhergehen. Das Gedicht ist ein Spiegel der menschlichen Erfahrung von Liebe, Sehnsucht und Veränderung.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.