I ha scho menge Sturm und Schnee
i ha scho menge Früehlig gseh,
und Chrieg und Elend überal
im Rebland und im Wiesetal.
An so ne Zit, wo alles singt
und jung und alt in Freude springt,
an so ne Tag, wie Gott ein schenkt,
an so ne Freud het niemes denkt.
O wär er do, o chönnt er’s seh,
der liebi Fürst, Gott het en ge!
Er isch so gnädig, isch so guet,
‘s wird Wohltat, was er denkt und tuet.
»Du, Gott im Himmel, sei sein Lohn,
und schirme seinen Fürstenthron.«
Siehsch, Friederli, sel Engelsbild?
Wie luegt’s ein a so lieb und mild!
Es isch di Fürst, wo sorgt und wacht;
er het is alli glücklich gmacht.
Das lohnt em Gott, und uf si Hus
gießt Gott si Huld und Segen us.
O Chind, de bisch so jung und zart,
und wenn di Lebe Gott bewahrt,
und bisch emol dim Vater glich,
so wohnt di Fürst im Himmelrich,
und andere Zite chömme no.
Doch blibt si Geist und Liebi do,
und tröstet wieder treu und mild,
und segnet in sim Ebebild.
Der Ehrentag Karl Friedrichs
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
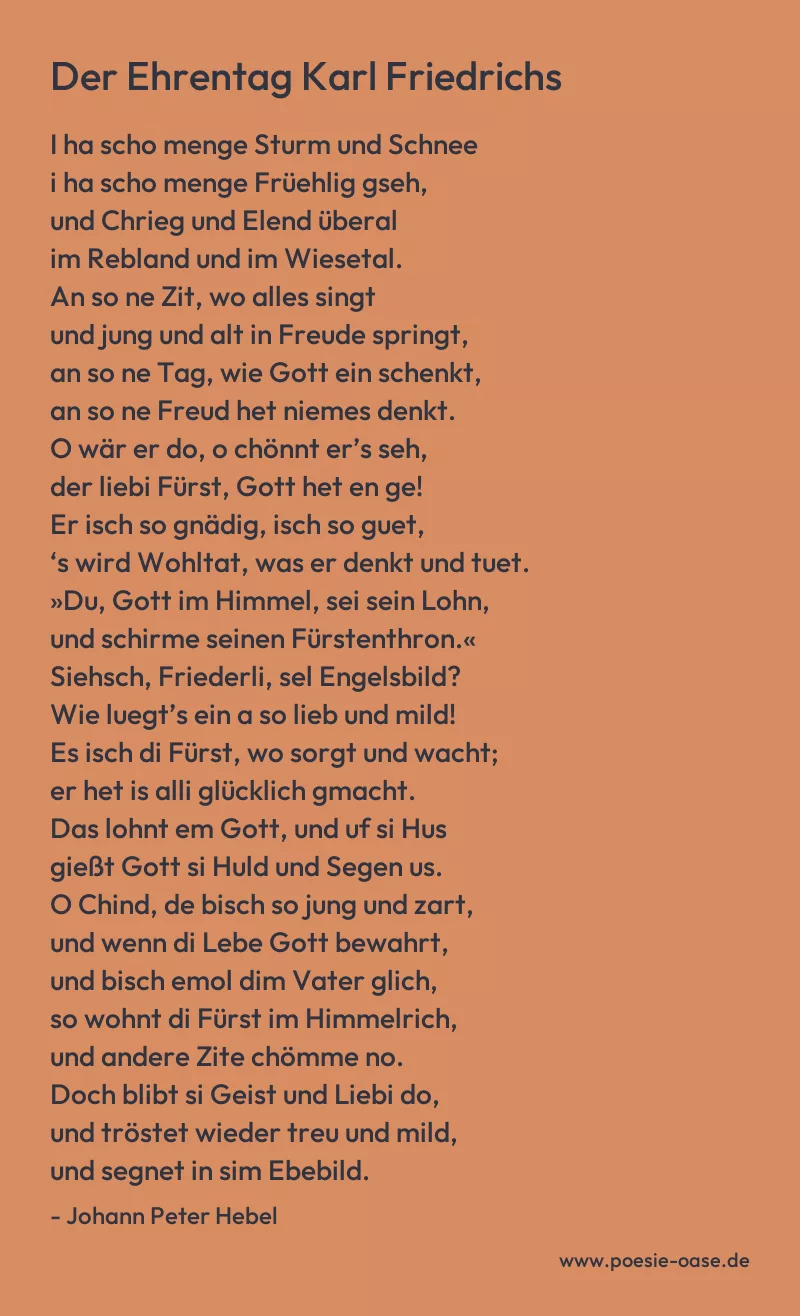
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Ehrentag Karl Friedrichs“ von Johann Peter Hebel ist eine Huldigung an den Markgrafen Karl Friedrich von Baden anlässlich eines festlichen Tages, vermutlich seines Geburtstages oder eines anderen wichtigen Ereignisses. Es ist ein Lobgesang auf den Fürsten, der sowohl inhaltlich als auch sprachlich tief in der Tradition der Volksdichtung verwurzelt ist. Die Idylle wird durch die Betonung der Freude und des Friedens geschaffen, die das Volk unter der gütigen Herrschaft des Fürsten erlebt.
Die Sprache des Gedichts ist einfach, volksnah und von einem starken dialektalen Einschlag geprägt, was die Verbundenheit des Dichters mit dem Volk und der Region widerspiegelt. Die Verwendung von Wörtern wie „Chrieg“ (Krieg), „Elend“, „Rebland“ und „Wiesetal“ verweist auf die schwierigen Zeiten, die die Menschen zuvor erlebt haben, und unterstreicht so umso mehr die Freude und das Glück, das sie jetzt erfahren. Der Einsatz von Reimen und einfacher Syntax trägt zur Eingängigkeit und zur musikalischen Qualität des Gedichts bei, wodurch es für ein breites Publikum zugänglich wird. Die direkte Ansprache des Engelsbildes und die Anrufung Gottes verstärken den feierlichen Charakter und unterstreichen die zentrale Rolle des Fürsten als Wohltäter und Beschützer.
Das Gedicht zeichnet ein Bild des Fürsten als gütigen und weisen Herrscher, der für das Wohl seines Volkes sorgt. Seine Güte und sein Wirken werden mit den Segnungen Gottes gleichgesetzt. Der Fürst wird als Vorbild für zukünftige Generationen dargestellt, was durch die Ansprache an das Kind „Friederli“ verdeutlicht wird. Die Hoffnung auf eine lange Lebenszeit und die Erhaltung der Werte und der Liebe des Fürsten werden ausgedrückt. Die letzte Strophe verspricht, dass der Geist und die Liebe des Fürsten in Erinnerung bleiben und das Volk auch in Zukunft trösten und segnen werden.
Inhaltlich ist das Gedicht ein klares Bekenntnis zur Monarchie und ein Ausdruck der Dankbarkeit und des Vertrauens in den Fürsten. Es spiegelt die damalige politische und soziale Realität wider, in der der Fürst eine zentrale Rolle für das Wohlbefinden des Volkes spielte. Hebel verbindet in diesem Gedicht die Verehrung des Fürsten mit dem Glauben an Gott und die Hoffnung auf eine friedliche und glückliche Zukunft. Das Gedicht dient somit nicht nur als Loblied, sondern auch als Ermutigung und Trost für das Volk.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
