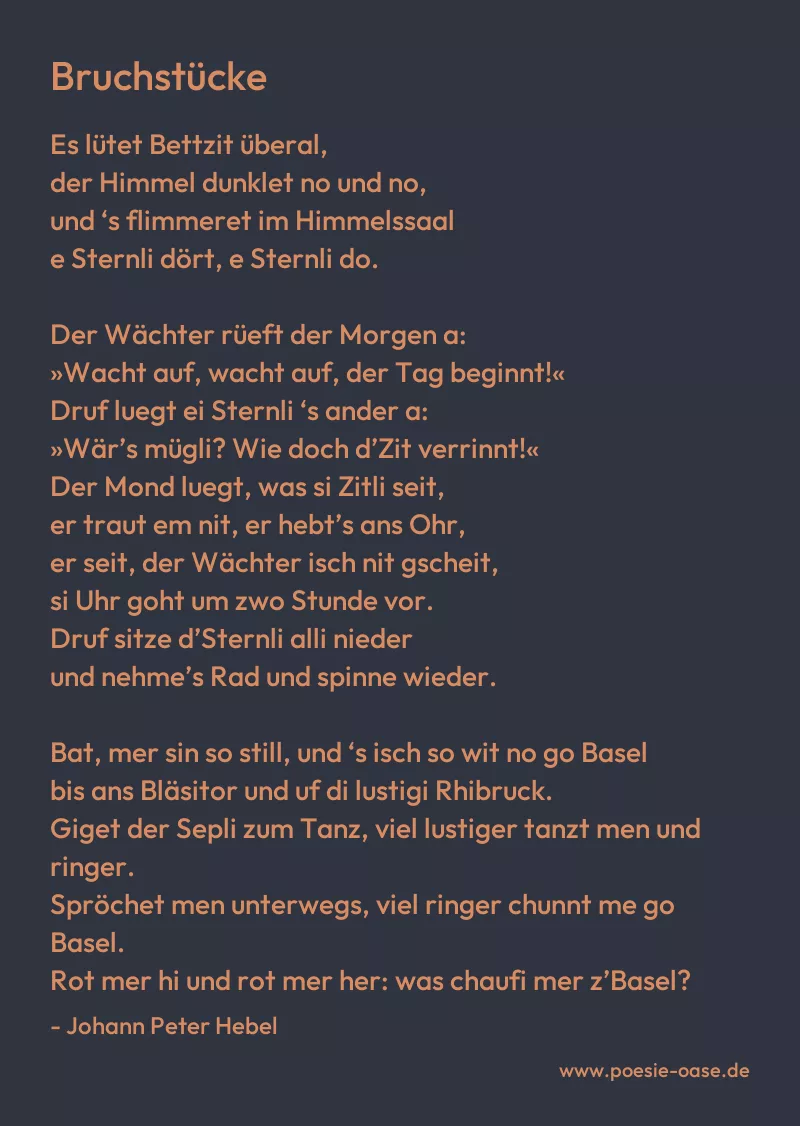Bruchstücke
Es lütet Bettzit überal,
der Himmel dunklet no und no,
und ‘s flimmeret im Himmelssaal
e Sternli dört, e Sternli do.
Der Wächter rüeft der Morgen a:
»Wacht auf, wacht auf, der Tag beginnt!«
Druf luegt ei Sternli ‘s ander a:
»Wär’s mügli? Wie doch d’Zit verrinnt!«
Der Mond luegt, was si Zitli seit,
er traut em nit, er hebt’s ans Ohr,
er seit, der Wächter isch nit gscheit,
si Uhr goht um zwo Stunde vor.
Druf sitze d’Sternli alli nieder
und nehme’s Rad und spinne wieder.
Bat, mer sin so still, und ‘s isch so wit no go Basel
bis ans Bläsitor und uf di lustigi Rhibruck.
Giget der Sepli zum Tanz, viel lustiger tanzt men und ringer.
Spröchet men unterwegs, viel ringer chunnt me go Basel.
Rot mer hi und rot mer her: was chaufi mer z’Basel?
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
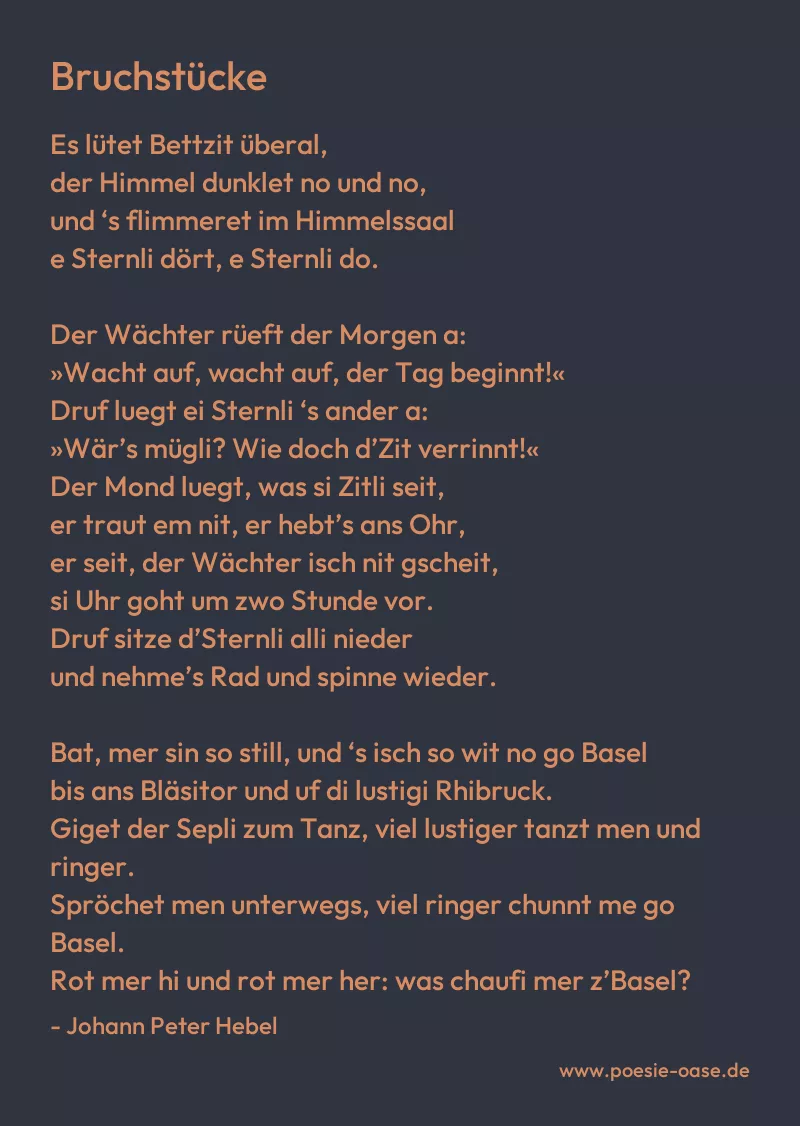
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Bruchstücke“ von Johann Peter Hebel malt ein stimmungsvolles Bild des Übergangs von Nacht zu Tag, eingebettet in eine Szenerie, die von leisem Bedauern und der Vergänglichkeit der Zeit geprägt ist. Die ersten Strophen beschreiben eine idyllische, fast schon kindliche Welt: Das Läuten der Bettglocken, der dunkle Himmel mit seinen funkelnden Sternen, und der Ruf des Wächters, der den Tag ankündigt. Diese eröffnende Szene etabliert eine Atmosphäre der Ruhe und des Friedens, in der die Natur und ihre Elemente im Einklang miteinander zu stehen scheinen.
Im Zentrum des Gedichts steht die Interaktion der Himmelskörper. Die Sternlein, als kleine, menschliche Wesen dargestellt, tauschen Blicke aus und hinterfragen die rasche Verwandlung der Zeit. Der Mond, der die Autorität und vielleicht auch die Weisheit verkörpert, zweifelt an der Zuverlässigkeit des Wächters und dessen Zeitangabe. Diese Szenen der Selbstreflexion und des Hinterfragens der Zeit, derer Messung und des Verstreichens verleihen dem Gedicht eine tiefe melancholische Note. Die Sternlein setzen ihre Arbeit fort und nehmen das Rad und beginnen wieder zu spinnen.
Der zweite Teil des Gedichts wechselt abrupt in eine andere Ebene. Die Zeilen, die mit „Bat, mer sin so still…“ beginnen, leiten eine lebhaftere Szene ein, die mit dem Alltag der Menschen verbunden ist. Sie beschreiben eine Reise nach Basel, die Vorfreude auf Tanz und Festlichkeiten. Diese kontrastierende Szene wirft die Frage nach den vergänglichen Freuden des Lebens auf, die im Angesicht der unaufhaltsamen Zeit eine besondere Bedeutung erlangen.
Die abschließenden Zeilen, die sich auf den Kauf von Waren in Basel beziehen, weisen auf die materielle Welt und die damit verbundene Vergänglichkeit hin. Die Frage „Was chaufi mer z’Basel?“ deutet auf eine Suche nach Glück und Erfüllung in den kleinen Dingen des Lebens hin, während das Gedicht insgesamt die tiefere Reflexion über die Zeit, die Vergänglichkeit und die menschliche Existenz als zentrale Themen behandelt. Die „Bruchstücke“ Hebels fangen somit auf subtile Weise die Ambivalenz des Lebens ein – die Schönheit und die Vergänglichkeit, die Freude und die Melancholie, die im steten Fluss der Zeit ihre unvermeidlichen Wege finden.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.