bei Übersendung der alemannischen Gedichte
Hoch von der langen schwarzen Möhr herab,
vom Platzberg her, auf wohlbekanntem Pfad,
erschein ich dir, o Freund, den Blumenkranz
dir bringend, den ich jüngst in Wald und Flur
und von der Wiese duftigem Gestad,
und um die stillen Dörfer her gepflückt.
Zwar nur Gamänderlein und Ehrenpreis,
nur Erdbeerblüten, Dolden, Wohlgemut
und zwischendurch ein dunkles Rosmarin,
geringe Gabe. Doch so gut sie kann,
hat lächelnd und mit ungezwungner Hand
des Feldes Muse sie in diesen Kranz
gewunden; und der reine Freundessinn,
der dir ihn bietet, sei allein sein Wert.
Und hing er nun hier unterm Spiegel schön,
so schwankt er schöner doch am Lindenast
in freier Weitung, leichter Weste Spiel.
Dort schwank er denn! Und sammelt um sich her
die Linde unterm Sonntagshimmelblau
das frohe Völklein aus dem nahen Dorf,
das gute Völklein, das dich liebt und ehrt,
und unter ihnen mancher mir von Blut
verwandt und mancher aus der goldnen Zeit
der frohen Kindheit mir noch wert und lieb,
so teilst du gern des kleinen Spaßes Freuden
mit ihnen. „Seht, zu diesem leichten Strauße“,
so sagst du, „sind die besten Blümlein doch
von unsrer Flur und unser Eigentum
mit Recht.“ – jo weger, uf em Alzebüehl,
jo weger, uf em Maiberg henn si blüeiht;
un bin i nit im frische Morgetau
dur d’Matte gstraift un über d’Gräbe gumpt?
Un han i nit ab menggem hoche Berg
mit nassen Augen abegluegt ins Dorf-
un han ich Frid un gueti Stunde gwünscht?
`s isch weger wohr; un glaubsch mer’s nit, se froog
der Bammert; menggmool het er mi verscheucht
im Habermark un im verhängte Wald.
Se bschauet denn my Bluemechränzli au
am Lindenast, un’s freut mi, wenn’s ich gfallt;
un nemmet so verlieb; es isch nit viil!
An einen Freund zu Hausen
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
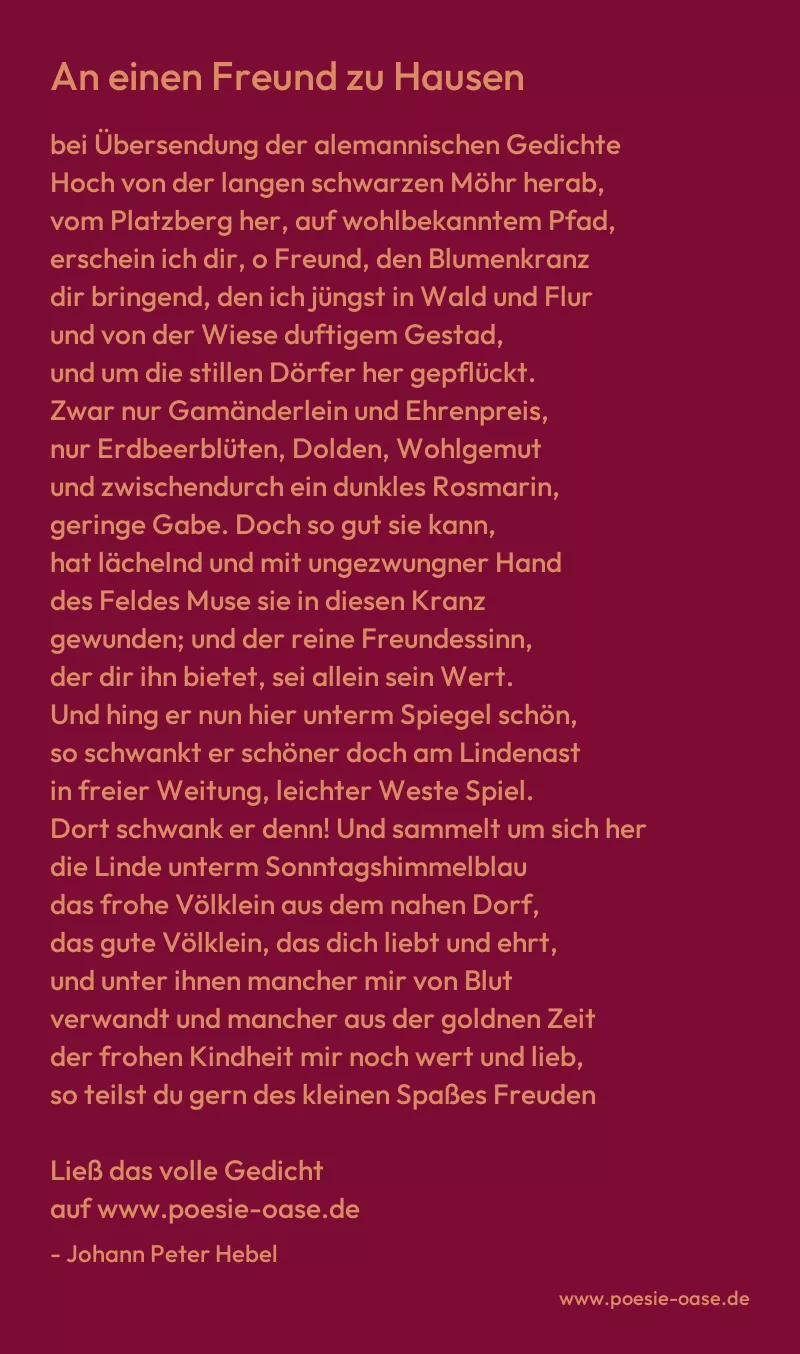
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An einen Freund zu Hausen“ von Johann Peter Hebel ist eine liebevolle Widmung, die in der für Hebel typischen, volksnahen alemannischen Mundart verfasst ist. Es handelt sich um eine lyrische Botschaft, die dem Adressaten, einem Freund, einen selbstgefertigten Blumenkranz zukommen lässt. Das Gedicht zeugt von tiefer Verbundenheit zur Heimat und einem innigen Gefühl der Freundschaft, indem es die einfache Gabe des Blumenkranzes mit einer Fülle an Emotionen und Erinnerungen verbindet.
Im Zentrum steht die Beschreibung des Blumenkranzes selbst, der aus einfachen Feldblumen besteht, die der Dichter mit „ungezwungner Hand“ gepflückt und gewunden hat. Der Wert des Kranzes liegt nicht in seiner materielle Schönheit, sondern in der Freundschaft, die ihn zum Ausdruck bringt. Der Dichter stellt die Blumen als ein Geschenk dar, das er aus dem Herzen kommt, und wünscht sich, dass der Freund die Freuden der Natur und der Gemeinschaft mit ihm teilt. Die Zeilen beschwören ein idyllisches Bild von Vertrautheit und Gemeinschaft, indem sie die Blumen mit einem „frohen Völklein“ in Verbindung bringen, das sich unter dem Schatten der Linde versammelt.
Der Dichter erinnert sich an die Orte, an denen die Blumen gepflückt wurden und die Momente, die sie begleiteten. Er erwähnt die Orte und beschreibt die Emotionen, die mit diesen verbunden sind. Er beschreibt, wie er die Flur durchstreifte und von den Bergen auf das Dorf herabsah, wobei er sich Frieden und gute Stunden wünschte. Die abschließenden Verse betonen die Echtheit und Einfachheit dieses Geschenks, und fordern den Freund auf, es zu schätzen, und die Freude, die es bereitet, zu teilen.
Die alemannische Mundart verstärkt die Intimität und Echtheit des Gedichts. Sie verbindet den Leser direkt mit dem Dichter und seiner Botschaft, wodurch das Gedicht eine warme und vertraute Atmosphäre erzeugt. Die Verwendung von Dialekt betont die regionale Verbundenheit und die tiefe Verwurzelung des Dichters in seiner Heimat. Das Gedicht ist somit mehr als nur ein Geschenk, sondern ein Bekenntnis zur Freundschaft und zur gemeinsamen Freude an der einfachen Schönheit der Natur und des Lebens.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
