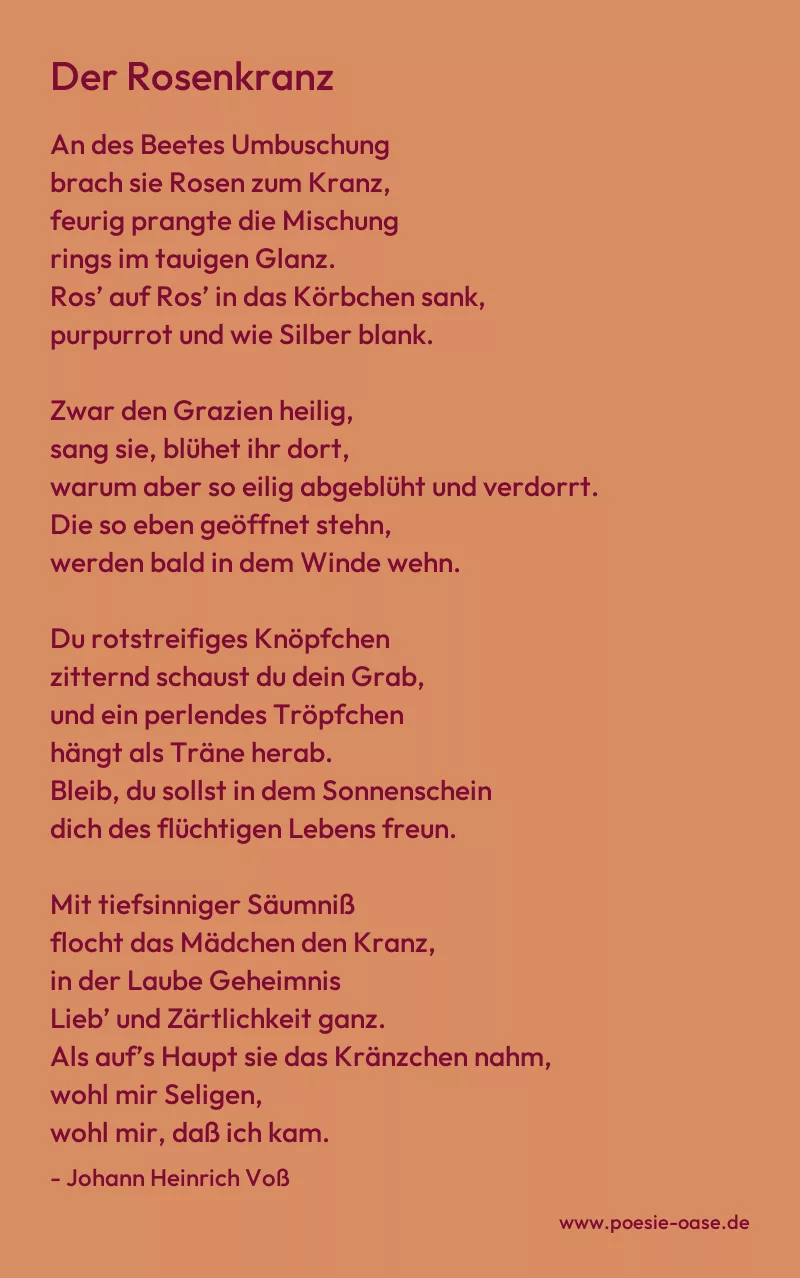Der Rosenkranz
An des Beetes Umbuschung
brach sie Rosen zum Kranz,
feurig prangte die Mischung
rings im tauigen Glanz.
Ros’ auf Ros’ in das Körbchen sank,
purpurrot und wie Silber blank.
Zwar den Grazien heilig,
sang sie, blühet ihr dort,
warum aber so eilig abgeblüht und verdorrt.
Die so eben geöffnet stehn,
werden bald in dem Winde wehn.
Du rotstreifiges Knöpfchen
zitternd schaust du dein Grab,
und ein perlendes Tröpfchen
hängt als Träne herab.
Bleib, du sollst in dem Sonnenschein
dich des flüchtigen Lebens freun.
Mit tiefsinniger Säumniß
flocht das Mädchen den Kranz,
in der Laube Geheimnis
Lieb’ und Zärtlichkeit ganz.
Als auf’s Haupt sie das Kränzchen nahm,
wohl mir Seligen,
wohl mir, daß ich kam.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
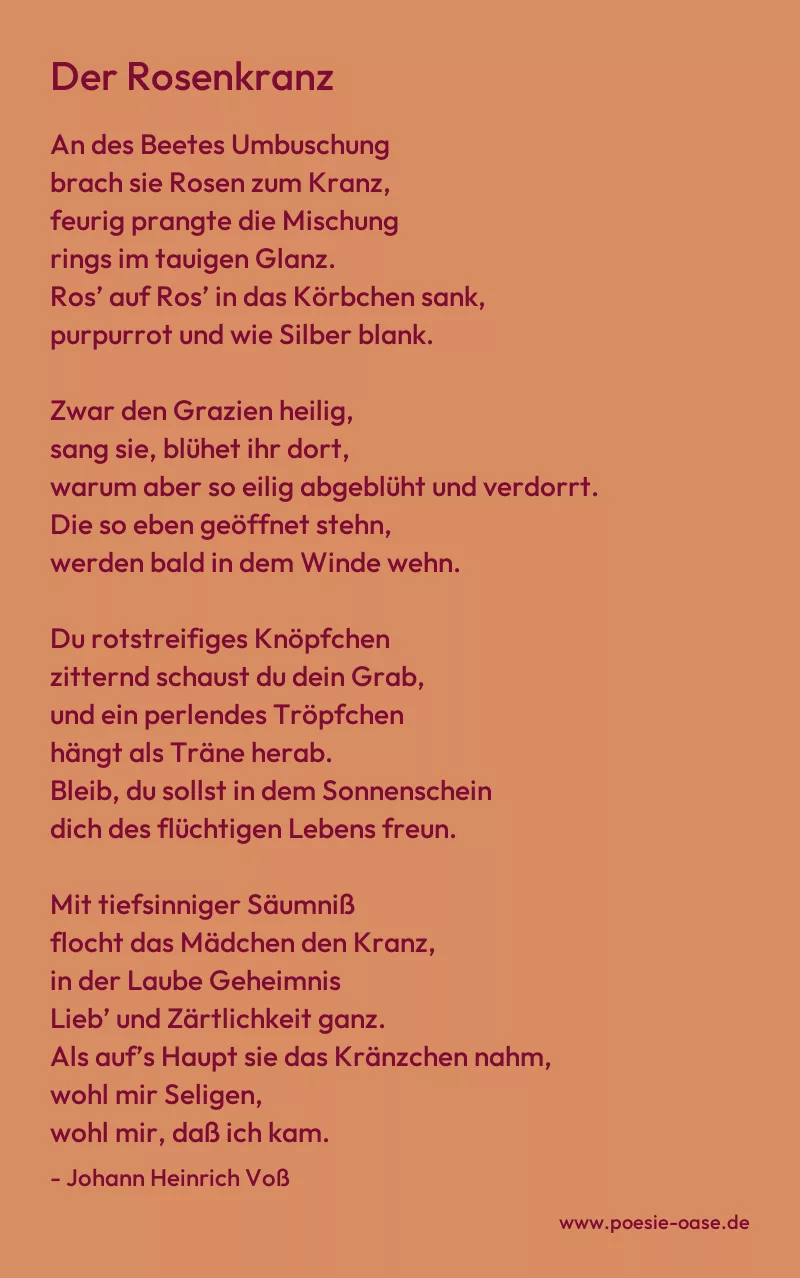
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Rosenkranz“ von Johann Heinrich Voß thematisiert die Vergänglichkeit des Lebens und die Schönheit im Augenblick, eingebettet in die Metapher des Rosenkranzes. Das lyrische Ich beobachtet, wie ein Mädchen Rosen pflückt und zu einem Kranz bindet, um sich selbst zu schmücken. Dabei werden die leuchtenden Farben und der tauige Glanz der Rosen betont, was die anfängliche Freude und den Reiz des Lebens widerspiegelt. Der Prozess des Pflückens und Bindens wird als eine Handlung der Verehrung dargestellt, die jedoch untrennbar mit dem Bewusstsein des Verfalls verbunden ist.
Die zweite Strophe leitet einen Wechsel ein, indem sie die Frage nach der Vergänglichkeit der Rosen aufwirft. Das Mädchen fragt, warum die Rosen so schnell verblühen und vertrocknen, was eine Reflexion über die Endlichkeit der Schönheit und des Lebens darstellt. Der Kontrast zwischen dem „feurigen Prangen“ am Anfang und dem „Abblühen“ am Ende zeigt die Dualität von Schönheit und Vergänglichkeit auf. Die im Vers „Die so eben geöffnet stehn, werden bald in dem Winde wehn“ formulierte Erkenntnis verstärkt das Gefühl des Verlusts und der Kurzlebigkeit.
Die dritte Strophe intensiviert die Auseinandersetzung mit dem Thema der Vergänglichkeit. Das Mädchen betrachtet eine einzelne Rose, die bereits ihre Blütenblätter verliert, und erkennt das nahende Ende. Das „perlendes Tröpfchen“ als Träne verdeutlicht die Traurigkeit über das Vergehen der Schönheit. Der Wunsch, dass die Rose im „Sonnenschein“ verweilen und das Leben genießen möge, verdeutlicht das Sehnen nach Beständigkeit und die Wertschätzung des gegenwärtigen Moments.
In der letzten Strophe vereint sich das Mädchen mit dem selbst geschmückten Rosenkranz, was eine Vereinigung von Schönheit und Vergänglichkeit symbolisiert. Indem sie den Kranz auf ihr Haupt setzt, umarmt sie die Flüchtigkeit des Lebens. Das Zitat „wohl mir Seligen, wohl mir, daß ich kam“ drückt ein Gefühl des Glücks und der Erfüllung aus, das aus der Akzeptanz des Kreislaufs von Werden und Vergehen resultiert. Voß schließt das Gedicht mit einer Akzeptanz des Lebens ab, welches zwar endlich ist, aber dennoch wertvoll und schön in seiner Vergänglichkeit.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.