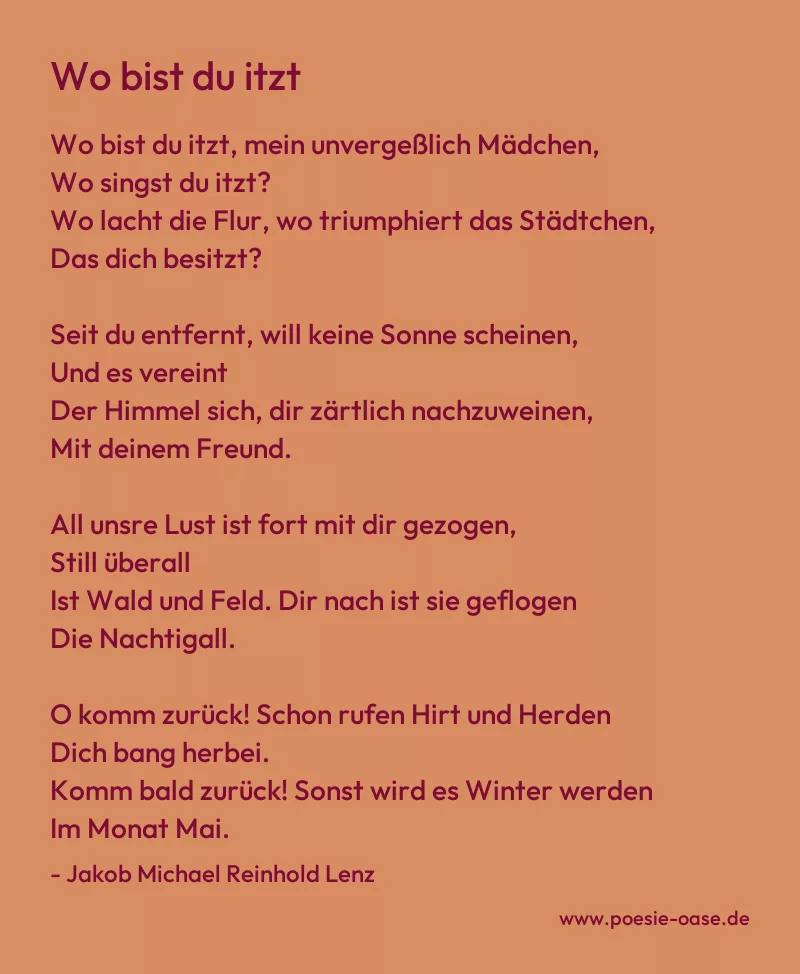Wo bist du itzt
Wo bist du itzt, mein unvergeßlich Mädchen,
Wo singst du itzt?
Wo lacht die Flur, wo triumphiert das Städtchen,
Das dich besitzt?
Seit du entfernt, will keine Sonne scheinen,
Und es vereint
Der Himmel sich, dir zärtlich nachzuweinen,
Mit deinem Freund.
All unsre Lust ist fort mit dir gezogen,
Still überall
Ist Wald und Feld. Dir nach ist sie geflogen
Die Nachtigall.
O komm zurück! Schon rufen Hirt und Herden
Dich bang herbei.
Komm bald zurück! Sonst wird es Winter werden
Im Monat Mai.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
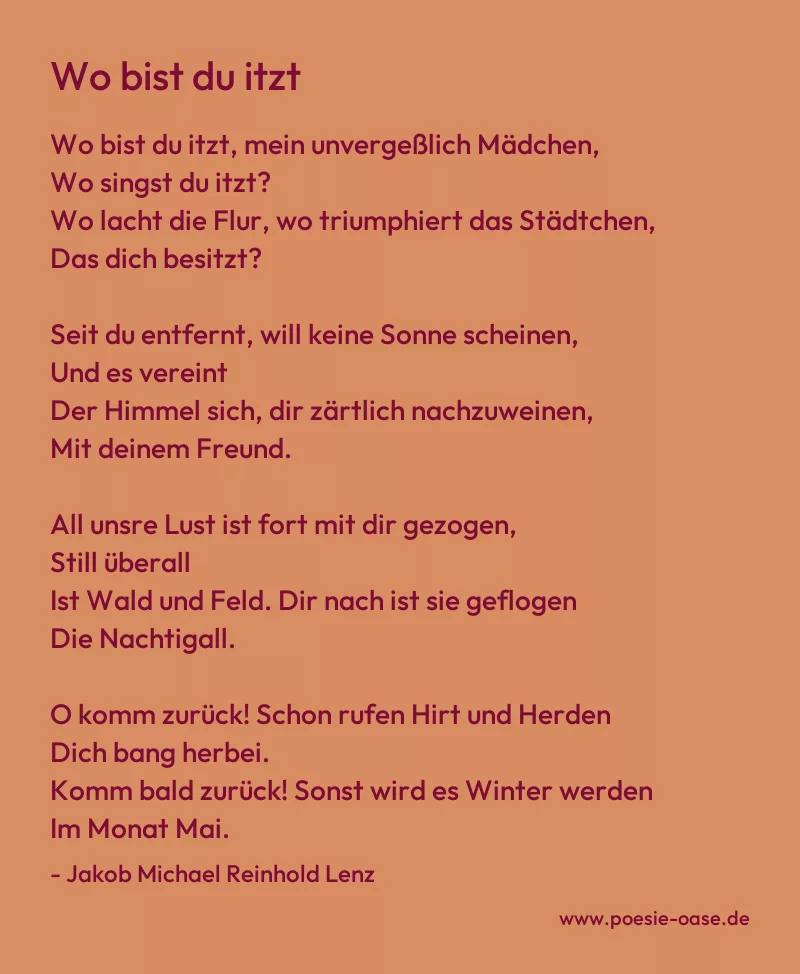
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Wo bist du itzt“ von Jakob Michael Reinhold Lenz ist eine melancholische Liebesklage, die die Abwesenheit einer geliebten Person betrauert und die Leere beschreibt, die sie hinterlassen hat. Es ist ein Gedicht der Sehnsucht, das die tiefe Verbundenheit des Sprechers mit der Abwesenden und die Auswirkungen ihrer Entfernung auf seine Gefühlswelt und die Natur um ihn herum verdeutlicht. Lenz nutzt hier einfache, aber eindringliche Bilder, um die emotionalen Auswirkungen des Verlustes zu vermitteln.
Die ersten beiden Strophen etablieren die zentralen Themen des Gedichts: die Frage nach dem Aufenthaltsort der Geliebten und die darauf folgende Tristesse. Der Sprecher fragt nach ihrem aktuellen Standort und bittet sie zu singen, wodurch die Freude und Lebendigkeit, die sie einst mit sich brachte, in Erinnerung gerufen wird. Ohne sie scheint die Natur zu erstarren, was durch Bilder wie „keine Sonne scheinen“ und den weinenden Himmel ausgedrückt wird. Die Verbindung zwischen dem Sprecher, der Geliebten und der Natur wird durch die Verwendung von Begriffen wie „Freund“ und die Betonung der Trauer der Natur, die ihr nachweint, hervorgehoben.
Die dritte Strophe verstärkt die Verlorenheit. Die Freude des Sprechers ist mit ihr fortgezogen, was die Leere noch verstärkt. Das Bild der „Nachtigall“, die ihr nachfolgt, symbolisiert die vertrauten Freuden, die jetzt fehlen. Die Stille in „Wald und Feld“ unterstreicht die Isolation des Sprechers und die Wirkung ihrer Abwesenheit auf die Welt um ihn herum. Die Natur dient hier als Spiegelbild seiner eigenen Traurigkeit, was die Intensität seiner Gefühle zusätzlich verstärkt.
In der abschließenden Strophe fleht der Sprecher die Geliebte an, zurückzukehren, und malt ein Bild von drohender Verlorenheit. Die „Hirt und Herden“ rufen nach ihr, was die Sehnsucht nach Gemeinschaft und Harmonie zeigt. Die Metapher des „Winters“ im Mai, die eine völlige Umkehrung der Jahreszeiten darstellt, betont die Verzweiflung und die Vorstellung, dass die Welt ohne sie unnatürlich und ungastlich wird. Das Gedicht endet mit einem eindringlichen Appell, der die Dringlichkeit der Rückkehr unterstreicht und die Hoffnung des Sprechers auf eine Wiedervereinigung andeutet.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.