Schön ist mein Garten mit den goldnen Bäumen,
Den Blättern, die mit Silbersäuseln zittern,
Dem Diamantentau, den Wappengittern,
Dem Klang des Gong, bei dem die Löwen träumen,
Die ehernen, und den Topasmäandern
Und der Volière, wo die Reiher blinken,
Die niemals aus dem Silberbrunnen trinken …
So schön, ich sehn mich kaum nach jenem andern,
Dem andern Garten, wo ich früher war.
Ich weiß nicht wo … Ich rieche nur den Tau,
Den Tau, der früh an meinen Haaren hing,
Den Duft der Erde weiß ich, feucht und lau,
Wenn ich die weichen Beeren suchen ging …
In jenem Garten, wo ich früher war …
Mein Garten
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
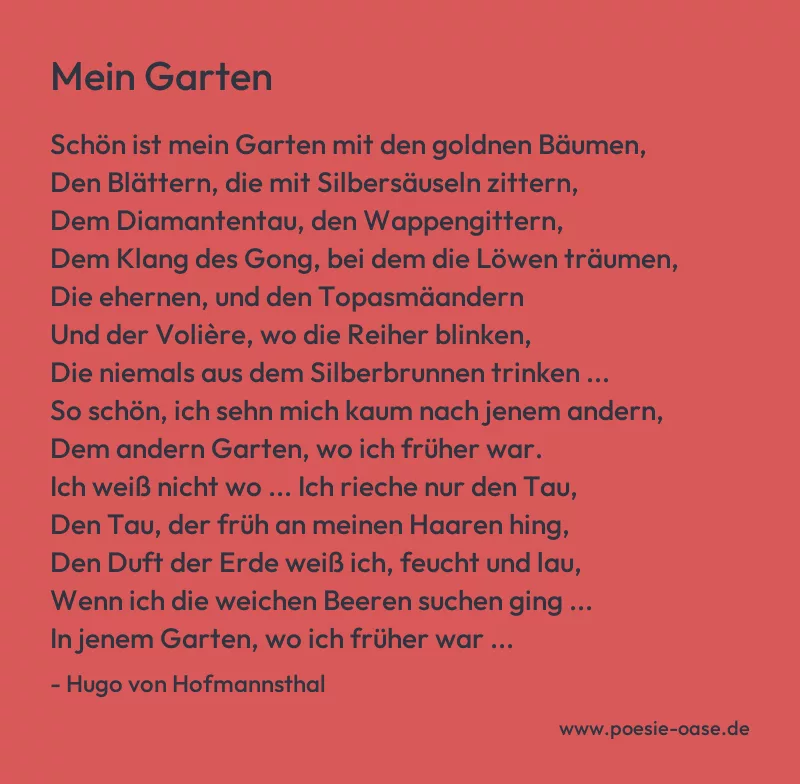
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Mein Garten“ von Hugo von Hofmannsthal ist eine melancholische Reflexion über die Schönheit und das Vergessen. Es zeichnet sich durch einen Kontrast zwischen der opulenten, künstlichen Welt des gegenwärtigen Gartens und der subtilen, verlorenen Welt der Vergangenheit aus. Der erste Teil des Gedichts beschreibt den aktuellen Garten des Sprechers, der von luxuriösen Elementen wie „goldnen Bäumen“, „Silbersäuseln“ und „Diamantentau“ geprägt ist. Diese übertriebene Verwendung von edlen Metallen und glänzenden Materialien suggeriert eine künstliche, fast schon überladene Umgebung, die auf den ersten Blick beeindruckt, aber gleichzeitig einen kühlen und distanzierten Eindruck hinterlässt. Die Aufzählung der Details, von den „Topasmäandern“ bis zur „Voliere, wo die Reiher blinken“, erzeugt ein Gefühl von Überfülle und Dekadenz, die aber letztendlich einen Leere verschleiert.
Der zweite Teil des Gedichts, eingeleitet durch die Worte „So schön, ich sehn mich kaum nach jenem andern“, offenbart die Sehnsucht des Sprechers nach einer anderen, verlorenen Welt. Diese Welt wird durch vage, aber sinnliche Eindrücke der Erinnerung charakterisiert. Der Sprecher beschreibt den „Tau, der früh an meinen Haaren hing“, den „Duft der Erde, feucht und lau“, und die „weichen Beeren“. Im Gegensatz zur grellen Pracht des gegenwärtigen Gartens sind diese Erinnerungen von Natürlichkeit, Einfachheit und Wärme geprägt. Die Verwendung von Adjektiven wie „feucht“ und „lau“ erzeugt ein taktiles Gefühl und lädt den Leser ein, die verlorene Welt durch die Sinneswahrnehmung des Sprechers zu erfahren.
Die Struktur des Gedichts spiegelt den inneren Konflikt des Sprechers wider. Die erste Strophe präsentiert die äußere Schönheit des aktuellen Gartens, während die zweite Strophe die Sehnsucht nach der verlorenen Vergangenheit zum Ausdruck bringt. Der Kontrast zwischen den beiden Hälften verdeutlicht die Kluft zwischen der Gegenwart und der Erinnerung, zwischen der künstlichen Welt und der natürlichen Welt. Die Verwendung des Wortes „kaum“ in „So schön, ich sehn mich kaum nach jenem andern“ ist bezeichnend. Es deutet darauf hin, dass die Schönheit des aktuellen Gartens nicht in der Lage ist, die Sehnsucht nach der Vergangenheit vollständig zu unterdrücken. Die Erinnerung an den verlorenen Garten, trotz ihrer Unbestimmtheit und Vagheit, ist stärker als die greifbare Schönheit des gegenwärtigen Gartens.
Das Gedicht kann als eine Metapher für die menschliche Erfahrung des Verlusts und der Erinnerung gelesen werden. Der aktuelle Garten repräsentiert die materielle Welt, die Schönheit und Reichtum bietet, aber letztendlich leer und unbefriedigend ist. Der verlorene Garten hingegen steht für die Vergangenheit, die Kindheit, die unbeschwerte Zeit, die durch die Kraft der Erinnerung am Leben erhalten wird. Die vagen Beschreibungen der verlorenen Welt lassen Raum für die individuelle Interpretation des Lesers, so dass jeder seine eigenen Erinnerungen und Sehnsüchte in das Gedicht projizieren kann.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
