Schauet dort jene! Die will ihre Schönheit in dem,
was ich dichte,
Finden, hier diese, die legt ihre, o Jubel, hinein!
Unterscheidung
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
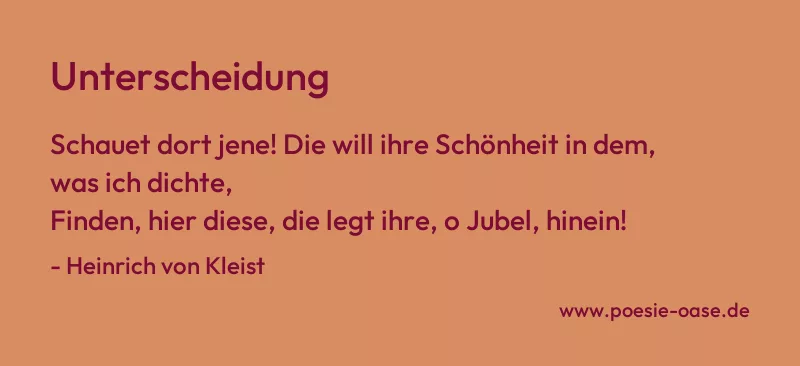
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Unterscheidung“ von Heinrich von Kleist ist ein prägnantes, zweizeiliges Gedicht, das sich mit der Beziehung zwischen Kunst und dem Betrachter, insbesondere der weiblichen Rezipientin, auseinandersetzt. Es offenbart zwei unterschiedliche Arten der Rezeption und des Verständnisses von Kunst, wobei die zentralen Charaktere durch ihre Reaktion auf das poetische Werk unterschieden werden.
Die erste Zeile beschreibt eine Frau, die ihre Schönheit in der Kunst, also im Gedicht des Autors, sucht. Sie betrachtet das Gedicht als Spiegelbild ihrer eigenen Ästhetik und sucht Bestätigung oder gar eine Erweiterung ihres eigenen Schönheitsideals. Das Gedicht dient hier als ein Instrument zur Selbstvergewisserung und zur Selbstdarstellung, wobei die Frau ihre eigene Wahrnehmung von Schönheit auf die Kunst projiziert. Es ist ein Streben nach Bestätigung, nach einer Spiegelung des eigenen Ichs.
Die zweite Zeile stellt einen deutlichen Kontrast dar: Eine andere Frau legt ihre eigene Schönheit, „o Jubel, hinein!“, in das Gedicht. Dies deutet auf eine aktivere und engagiertere Form der Rezeption hin. Sie ist nicht nur passive Betrachterin, sondern sie investiert ihre eigene Schönheit und Emotionen in das Kunstwerk. Der „Jubel“ impliziert eine Freude und Begeisterung, die sich durch die aktive Teilnahme an der Kunst ausdrückt. Hier wird die Kunst nicht nur als Spiegel, sondern als ein Medium der Transzendenz, eine Möglichkeit, eigene Gefühle zu externalisieren und sich in die Welt der Kunst zu erheben, verstanden.
Kleists Gedicht stellt somit zwei grundlegend unterschiedliche Herangehensweisen an die Kunst dar. Die erste Rezipientin sieht das Gedicht als Erweiterung ihrer eigenen Schönheit, während die zweite ihre Schönheit aktiv in die Kunst einbringt und sich so mit ihr verbindet. Die Kürze des Gedichts unterstreicht die Knappheit der Unterscheidung und zwingt den Leser, sich intensiv mit den beiden gegensätzlichen Standpunkten auseinanderzusetzen. Kleist eröffnet so eine Debatte über die Rolle des Betrachters und die unterschiedlichen Arten der Rezeption von Kunst, ein Thema, das auch heute noch relevant ist.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
