Siehe, das nenn ich doch würdig, fürwahr, sich im Alter beschäftgen!
Er zerlegt jetzt den Strahl, den seine Jugend sonst warf.
Siehe, das nenn ich doch würdig, fürwahr, sich im Alter beschäftgen!
Er zerlegt jetzt den Strahl, den seine Jugend sonst warf.
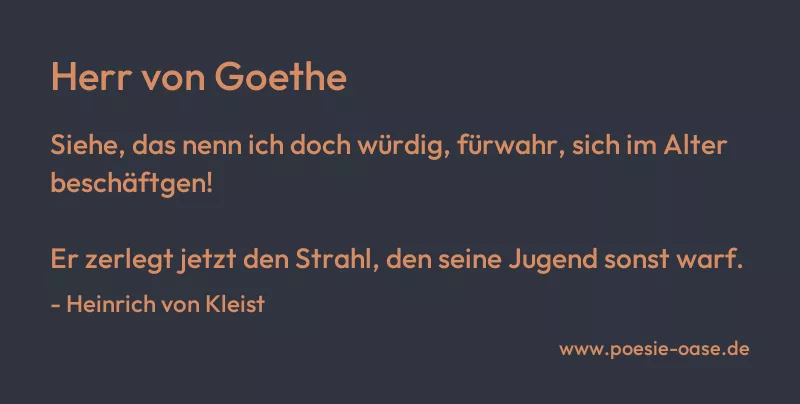
Das Gedicht „Herr von Goethe“ von Heinrich von Kleist ist eine prägnante, ironische Auseinandersetzung mit der späten Schaffensphase Johann Wolfgang von Goethes. Kleist, selbst ein Künstler, der unter dem Druck der eigenen Kreativität litt, nutzt hier wenige Zeilen, um sowohl Bewunderung als auch eine subtile Kritik an Goethes vermeintlicher „Erleuchtung“ im Alter auszudrücken. Die Ironie liegt in der Gegenüberstellung von Goethes Jugendwerk, das von jugendlicher Kraft und Strahlkraft geprägt war, mit seinem Alterswerk, in dem er nun scheinbar analytisch vorgeht.
Die erste Zeile, „Siehe, das nenn ich doch würdig, fürwahr, sich im Alter beschäftgen!“, drückt auf den ersten Blick eine Anerkennung und Bewunderung aus. Das Wort „würdig“ impliziert Respekt vor der Beschäftigung des alten Goethe. Doch das „fürwahr“ könnte als ein Hauch von Ironie interpretiert werden. Es könnte andeuten, dass die vermeintliche Würde dieser Beschäftigung gerade in Kleists Augen fragwürdig ist. Vielleicht sieht er hier eine Abkehr von der ursprünglichen kreativen Energie Goethes, eine Hinwendung zu intellektueller Zerlegung.
Die zweite Zeile, „Er zerlegt jetzt den Strahl, den seine Jugend sonst warf.“, ist der Kern der Kritik. Der „Strahl“ steht hier für die ursprüngliche schöpferische Kraft, die Jugend, die Intuition und das Genie, das Goethe in seinen jungen Jahren auszeichnete. Die „Zerlegung“ dieses Strahls im Alter deutet auf eine Analyse hin, eine bewusste Zersplitterung der ursprünglichen, kraftvollen Kreativität. Kleist scheint zu beklagen, dass Goethe nun seine Energie darauf verwendet, das zu sezieren, was er einst schuf, anstatt neue Strahlen zu werfen.
Insgesamt ist das Gedicht eine Reflexion über den Prozess des Alterns und seine Auswirkungen auf die Kreativität. Es spiegelt möglicherweise Kleists eigenes Ringen mit der Kunst wider, das er mit Goethes Entwicklung vergleicht. Kleist fragt implizit, ob die Analyse und Zerlegung des eigenen Werkes im Alter eine würdige Beschäftigung ist oder ob es besser wäre, weiterhin neue kreative Strahlen auszusenden. Die Kürze des Gedichts unterstreicht die Intensität und Prägnanz der Botschaft, die in dieser schlichten Gegenüberstellung von Jugend und Alter, Strahl und Zerlegung, zum Ausdruck gebracht wird.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.