»Gottgesandter, sieh da! Wenn du das bist, so verschaff dir
Glauben.« – Der Narr, der! Er hört nicht, was ich eben gesagt.
Der Kritiker
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
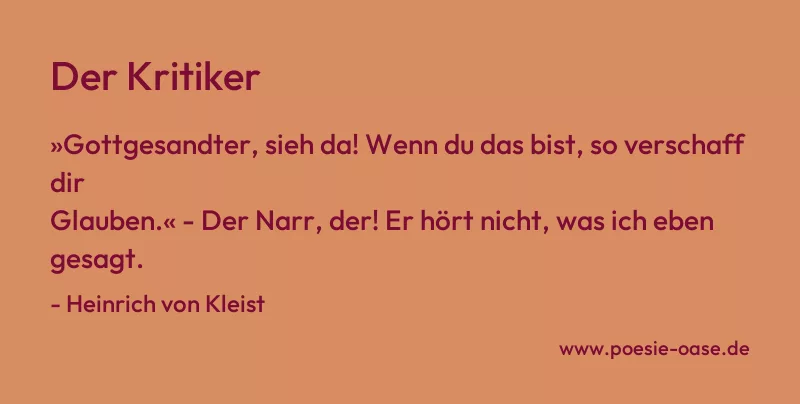
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Kritiker“ von Heinrich von Kleist präsentiert in knapper Form eine Auseinandersetzung mit der Thematik des Glaubens und der Kritik. Es besteht aus nur zwei Zeilen und bildet somit eine Szene, die auf eine dialogische Auseinandersetzung reduziert ist.
In der ersten Zeile spricht eine Figur, die als „Gottgesandter“ bezeichnet wird, den Kern des Konflikts an: „Gottgesandter, sieh da! Wenn du das bist, so verschaff dir Glauben.“ Hier wird ein Anspruch an den „Gottgesandten“ gestellt, seine Legitimität durch Glauben zu beweisen. Der Imperativ „verschaff dir Glauben“ legt nahe, dass die Person, die den Titel „Gottgesandter“ trägt, von Zweifeln umgeben ist oder zumindest die Notwendigkeit hat, ihren Anspruch zu untermauern. Der Appell deutet auf eine Situation hin, in der die Autorität oder die Botschaft des „Gottgesandten“ in Frage gestellt wird.
Die zweite Zeile ist eine direkte Reaktion auf die Aussage des „Gottgesandten“ und wird von einem „Narr“ geäußert: „Der Narr, der! Er hört nicht, was ich eben gesagt.“ Diese Reaktion wirft ein Licht auf die Dynamik zwischen den beiden Figuren. Der Narr, der hier als kritische Instanz fungiert, scheint die Botschaft des „Gottgesandten“ abzulehnen oder sie nicht zu verstehen. Die wiederholte Verwendung des Wortes „er“ betont die Distanz und das Unverständnis zwischen den beiden Gesprächspartnern. Die Aussage „er hört nicht, was ich eben gesagt“ deutet darauf hin, dass eine Kommunikationsebene fehlt und dass der Narr die Botschaft des „Gottgesandten“ missachtet oder nicht würdigt.
Insgesamt lässt sich das Gedicht als eine kurze, aber prägnante Auseinandersetzung mit der Thematik des Glaubens, der Kritik und der Kommunikation interpretieren. Es zeigt das Spannungsverhältnis zwischen dem, der Glauben beansprucht, und dem, der ihn fordert oder ablehnt. Kleists Gedicht stellt die Frage nach der Autorität und der Berechtigung von Ansprüchen im Kontext des Glaubens und der Kritik, wobei die Kürze des Gedichts die Intensität und die Brisanz der Thematik noch verstärkt. Das Gedicht lädt den Leser dazu ein, über die Beziehung zwischen Glaube, Autorität und kritischer Auseinandersetzung nachzudenken.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
