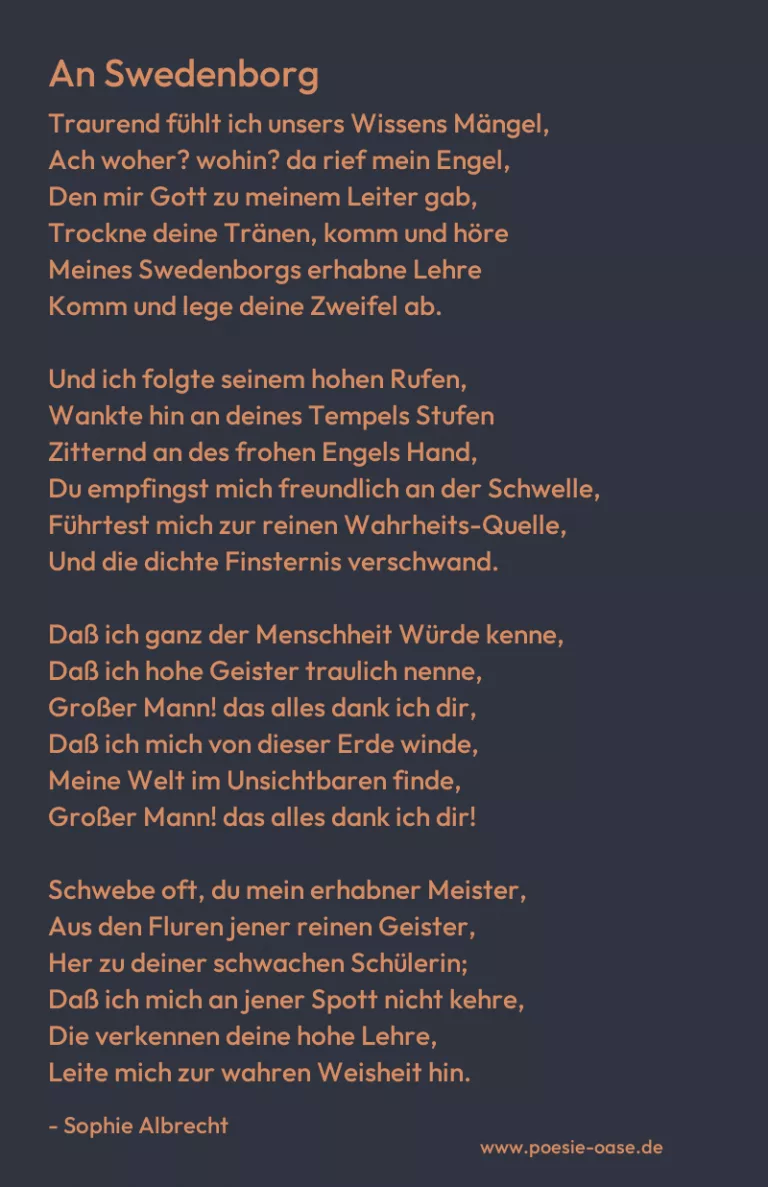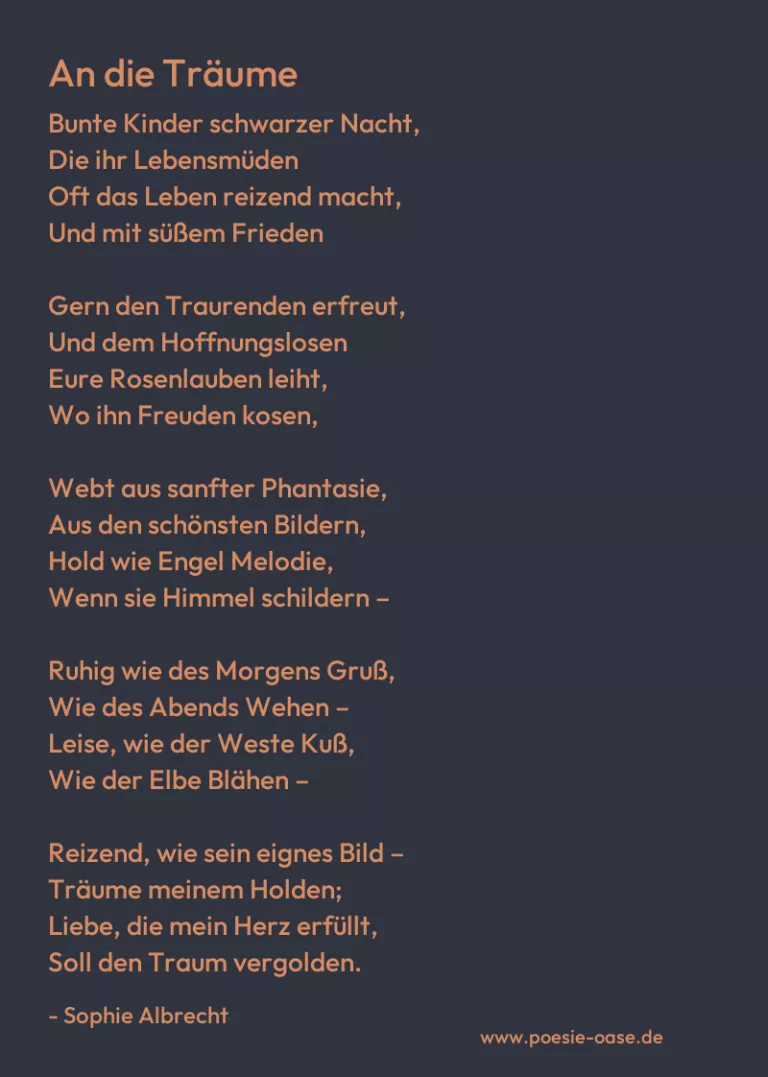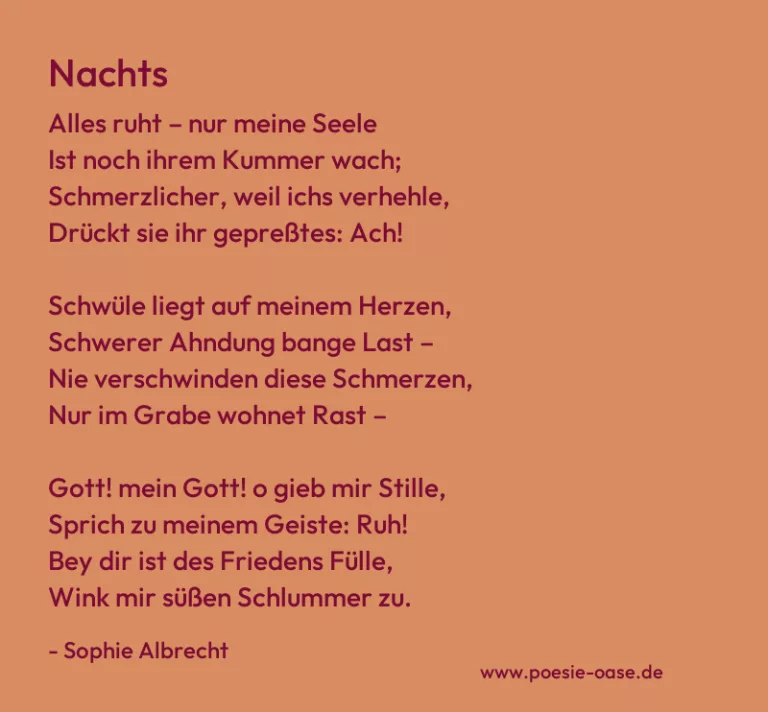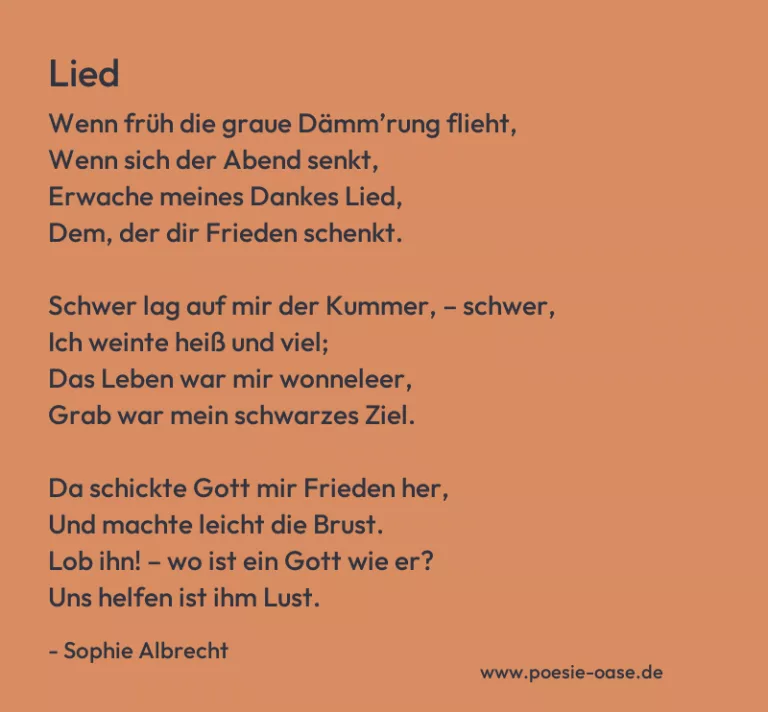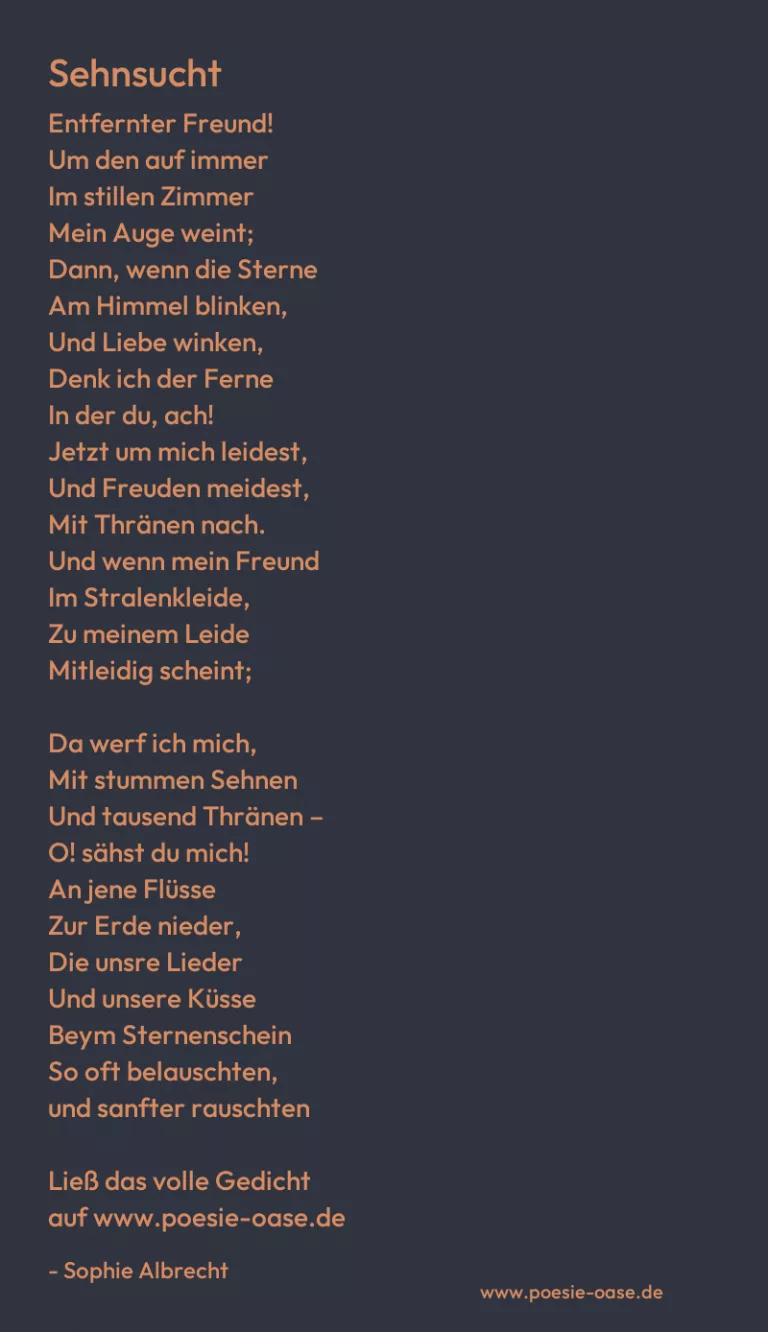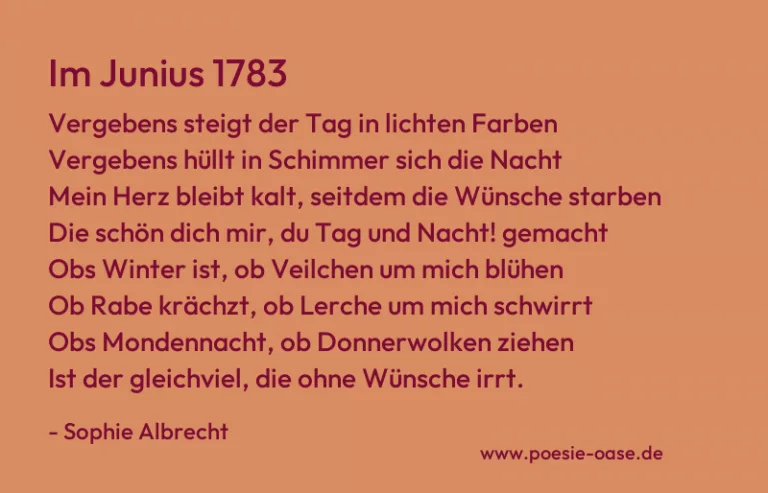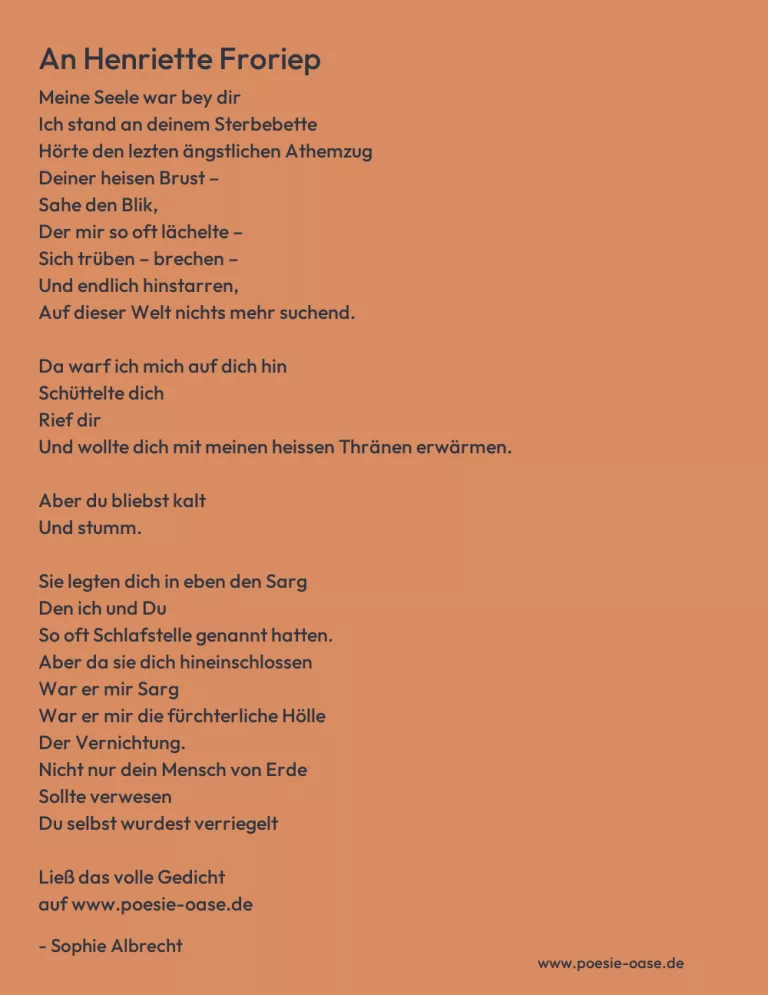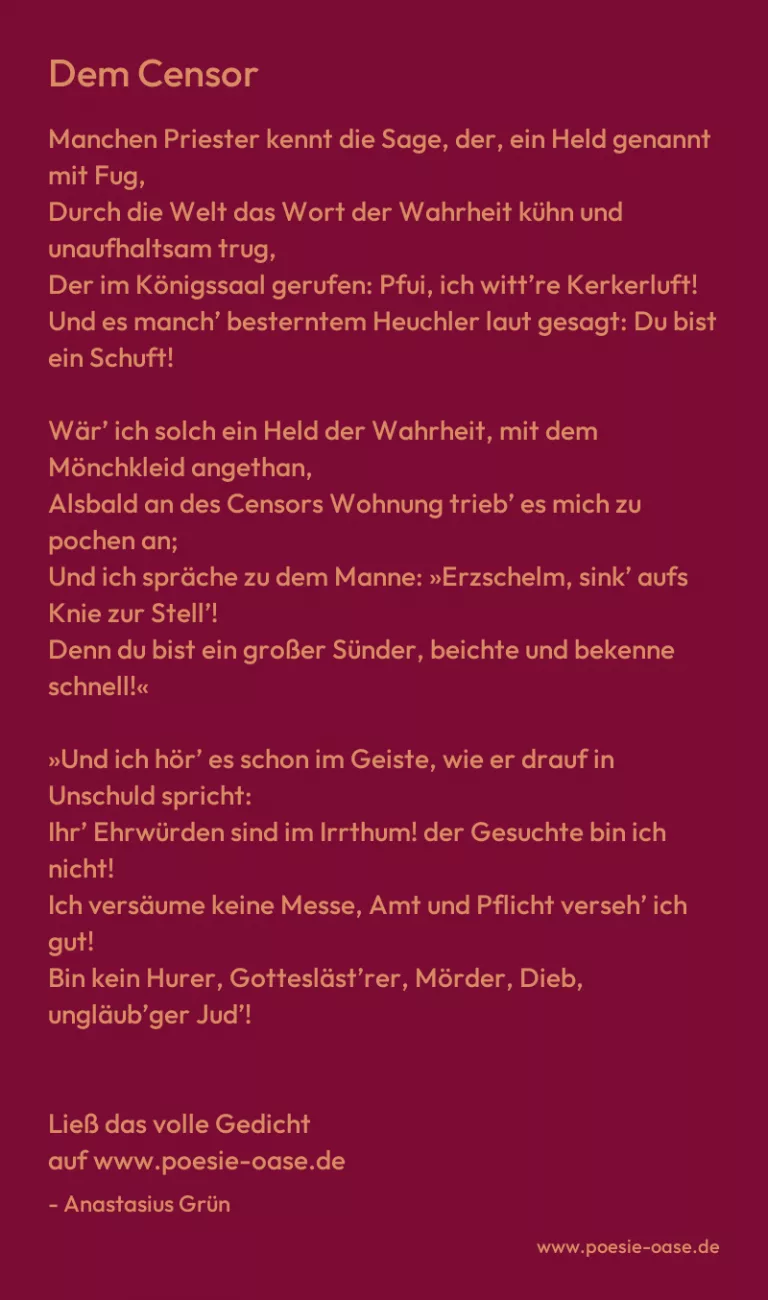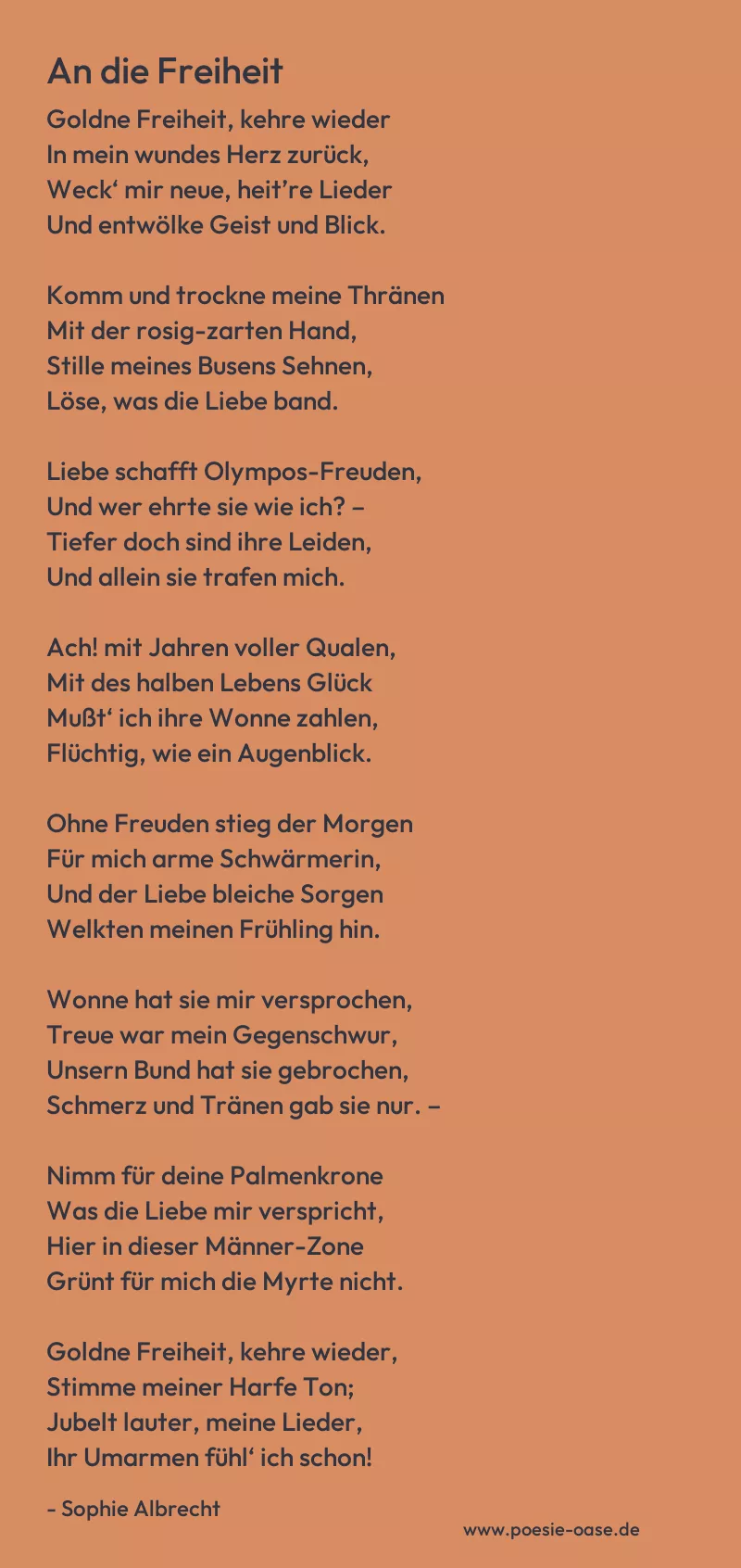Goldne Freiheit, kehre wieder
In mein wundes Herz zurück,
Weck‘ mir neue, heit’re Lieder
Und entwölke Geist und Blick.
Komm und trockne meine Thränen
Mit der rosig-zarten Hand,
Stille meines Busens Sehnen,
Löse, was die Liebe band.
Liebe schafft Olympos-Freuden,
Und wer ehrte sie wie ich? –
Tiefer doch sind ihre Leiden,
Und allein sie trafen mich.
Ach! mit Jahren voller Qualen,
Mit des halben Lebens Glück
Mußt‘ ich ihre Wonne zahlen,
Flüchtig, wie ein Augenblick.
Ohne Freuden stieg der Morgen
Für mich arme Schwärmerin,
Und der Liebe bleiche Sorgen
Welkten meinen Frühling hin.
Wonne hat sie mir versprochen,
Treue war mein Gegenschwur,
Unsern Bund hat sie gebrochen,
Schmerz und Tränen gab sie nur. –
Nimm für deine Palmenkrone
Was die Liebe mir verspricht,
Hier in dieser Männer-Zone
Grünt für mich die Myrte nicht.
Goldne Freiheit, kehre wieder,
Stimme meiner Harfe Ton;
Jubelt lauter, meine Lieder,
Ihr Umarmen fühl‘ ich schon!