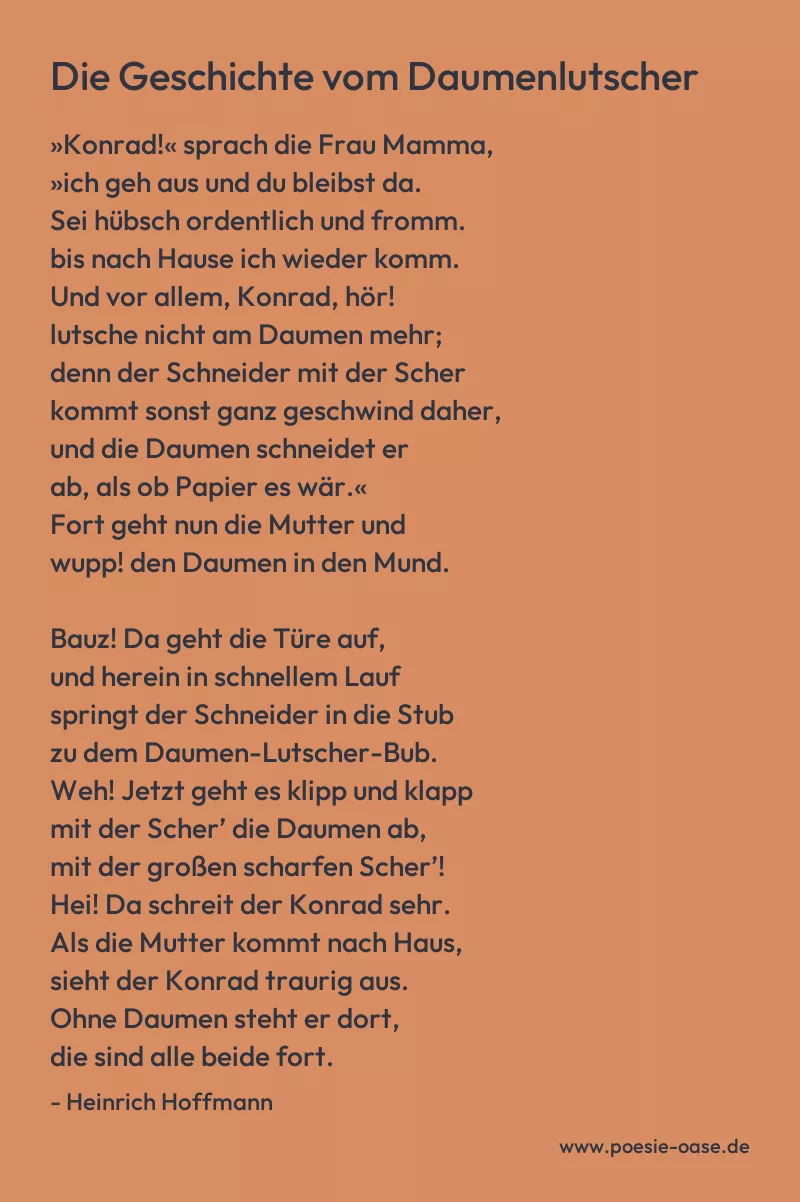Die Geschichte vom Daumenlutscher
»Konrad!« sprach die Frau Mamma,
»ich geh aus und du bleibst da.
Sei hübsch ordentlich und fromm.
bis nach Hause ich wieder komm.
Und vor allem, Konrad, hör!
lutsche nicht am Daumen mehr;
denn der Schneider mit der Scher
kommt sonst ganz geschwind daher,
und die Daumen schneidet er
ab, als ob Papier es wär.«
Fort geht nun die Mutter und
wupp! den Daumen in den Mund.
Bauz! Da geht die Türe auf,
und herein in schnellem Lauf
springt der Schneider in die Stub
zu dem Daumen-Lutscher-Bub.
Weh! Jetzt geht es klipp und klapp
mit der Scher’ die Daumen ab,
mit der großen scharfen Scher’!
Hei! Da schreit der Konrad sehr.
Als die Mutter kommt nach Haus,
sieht der Konrad traurig aus.
Ohne Daumen steht er dort,
die sind alle beide fort.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
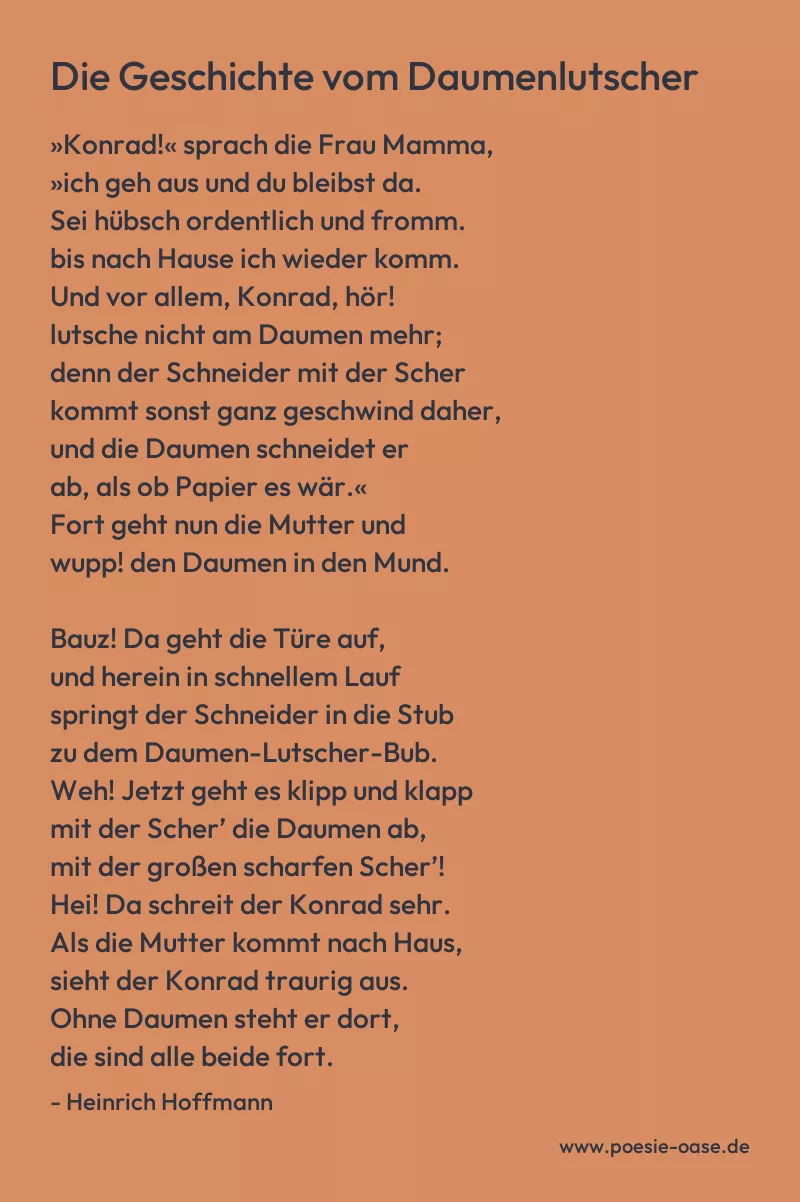
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die Geschichte vom Daumenlutscher“ von Heinrich Hoffmann ist eine didaktische Ballade, die in einfacher Sprache eine eindringliche Warnung an Kinder ausspricht. Es nutzt die Methode der Abschreckung, um von einem bestimmten Verhalten abzuhalten – in diesem Fall dem Lutschen des Daumens. Die Erzählweise ist direkt und unmissverständlich, mit einem klaren Anfang, einem Höhepunkt und einem abschließenden, drastischen Ergebnis. Die strenge Ermahnung der Mutter wird durch die nachfolgende, grausame Ausführung der Drohung durch den Schneider verstärkt, wodurch der Zuhörer oder Leser die Konsequenzen des Missachtens der elterlichen Anweisung schmerzlich vor Augen geführt bekommt.
Die Struktur des Gedichts ist klar gegliedert und folgt einer linearen Erzählweise. Zunächst wird die Ermahnung der Mutter dargestellt, die in einem einfachen Reimschema formuliert ist, das sich leicht einprägt. Der zweite Teil des Gedichts, die Konfrontation mit dem Schneider und die darauffolgende Verstümmelung des Kindes, ist wesentlich kürzer, aber umso schockierender. Der Einsatz von Lautmalerei (z. B. „wupp!“, „Bauz!“) und der scharfe, bildhafte Ausdruck der Handlung verstärken die drastische Wirkung. Diese bildhafte Darstellung des Schneidens der Daumen verdeutlicht die Härte der Strafe und die Schwere der Folgen, die dem Kind durch das Daumenlutschen drohen.
Die Verwendung des Schneiders als Figur, der die Strafe ausführt, ist eine effektive Methode, um die Autorität der Mutter zu untermauern und die Angst vor Autorität zu nutzen, um das gewünschte Verhalten zu erzwingen. Der Schneider ist hier nicht nur eine Figur, die die Drohung ausführt, sondern auch eine beängstigende, fast dämonische Gestalt, die unaufhaltsam und mit scharfer Präzision handelt. Die Kombination von Warnung, Bestrafung und dem traurigen Anblick des Kindes ohne Daumen hinterlässt beim Leser oder Zuhörer einen nachhaltigen Eindruck und befördert die Lektion des Gedichts.
Das Gedicht dient somit als eine Art „Schreckgespenst-Literatur“, die Kindern durch Übertreibung und drastische Bilder eine Lektion erteilt. Es ist ein Spiegelbild der Erziehungspraktiken seiner Zeit, in der Autorität und Gehorsam eine zentrale Rolle spielten. Obwohl die Methoden heute fragwürdig erscheinen, zeigt das Gedicht, wie Hoffmann versuchte, Kindern auf spielerische, aber unmissverständliche Weise Regeln und Verhaltensweisen zu vermitteln, indem er ihre Ängste und ihr Verständnis von Ursache und Wirkung ansprach. Die Ballade ist ein Beispiel dafür, wie Moral in einer bestimmten Epoche durch Geschichten und Charaktere vermittelt wurde, die Kinder sowohl unterhalten als auch belehren sollten.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.