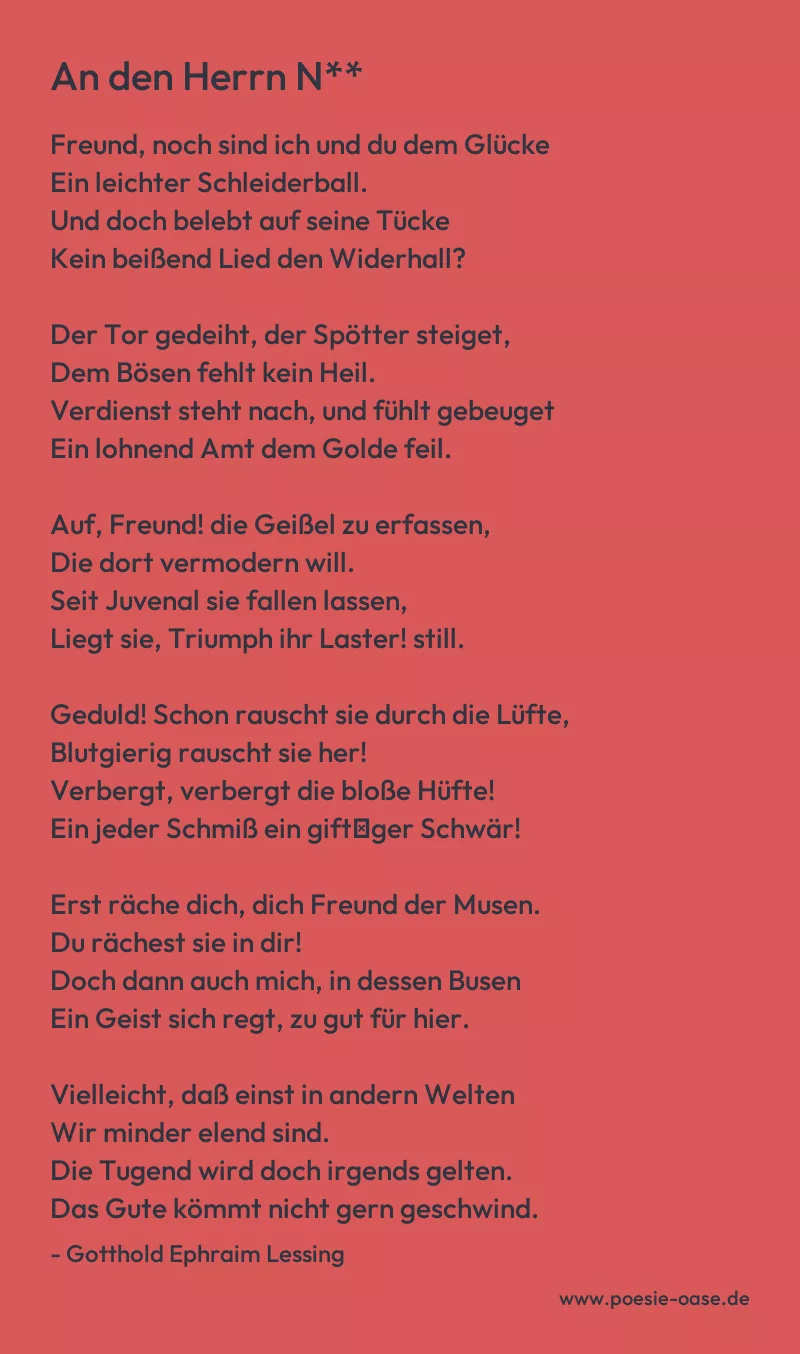An den Herrn N**
Freund, noch sind ich und du dem Glücke
Ein leichter Schleiderball.
Und doch belebt auf seine Tücke
Kein beißend Lied den Widerhall?
Der Tor gedeiht, der Spötter steiget,
Dem Bösen fehlt kein Heil.
Verdienst steht nach, und fühlt gebeuget
Ein lohnend Amt dem Golde feil.
Auf, Freund! die Geißel zu erfassen,
Die dort vermodern will.
Seit Juvenal sie fallen lassen,
Liegt sie, Triumph ihr Laster! still.
Geduld! Schon rauscht sie durch die Lüfte,
Blutgierig rauscht sie her!
Verbergt, verbergt die bloße Hüfte!
Ein jeder Schmiß ein gift′ger Schwär!
Erst räche dich, dich Freund der Musen.
Du rächest sie in dir!
Doch dann auch mich, in dessen Busen
Ein Geist sich regt, zu gut für hier.
Vielleicht, daß einst in andern Welten
Wir minder elend sind.
Die Tugend wird doch irgends gelten.
Das Gute kömmt nicht gern geschwind.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
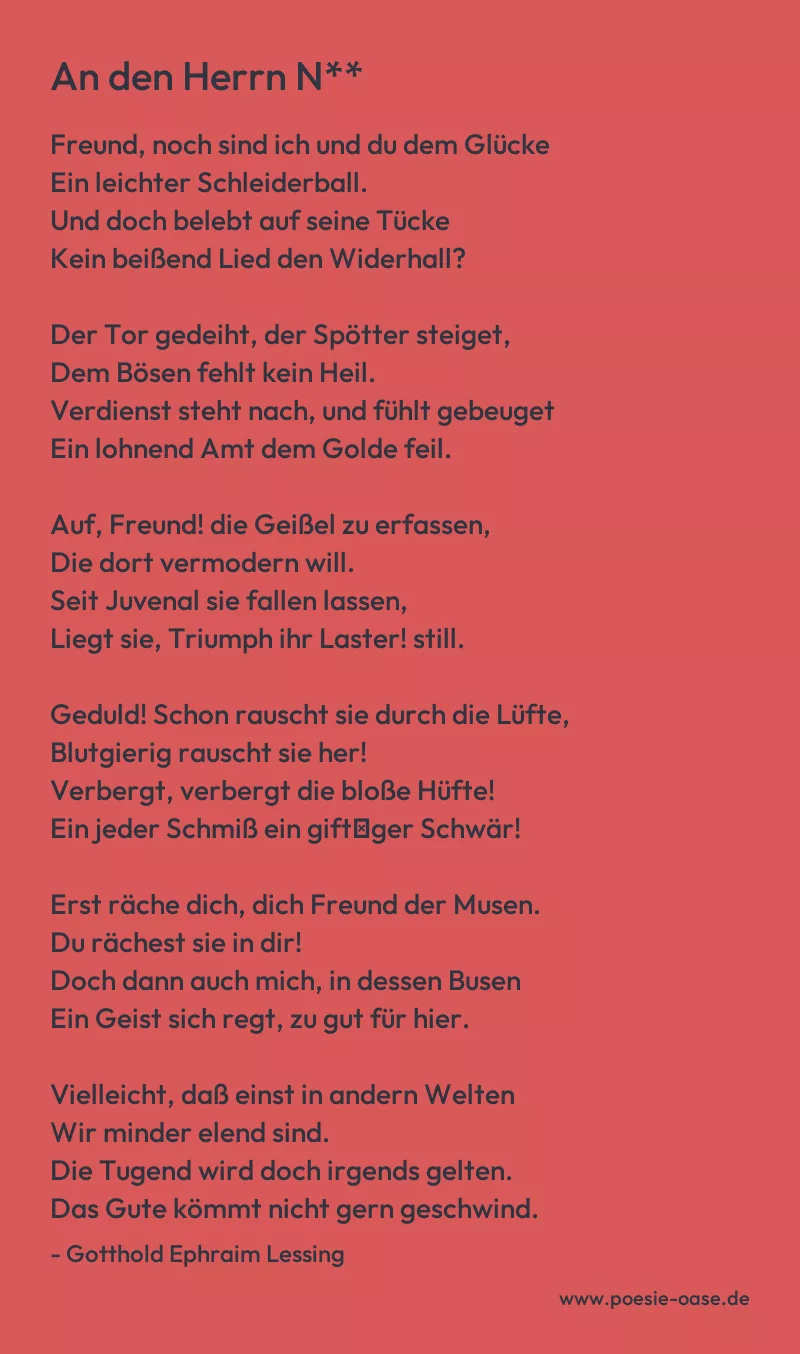
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An den Herrn N“ von Gotthold Ephraim Lessing ist eine kraftvolle und pessimistische Auseinandersetzung mit Ungerechtigkeit und Moral in der Welt. Der Dichter beklagt die scheinbare Triumphfahrt von Torheit und Bosheit, während Verdienst und Tugend unterdrückt werden. Lessing wendet sich an einen Freund, um ihn zur aktiven Kritik und zur moralischen Empörung zu ermutigen. Er ruft nach dem Einsatz der Satire, um die Missstände anzuprangern, da die Welt von Korruption und moralischer Verkommenheit geprägt zu sein scheint.
Die ersten beiden Strophen stellen das zentrale Problem dar: Der „Tor“ gedeiht, der „Spötter“ steigt auf, während Tugend und Verdienst zurückstehen und durch Geld und Vorteilsnahme korrumpiert werden. Lessing benutzt starke Bilder, um die Ungerechtigkeit zu verdeutlichen. Das „leichte Schleiderball“ im ersten Vers deutet auf die Unbeständigkeit und Flüchtigkeit des Glücks hin, was die Hoffnungslosigkeit in der gegenwärtigen Situation unterstreicht. Die rhetorische Frage in der ersten Strophe zeigt die Verwunderung über die fehlende Reaktion auf diese Missstände. In der zweiten Strophe wird das Ausmaß der Korruption und Ungerechtigkeit konkretisiert, wodurch die Frustration des Dichters spürbar wird.
In den folgenden Strophen ruft Lessing seinen Freund zur Tat auf und greift dabei auf das Bild der Satire als Waffe zurück. Er erinnert an Juvenal, einen römischen Satiriker, und fordert die Erhebung der „Geißel“ (Satire) gegen die Ungerechtigkeit. Die vierte Strophe verstärkt diese Aufforderung mit bildhafter Sprache und einer gewissen Brutalität. Die „Geißel“ soll nun durch die Lüfte rauschen, um die „bloße Hüfte“ zu treffen, was die zerstörerische Kraft der Satire verdeutlicht. Die Verwendung von Begriffen wie „gift’ger Schwär“ verstärkt den Eindruck von Bitterkeit und Enttäuschung über die Verhältnisse.
Die letzten beiden Strophen enthalten eine Hoffnungsperspektive, die jedoch von Pessimismus durchzogen ist. Lessing fordert seinen Freund auf, die Musen zu rächen, indem er die Missstände anprangert. Gleichzeitig äußert er die Hoffnung, dass es in „andern Welten“ eine bessere Gerechtigkeit geben könnte, in der Tugend und das Gute endlich ihren verdienten Platz finden. Diese Hoffnung ist jedoch gedämpft, da er zugibt, dass „das Gute nicht gern geschwind“ kommt. Das Gedicht endet somit mit einem Gefühl der Sehnsucht nach einer besseren Welt, aber auch mit der Erkenntnis, dass die Verhältnisse in der gegenwärtigen Welt schwierig und ungerecht sind.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.